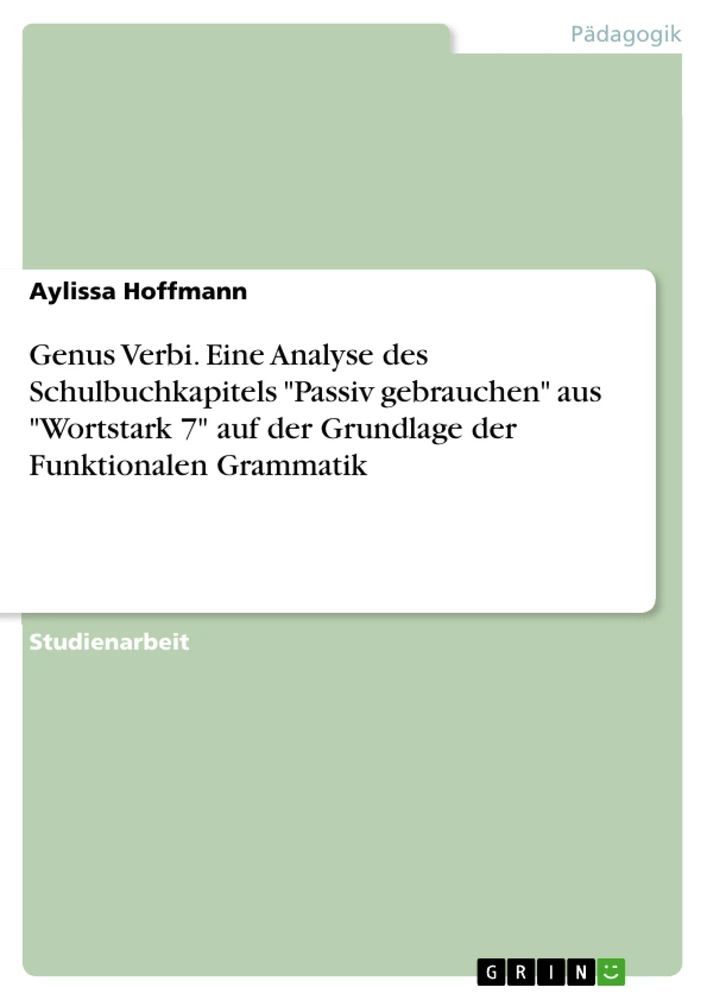Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Genus Verbi: Das Passiv
2.1 Die verschiedenen Formen des Passivs
2.1.1 Das Werden-Passiv: Form und Funktion
2.1.2 Das Sein-Passiv: Form und Funktion
3. Das Deutschbuch "Wortstark 7": Eine Analyse des Kapitels "Werkstatt Sprache: Passiv gebrauchen"
3.1 Analysekriterien
3.2 Sachliche Angemessenheit
3.3 Aufgabenbeschreibungen
3.4 Relevanz der Aufgaben für die SuS
3.5 Blick auf andere Werke und Verbesserungsvorschläge
4. Fazit
5. Quellen
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Genus Verbi: Das Passiv
- 2.1 Die verschiedenen Formen des Passivs
- 2.1.1 Das Werden-Passiv: Form und Funktion
- 2.1.2 Das Sein-Passiv: Form und Funktion
- 3. Das Deutschbuch „Wortstark 7“: Eine Analyse des Kapitels „Werkstatt Sprache: Passiv gebrauchen“
- 3.1 Analysekriterien
- 3.2 Sachliche Angemessenheit
- 3.3 Aufgabenbeschreibungen
- 3.4 Relevanz der Aufgaben für die SuS
- 3.5 Blick auf andere Werke und Verbesserungsvorschläge
- 4. Fazit
- 5. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Schulbuchaufgaben zum Thema Passiv aus dem Deutschbuch „Wortstark 7“ im Hinblick auf ihre Eignung für den Unterricht. Die Analyse basiert auf funktionalgrammatischen Prinzipien und untersucht die Sachlichkeit, Aufgabenbeschreibungen, Relevanz für Schüler und den Vergleich mit anderen Lehrwerken. Ziel ist es, die Qualität der Aufgaben und die didaktische Umsetzung des Passivbegriffs zu bewerten und Verbesserungsvorschläge zu formulieren.
- Analyse des Passivbegriffs anhand funktionalgrammatischer Ansätze
- Bewertung der Aufgaben im Schulbuch „Wortstark 7“ hinsichtlich ihrer Sachlichkeit und didaktischen Eignung
- Untersuchung der Aufgabenbeschreibungen und ihrer Klarheit für die Schüler
- Beurteilung der Relevanz der Aufgaben für den Lernerfolg der Schüler
- Vergleich mit Aufgaben aus anderen Deutschlehrwerken
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse von Schulbuchaufgaben zum Passiv aus dem Buch „Wortstark 7“ anhand funktionalgrammatischer Prinzipien. Es wird die Bedeutung des Passivbegriffs hervorgehoben und die verwendete Literatur (Zifonun, Köller) genannt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Kapitels „Passiv gebrauchen“, wobei der Merkkasten und die Aufgaben auf ihre Korrektheit, Übereinstimmung und verwendete Terminologie geprüft werden. Die Funktionalität der Aufgaben für den Lernerfolg der Schüler steht im Mittelpunkt der Untersuchung, und ein Vergleich mit anderen Lehrwerken ist vorgesehen.
2. Genus Verbi: Das Passiv: Dieses Kapitel erläutert den Begriff des Passivs im Kontext des Genus Verbi. Es werden verschiedene Ansätze zur Unterscheidung von Aktiv und Passiv diskutiert, wobei die Kritik an der Unterscheidung als „Tätigkeitsform“ und „Leideform“ im Vordergrund steht. Stattdessen wird eine semantische und syntaktische Unterscheidung basierend auf täterzugewandter und täterabgewandter Betrachtungsweise erläutert. Die syntaktische Bildung des Passivs aus Aktivsätzen wird detailliert beschrieben, wobei die Reduktion der Valenz des Verbs und die Verschiebung des Fokus von Täter auf Geschehen hervorgehoben werden. Beispiele veranschaulichen die Unterschiede zwischen Aktiv- und Passivsätzen.
2.1 Die verschiedenen Formen des Passivs: Dieses Kapitel unterteilt das Passiv in drei Formen: Werden-Passiv, Sein-Passiv und Bekommen-Passiv. Da das Bekommen-Passiv in den analysierten Schulbüchern keine Rolle spielt, konzentriert sich die Analyse auf das Werden- und Sein-Passiv. Die Bildung und Funktion der jeweiligen Passivformen werden erläutert, wobei der Fokus auf dem Werden-Passiv als Vorgangspassiv und seiner Bedeutung für die Hervorhebung des Handlungsprozesses liegt.
2.1.1 Das Werden-Passiv: Form und Funktion: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert die Bildung des Werden-Passivs (werden + Partizip II) und seine Funktion als Vorgangspassiv. Die Bedeutung des Partizip II als Resultat eines Prozesses wird erläutert. Es wird darauf eingegangen, dass die Wahl zwischen Werden- und Sein-Passiv von der Kennzeichnung des Ergebnisses des Prozesses abhängt (entstehend vs. abgeschlossen). Beispiele veranschaulichen die Funktion des Vorgangspassivs und die Verschiebung der Akzentuierung vom Täter zum Geschehen.
Schlüsselwörter
Passiv, Genus Verbi, Werden-Passiv, Sein-Passiv, Funktionale Grammatik, Schulbuch, Aufgabenanalyse, Didaktik, Grammatikunterricht, Aktiv, Wortstark 7, Analysekriterien, Relevanz, SuS, Verbesserungsvorschläge.
FAQ: Analyse von Schulbuchaufgaben zum Passiv in "Wortstark 7"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Schulbuchaufgaben zum Thema Passiv aus dem Deutschbuch „Wortstark 7“. Der Fokus liegt auf der Bewertung der didaktischen Eignung dieser Aufgaben im Hinblick auf den Grammatikunterricht.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse basiert auf funktionalgrammatischen Prinzipien. Es werden Kriterien wie Sachlichkeit, Aufgabenbeschreibungen, Relevanz für Schüler und ein Vergleich mit anderen Lehrwerken angewendet, um die Qualität der Aufgaben und die didaktische Umsetzung des Passivbegriffs zu bewerten.
Welche Aspekte des Passivs werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Passivbegriff im Kontext des Genus Verbi, unterscheidet zwischen Werden-Passiv und Sein-Passiv, erläutert deren Bildung und Funktion und diskutiert die semantischen und syntaktischen Unterschiede zwischen Aktiv- und Passivsätzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Genus Verbi und dem Passiv (inkl. Werden- und Sein-Passiv), ein Kapitel zur Analyse des Kapitels „Passiv gebrauchen“ aus „Wortstark 7“, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Die Analyse von „Wortstark 7“ umfasst die Bewertung der Sachlichkeit, der Aufgabenbeschreibungen, der Relevanz für Schüler und einen Vergleich mit anderen Lehrwerken.
Welche konkreten Analysekriterien werden für "Wortstark 7" verwendet?
Die Analysekriterien für „Wortstark 7“ umfassen die sachliche Angemessenheit der Aufgaben, die Klarheit der Aufgabenbeschreibungen, die Relevanz der Aufgaben für den Lernerfolg der Schüler (SuS) und einen Vergleich mit Aufgaben aus anderen Deutschlehrwerken.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Qualität der Aufgaben zum Passiv in „Wortstark 7“ zu bewerten und Verbesserungsvorschläge für den Grammatikunterricht zu formulieren. Die Arbeit untersucht, ob die Aufgaben den funktionalgrammatischen Prinzipien entsprechen und ob sie zum Lernerfolg der Schüler beitragen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Passiv, Genus Verbi, Werden-Passiv, Sein-Passiv, Funktionale Grammatik, Schulbuch, Aufgabenanalyse, Didaktik, Grammatikunterricht, Aktiv, Wortstark 7, Analysekriterien, Relevanz, SuS, Verbesserungsvorschläge.
Wie wird das Werden-Passiv und Sein-Passiv unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Werden-Passiv (Vorgangspassiv) und Sein-Passiv. Das Werden-Passiv betont den Prozess der Handlung, während das Sein-Passiv den Zustand nach der Handlung beschreibt. Die Wahl zwischen beiden hängt von der Kennzeichnung des Ergebnisses des Prozesses ab (entstehend vs. abgeschlossen).
Wie wird die Relevanz der Aufgaben für Schüler bewertet?
Die Relevanz der Aufgaben wird anhand ihrer Klarheit, ihrer Eignung zur Vermittlung des Passivbegriffs und ihres Beitrags zum Lernerfolg der Schüler bewertet. Ein Vergleich mit Aufgaben aus anderen Lehrwerken dient als Maßstab.
- Citation du texte
- Aylissa Hoffmann (Auteur), 2012, Genus Verbi. Eine Analyse des Schulbuchkapitels "Passiv gebrauchen" aus "Wortstark 7" auf der Grundlage der Funktionalen Grammatik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201035