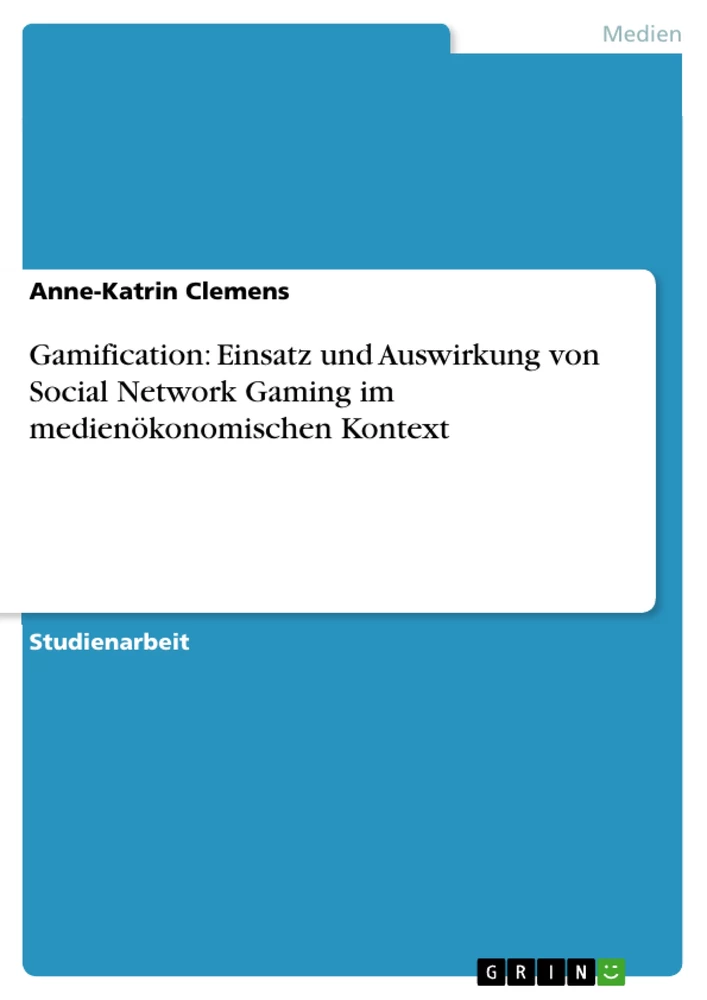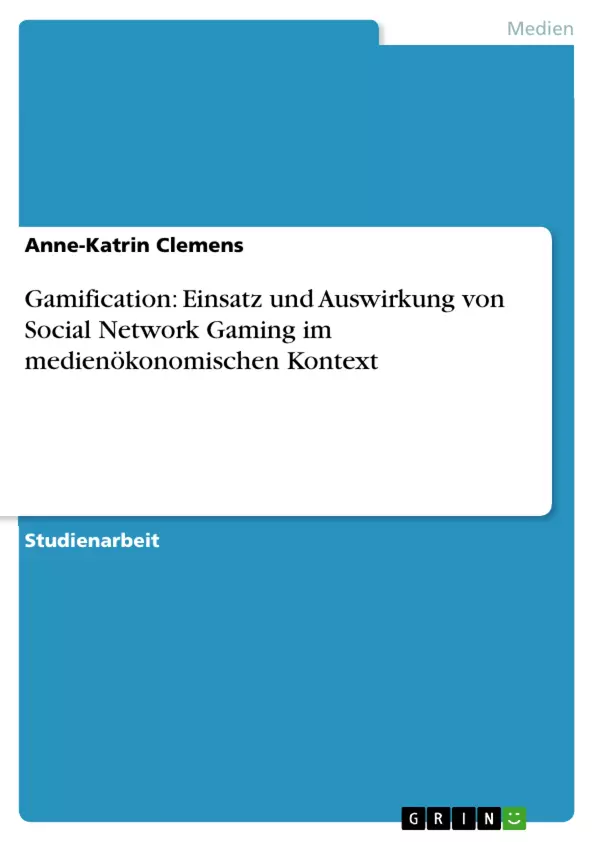Social Gaming ist keine Erfindung des Web 2.0 und trotzdem findet es gerade hier besondere Beachtung und nimmt eine relativ neue Stellung für die kommerzielle Nutzung ein. In der vorliegenden Arbeit soll diese besondere Stellung des Social Gamings, besonders des Social Network Gamings erläutert, aber auch die neuen Möglichkeiten und Kritikpunkte der Gamification des Kommerzes aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Soziale Medien und das Social Web
- Ökonomische Auswirkungen auf die Medienlandschaft
- Ökonomie der Aufmerksamkeit
- Social (Network) Gaming
- Aussichten und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einsatz und der Auswirkung von Social Network Gaming im medienökonomischen Kontext. Sie analysiert die besondere Stellung von Social Gaming im Web 2.0 und beleuchtet sowohl die neuen Möglichkeiten als auch die Kritikpunkte der Gamification des Kommerzes.
- Die Bedeutung sozialer Medien und des Social Web
- Die ökonomischen Auswirkungen von Social Media auf die Medienlandschaft
- Die Funktionsweise und das Potenzial von Social (Network) Gaming
- Die Perspektiven und Herausforderungen der Gamification
- Kritische Aspekte der Gamification im medienökonomischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel behandelt die Definition und Entwicklung von sozialen Medien und dem Social Web. Es werden die wichtigsten Merkmale und Funktionen dieser Medien erläutert, sowie die Bedeutung der User Generated Content (UGC) und der sozialen Interaktion.
- Das zweite Kapitel widmet sich den ökonomischen Auswirkungen von Social Media auf die Medienlandschaft. Dabei wird das Konzept der "Ökonomie der Aufmerksamkeit" analysiert und die Bedeutung der menschlichen Aufmerksamkeit als knappe Ressource im digitalen Kontext beleuchtet.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Phänomen des Social Gaming, insbesondere dem Social Network Gaming. Die Funktionsweise und die medienökonomischen Potenziale dieser Form des Gamings werden analysiert.
Schlüsselwörter
Soziale Medien, Social Web, Web 2.0, User Generated Content (UGC), Gamification, Social Network Gaming, medienökonomischer Kontext, Ökonomie der Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Kommerzialisierung, digitale Vernetzung, digitale Medien, Medienkonvergenz.
Was ist Social Network Gaming?
Es handelt sich um Spiele, die innerhalb sozialer Netzwerke (Web 2.0) stattfinden und die soziale Interaktion zwischen den Nutzern als zentrales Element nutzen.
Was bedeutet „Ökonomie der Aufmerksamkeit“?
Dieses Konzept beschreibt die menschliche Aufmerksamkeit als knappe Ressource im digitalen Zeitalter, um die Unternehmen durch Gamification und soziale Medien konkurrieren.
Wie wird Gamification kommerziell genutzt?
Unternehmen nutzen spieltypische Elemente in spielfremden Kontexten, um die Kundenbindung zu erhöhen, die Aufmerksamkeit zu steigern und kommerzielle Ziele zu erreichen.
Welche Rolle spielt User Generated Content (UGC)?
UGC ist ein wesentliches Merkmal des Social Web, bei dem Nutzer selbst Inhalte erstellen und so aktiv zur Wertschöpfung und Vernetzung beitragen.
Welche Kritikpunkte gibt es am Social Gaming?
Kritisiert werden unter anderem die zunehmende Kommerzialisierung privater Interaktionen und die potenziellen manipulativen Aspekte der Gamification.
Was ist Medienkonvergenz in diesem Zusammenhang?
Medienkonvergenz beschreibt das Zusammenwachsen verschiedener Medienformen (Spiele, soziale Netzwerke, Werbung) zu einer integrierten digitalen Erlebniswelt.