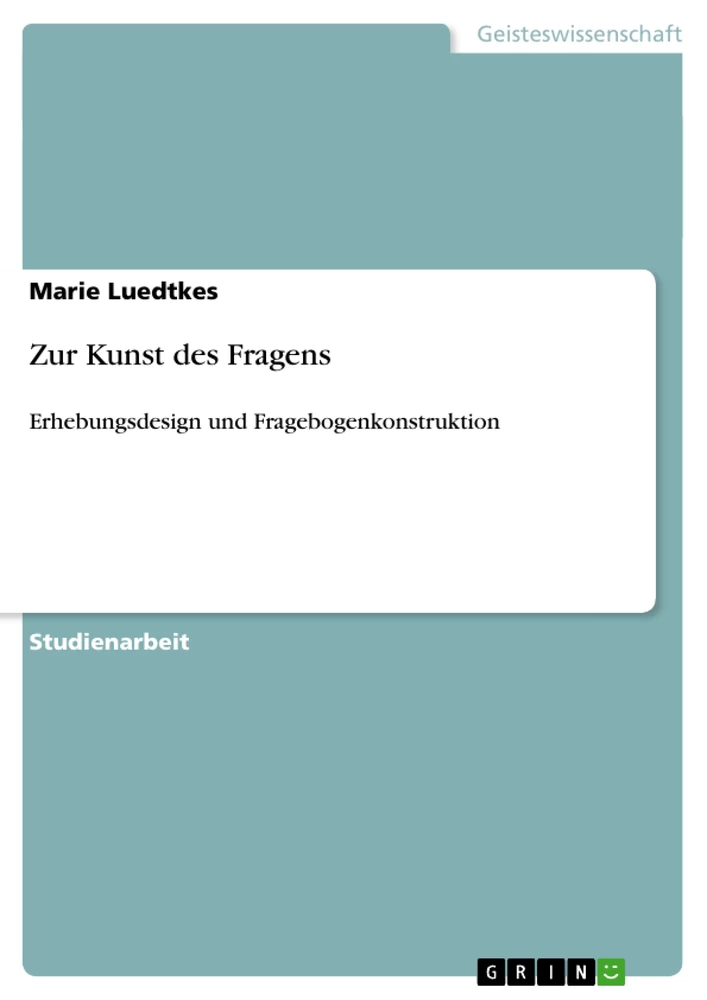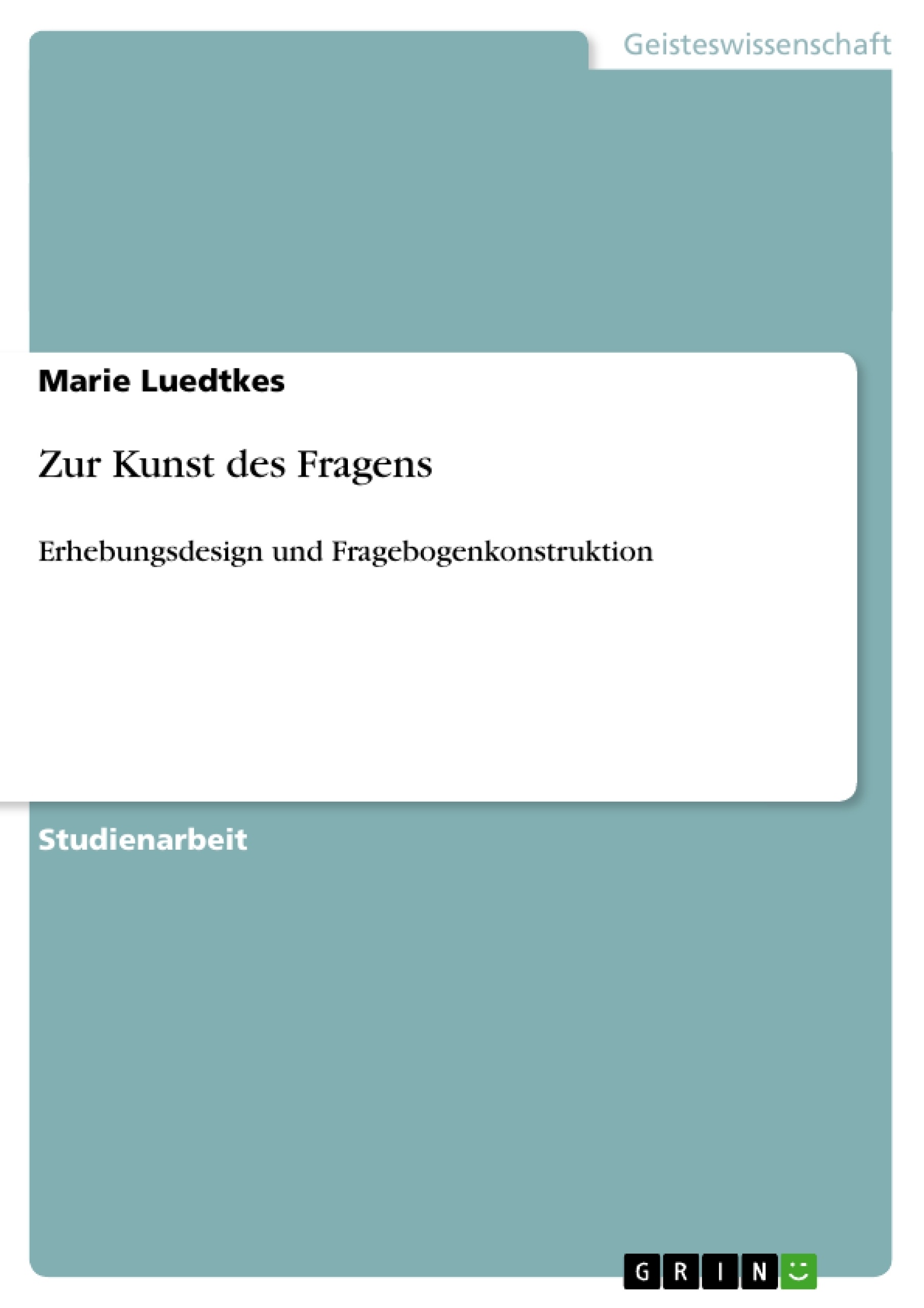Die Befragung ist das weitverbreiteste Datenerhebungsdesign der empirischen Sozialwissenschaften und hat längst auch in der Meinungs-, Markt- und Konsumforschung, aber auch in der Psychologie einen hohen Stellenwert erlangt. Essentieller Bestandteil einer jeden Befragung, sei sie nun mündlich, telefonisch, schriftlich
oder per Internt ist der Fragebogen. Dass viele Wissenschaftler schon von einer Kunstlehre sprechen, wenn sie über die Fragebogenkonstruktion reden, hat durchaus seine Berechtigung. Unzählige Regeln, Leitfäden und Gebrauchsanweisung gibt es für dessen Konstruktion. Und dennoch muss jeder Fragebogen, jede einzelne
Frage in der spezifischen Forschungssituation erst einmal konstruiert, überdacht und diskutiert werden. Man kennt den alten Spruch „Blöde Frage, blöde Antwort“. Auch wenn im pädagogischen
Kontext gerne von „es gibt keine blöden Fragen“ geredet wird, steckt
in dieser Binsenweisheit in Bezug auf die standardisierte Befragunge eine Menge Wahrheit. Ein standardisierter Fragebogen hat den Anspruch eine akkurate Translation einer Forschungsfrage, die es zu ergründen gilt, zu sein. Jedes falsche Wort, jede undurchdachte Formulierung kann so zur Krux werden und fehlerhafte oder
unbrauchbare Antworten hervorbringen. Da die Frage zentrales Merkmal eines jede Fragebogens ist werden in der vorliegenden Arbeit wichtige Prinzipien für die Formulierung von Fragen, die in einem
standardisierten Fragebogen zum Einsatz kommen, dargestellt. Einige Konstruktionsprinzipien sind auf jeden Fall zu berücksichtigen — wie z.B. die Vermeidung doppelter Stimuli —, da es sonst zu unerwünschten Effekten oder schlimmstenfalls zu unbrauchbaren Daten kommen kann. Bevor aber auf diese Regeln der Frageformulierung
eingegangen wird, wird im Folgenden zunächst rezensiert welche Inhalte mit den konkreten Fragen erfasst werden sollen. Im Anschluß an die inhaltlichen Fragetypen und die Konstruktionsprinzipien werden die zwei besonderen Problem „Meinungslosigkeit“ und „Mittelkategorie“ vorgestellt. Aufgrund der Begrenztheit der Arbeit können die Punkte mehr angerissen als ausdiskutiert
werden, und nur ein recht kleiner Ausblick in die Breite dieses umfassenden Themas geboten werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Frage
- 2.1 Fragetypen
- 2.2 Die 10 Gebote der Fragenformulierung
- 3. Die Antworten
- 3.1 Meinungslosigkeit
- 3.2 Mittelkategorie
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Prinzipien der Fragenformulierung für standardisierte Fragebögen in empirischen Sozialwissenschaften. Ziel ist es, wichtige Konstruktionsaspekte aufzuzeigen und potenzielle Probleme wie Meinungslosigkeit und die Verwendung von Mittelkategorien zu beleuchten.
- Formulierung von Fragen in standardisierten Fragebögen
- Vermeidung von Doppeldeutigkeiten und unerwünschten Effekten
- Unterscheidung verschiedener Fragetypen (Einstellungs-, Verhaltens-, Überzeugungs-, Eigenschaftsfragen)
- Problematik von Meinungslosigkeit in Antworten
- Verwendung und Herausforderungen von Mittelkategorien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die zentrale Rolle von Befragungen und Fragebögen in den Sozialwissenschaften und verwandten Disziplinen. Sie unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Fragebogenkonstruktion, da ungeschickte Formulierungen zu fehlerhaften Daten führen können. Der Fokus liegt auf der Bedeutung präziser Fragen als Grundlage für aussagekräftige Ergebnisse. Die Arbeit skizziert den Aufbau, indem sie zunächst die zu erfassenden Inhalte rezensiert, dann Fragetypen und Konstruktionsprinzipien darstellt und schließlich die Probleme "Meinungslosigkeit" und "Mittelkategorie" behandelt. Aufgrund des begrenzten Umfangs werden die Punkte eher angerissen als umfassend diskutiert.
2. Die Frage: Dieses Kapitel widmet sich der scheinbar einfachen, aber in der Praxis komplexen Aufgabe, Fragen für einen Fragebogen zu formulieren. Es hebt die Herausforderungen hervor, die sich bei der Konstruktion von Fragen im Kontext empirischer Forschung stellen. Der Abschnitt leitet über zur detaillierten Betrachtung der verschiedenen Fragetypen.
2.1 Fragetypen: Dieser Abschnitt differenziert zwischen verschiedenen Fragetypen: Einstellungs- oder Meinungsfragen, Verhaltensfragen, Überzeugungsfragen und Eigenschaftsfragen. Für jeden Typ werden Beispiele gegeben und die jeweiligen Besonderheiten und Herausforderungen bei der Formulierung erläutert. Es wird auf die Problematik der Prognosefähigkeit von Einstellungen und die Unterscheidung zwischen berichtetem und tatsächlichem Verhalten eingegangen. Die Arbeit von Labaw (1982) wird zitiert, die die Konzentration auf aktuelles Verhalten und objektive Umgebungsbedingungen empfiehlt, anstatt auf subjektive Informationen wie Einstellungen und Meinungen.
Schlüsselwörter
Fragebogenkonstruktion, Fragetypen, standardisierte Befragung, empirische Sozialforschung, Meinungsforschung, Meinungslosigkeit, Mittelkategorie, Verhaltensfragen, Einstellungsfragen, Überzeugungsfragen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Fragenformulierung in standardisierten Fragebögen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit behandelt die Prinzipien der Fragenformulierung für standardisierte Fragebögen in den empirischen Sozialwissenschaften. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Fehlern durch ungeschickte Formulierungen und der Erläuterung potenzieller Probleme wie Meinungslosigkeit und die Verwendung von Mittelkategorien.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, wichtige Konstruktionsaspekte von Fragen in standardisierten Fragebögen aufzuzeigen und potenzielle Probleme wie Meinungslosigkeit und die Verwendung von Mittelkategorien zu beleuchten. Die Arbeit soll dabei helfen, präzise Fragen zu formulieren, um aussagekräftige Ergebnisse in empirischen Studien zu gewährleisten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Formulierung von Fragen in standardisierten Fragebögen, Vermeidung von Doppeldeutigkeiten und unerwünschten Effekten, Unterscheidung verschiedener Fragetypen (Einstellungs-, Verhaltens-, Überzeugungs-, Eigenschaftsfragen), Problematik von Meinungslosigkeit in Antworten und Verwendung und Herausforderungen von Mittelkategorien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Frage (inkl. Unterkapitel Fragetypen), Die Antworten (inkl. Unterkapitel Meinungslosigkeit und Mittelkategorie) und Resümee. Die Einleitung betont die Bedeutung präziser Fragen für aussagekräftige Ergebnisse. Das Kapitel "Die Frage" behandelt die Herausforderungen bei der Fragenkonstruktion. "Die Antworten" beleuchtet Probleme wie Meinungslosigkeit und Mittelkategorien. Das Resümee fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
Welche Fragetypen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen verschiedenen Fragetypen: Einstellungs- oder Meinungsfragen, Verhaltensfragen, Überzeugungsfragen und Eigenschaftsfragen. Für jeden Typ werden Beispiele gegeben und die jeweiligen Besonderheiten und Herausforderungen bei der Formulierung erläutert. Die Problematik der Prognosefähigkeit von Einstellungen und die Unterscheidung zwischen berichtetem und tatsächlichem Verhalten werden ebenfalls thematisiert.
Welche Probleme werden im Zusammenhang mit Antworten diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Problematik von Meinungslosigkeit in Antworten und die Verwendung und Herausforderungen von Mittelkategorien. Es wird erläutert, wie diese Aspekte die Qualität und Aussagekraft von Befragungsergebnissen beeinflussen können.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Fragebogenkonstruktion, Fragetypen, standardisierte Befragung, empirische Sozialforschung, Meinungsforschung, Meinungslosigkeit, Mittelkategorie, Verhaltensfragen, Einstellungsfragen, Überzeugungsfragen.
Wie ausführlich werden die einzelnen Punkte behandelt?
Aufgrund des begrenzten Umfangs werden die Punkte in der Arbeit eher angerissen als umfassend diskutiert. Die Arbeit dient als umfassende Übersicht und Einleitung in das Thema der Fragenformulierung in standardisierten Fragebögen.
- Quote paper
- Marie Luedtkes (Author), 2008, Zur Kunst des Fragens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201229