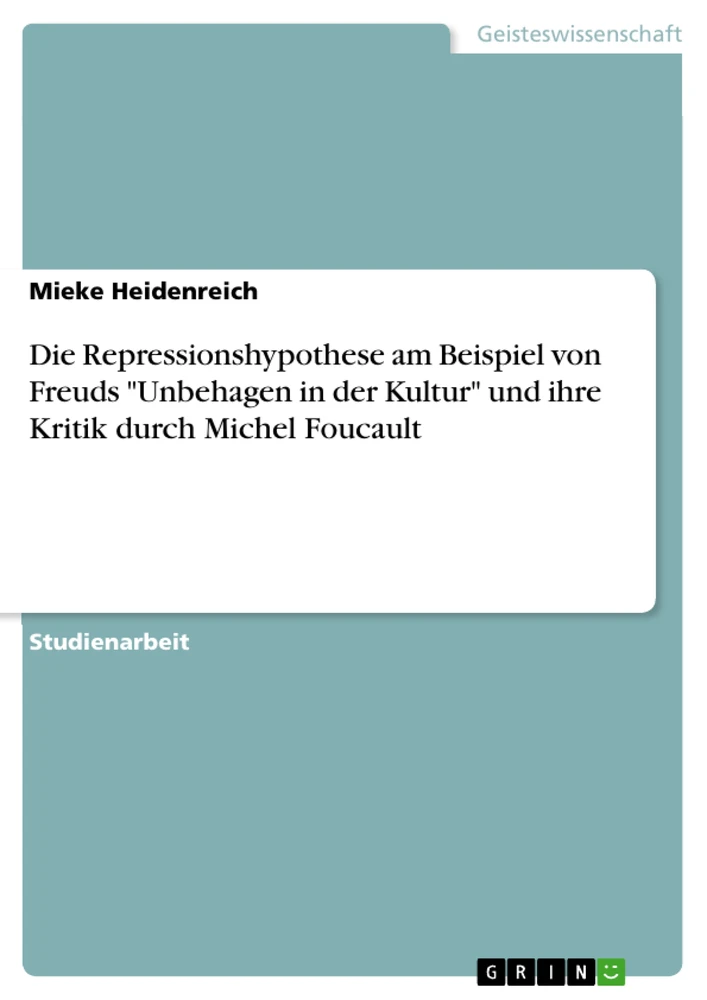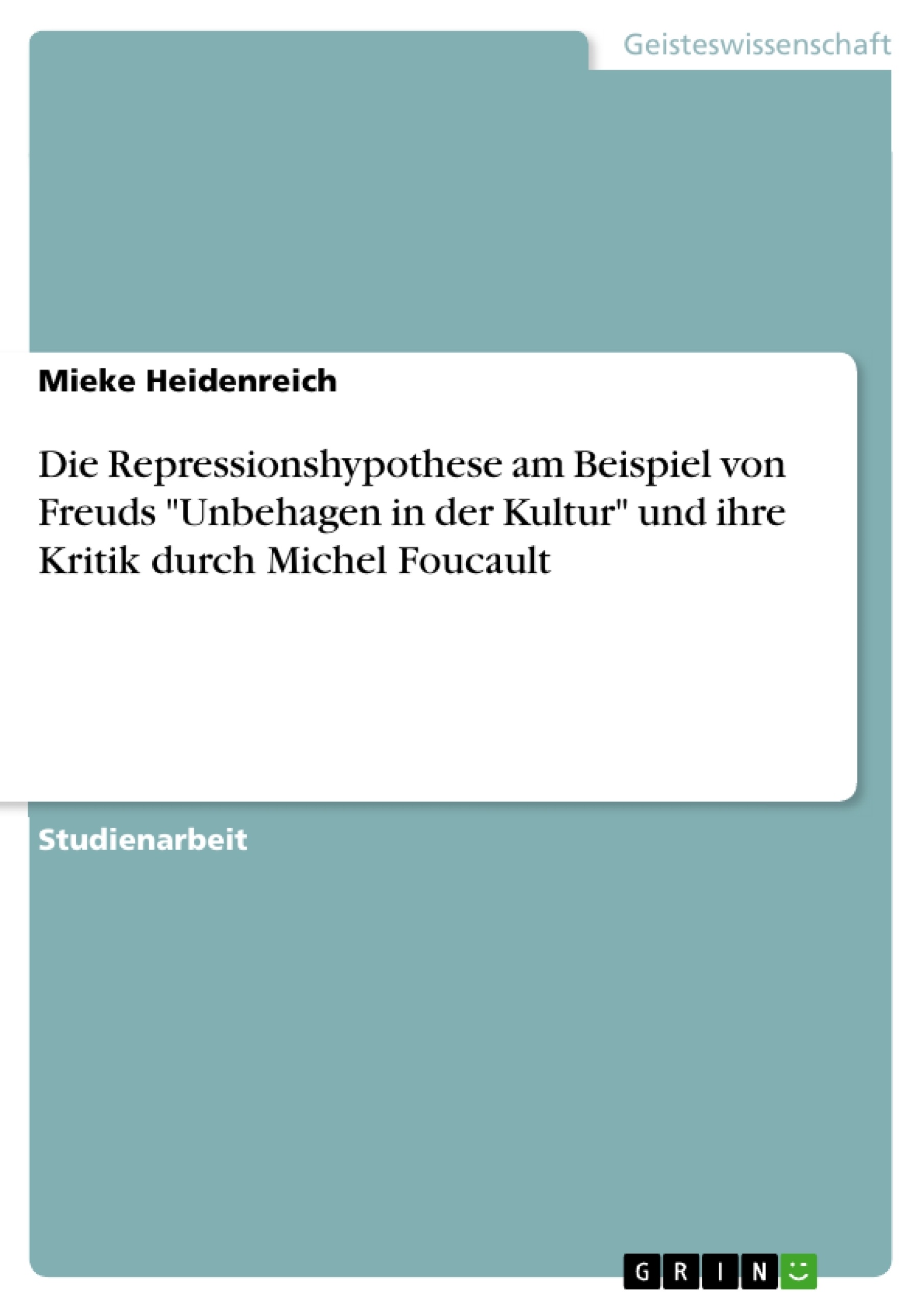Die sexuelle Revolution der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde weitgehend als Befreiung der Sexualität aufgefasst: Erst jetzt fielen die letzten Bastionen der viktorianischen Sexualunterdrückung. Diese Analyse kann sich auf die Arbeiten des Begründers der Psychoanalyse, Sigmund Freud, stützen, die beschreiben, wie die Sexualität seit dem 18. Jahrhundert unterdrückt wurde.
Der Anthropologe Michel Foucault bezeichnet Freuds Ansicht als „Repressionshypothese“ und kritisiert diese in seinem 1976 in Frankreich erschienenen Werk „Der Wille zum Wissen“ vehement. Foucault orientiert seine Analyse nicht an der Repression, sondern fragt nach den Machtmechanismen, die den Diskurs Sexualität prägen. Foucault beschreibt, dass der Wandel von der vermeintlichen Unterdrückung der vergangenen Jahrhunderte hin zur vermeintlichen sexuellen Befreiung vielmehr ein Wandel der Kontrollmechanismen war: Die Kontrolle über die individuelle Sexualität sei nicht länger eine Kontrolle von außen gewesen, sondern hätte eine Subjektivierung erfahren. Absicht und Folge der offiziellen Redeverbote sei nicht die Unterdrückung der Sexualität gewesen, sondern die intensive Diskursivierung dieser. Somit sei die von Freud beschriebene Repression historisch nicht evident. Vielmehr sei selbst die kritische Auseinandersetzung mit der Unterdrückung der Sexualität Teil des von der Macht beabsichtigten Diskurses. Zudem versteht Foucault die Macht nicht als ausschließlich repressiv, sondern beleuchtet auch ihre produktive Wirkung.
Um diese Überlegungen zu verdeutlichen, soll im Folgenden die Repressionshypothese am Beispiel von Freuds „Unbehagen in der Kultur“ (1930) und ihre Kritik durch Michel Foucault dargestellt werden.
Note: 1,0
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sigmund Freuds "Das Unbehagen in der Kultur"
- Darstellung
- Natürlichkeit der Sexualität
- Der Antagonismus von Kultur und Sexualität
- Unterdrückung der Sexualität auf individueller Ebene
- Unterdrückung der Sexualität auf gesellschaftlicher Ebene
- Zusammenfassung
- Historische Verortung
- Darstellung
- Michel Foucaults Kritik der Freud'schen Repressionshypothese
- Darstellung
- Erschöpfende Diskursivierung der Sexualität
- Gegenseitige Stimulation von Sexualität und Macht
- Zusammenfassung
- Stellenwert der Repressionshypothese im Werk von Foucault
- Foucaults Machtbegriff
- Darstellung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Freud'sche Repressionshypothese, wie sie in "Das Unbehagen in der Kultur" formuliert wird, und ihre Kritik durch Michel Foucault. Ziel ist es, die zentralen Argumente beider Denker darzustellen und die unterschiedlichen Perspektiven auf die Beziehung zwischen Sexualität, Kultur und Macht herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung der Konzepte und der Analyse ihrer jeweiligen historischen Einordnung.
- Freuds Repressionshypothese und ihre zentralen Annahmen
- Der Antagonismus zwischen Sexualität und Kultur nach Freud
- Foucaults Kritik an der Repressionshypothese
- Foucaults Machtbegriff und seine Anwendung auf den Diskurs der Sexualität
- Der historische Kontext beider Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung vor: die Auseinandersetzung mit der Freud'schen Repressionshypothese und ihrer Kritik durch Foucault. Sie verortet die Debatte im Kontext der sexuellen Revolution der 1970er Jahre und hebt den Unterschied zwischen Freuds repressiver und Foucaults produktiver Sichtweise auf Macht hervor. Die Arbeit kündigt die Analyse von Freuds "Das Unbehagen in der Kultur" und Foucaults Kritik an.
Sigmund Freuds "Das Unbehagen in der Kultur": Dieses Kapitel präsentiert die Freud'sche Repressionshypothese, die besagt, dass die Entwicklung von Kultur und Gesellschaft nur durch die Unterdrückung der Sexualität möglich ist. Freud beschreibt einen Antagonismus zwischen der natürlichen, triebgesteuerten Sexualität und den Anforderungen der Kultur. Die Unterdrückung erfolgt sowohl auf individueller Ebene (Sublimierung, Über-Ich) als auch auf gesellschaftlicher Ebene (kulturelle Normen und Tabus). Das Kapitel analysiert Freuds Vorstellung der "Natürlichkeit" der Sexualität, den Ursprung des Kulturprozesses in der Familie und die damit verbundenen Konflikte zwischen individueller Triebbefriedigung und gesellschaftlichen Anforderungen. Es beleuchtet Freuds Vorstellung der Kultur als handelndes Subjekt, das die Sexualität einschränkt, und die daraus resultierende "Kulturfeindlichkeit" des Individuums.
Michel Foucaults Kritik der Freud'schen Repressionshypothese: Dieses Kapitel beschreibt Foucaults Kritik an Freuds Repressionshypothese. Im Gegensatz zu Freud sieht Foucault nicht eine Unterdrückung der Sexualität, sondern eine "erschöpfende Diskursivierung". Er argumentiert, dass die vermeintliche sexuelle Befreiung lediglich einen Wandel der Kontrollmechanismen darstellt, nicht eine tatsächliche Abnahme der Kontrolle. Foucault betont die produktive Wirkung von Macht und deren Verflechtung mit Sexualität. Die Repression ist für ihn nicht das zentrale Element, sondern die ständige Produktion von Wissen und Diskursen über Sexualität. Das Kapitel erläutert Foucaults Machtbegriff und zeigt, wie er diesen auf den Diskurs der Sexualität anwendet.
Schlüsselwörter
Repressionshypothese, Sigmund Freud, Michel Foucault, Sexualität, Kultur, Macht, Diskurs, "Das Unbehagen in der Kultur", Triebunterdrückung, Sublimierung, Diskursivierung, Kontrollmechanismen.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Freud'schen Repressionshypothese und ihrer Kritik durch Foucault
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Sigmund Freuds Repressionshypothese, wie sie in "Das Unbehagen in der Kultur" dargestellt wird, und deren Kritik durch Michel Foucault. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Perspektiven auf die Beziehung zwischen Sexualität, Kultur und Macht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Freuds zentrale Annahmen zur Repressionshypothese, den Antagonismus zwischen Sexualität und Kultur nach Freud, Foucaults Kritik an dieser Hypothese, Foucaults Machtbegriff und dessen Anwendung auf den Diskurs der Sexualität, sowie den historischen Kontext beider Theorien.
Wie strukturiert sich die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Freuds "Das Unbehagen in der Kultur", ein Kapitel zur Foucaultschen Kritik an Freud und ein Fazit. Jedes Kapitel beinhaltet eine Darstellung der jeweiligen Argumentation, eine historische Einordnung und eine Zusammenfassung der Kernaussagen.
Was sind die zentralen Argumente Freuds?
Freud argumentiert, dass die Entwicklung von Kultur und Gesellschaft nur durch die Unterdrückung der menschlichen Sexualität möglich ist. Er beschreibt einen Antagonismus zwischen der natürlichen, triebgesteuerten Sexualität und den Anforderungen der Kultur. Diese Unterdrückung findet sowohl auf individueller (Sublimierung, Über-Ich) als auch gesellschaftlicher Ebene (kulturelle Normen und Tabus) statt.
Wie kritisiert Foucault Freuds Repressionshypothese?
Foucault kritisiert Freuds Vorstellung einer reinen Unterdrückung der Sexualität. Stattdessen beschreibt er eine "erschöpfende Diskursivierung" der Sexualität. Er argumentiert, dass vermeintliche sexuelle Befreiung lediglich einen Wandel der Kontrollmechanismen darstellt, nicht eine tatsächliche Abnahme der Kontrolle. Foucault betont die produktive Wirkung von Macht und deren Verflechtung mit Sexualität.
Was ist Foucaults Machtbegriff und wie wendet er ihn an?
Foucaults Machtbegriff geht davon aus, dass Macht nicht nur repressiv, sondern auch produktiv wirkt. Sie ist nicht nur ein Instrument der Unterdrückung, sondern auch der Wissensproduktion und der Schaffung von Diskursen. Foucault wendet diesen Machtbegriff auf den Diskurs der Sexualität an, indem er zeigt, wie Macht die Produktion von Wissen und Normen über Sexualität beeinflusst.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit verortet die Debatte zwischen Freud und Foucault im Kontext der sexuellen Revolution der 1970er Jahre und hebt den Unterschied zwischen Freuds repressiver und Foucaults produktiver Sichtweise auf Macht hervor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Repressionshypothese, Sigmund Freud, Michel Foucault, Sexualität, Kultur, Macht, Diskurs, "Das Unbehagen in der Kultur", Triebunterdrückung, Sublimierung, Diskursivierung, Kontrollmechanismen.
- Arbeit zitieren
- Mieke Heidenreich (Autor:in), 2012, Die Repressionshypothese am Beispiel von Freuds "Unbehagen in der Kultur" und ihre Kritik durch Michel Foucault, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201325