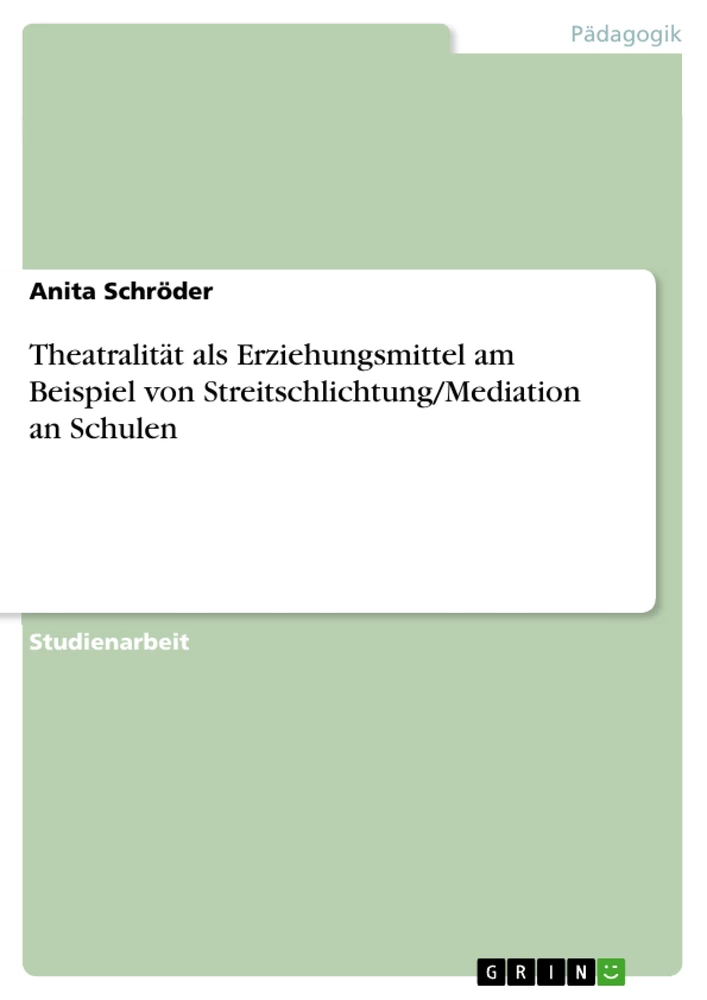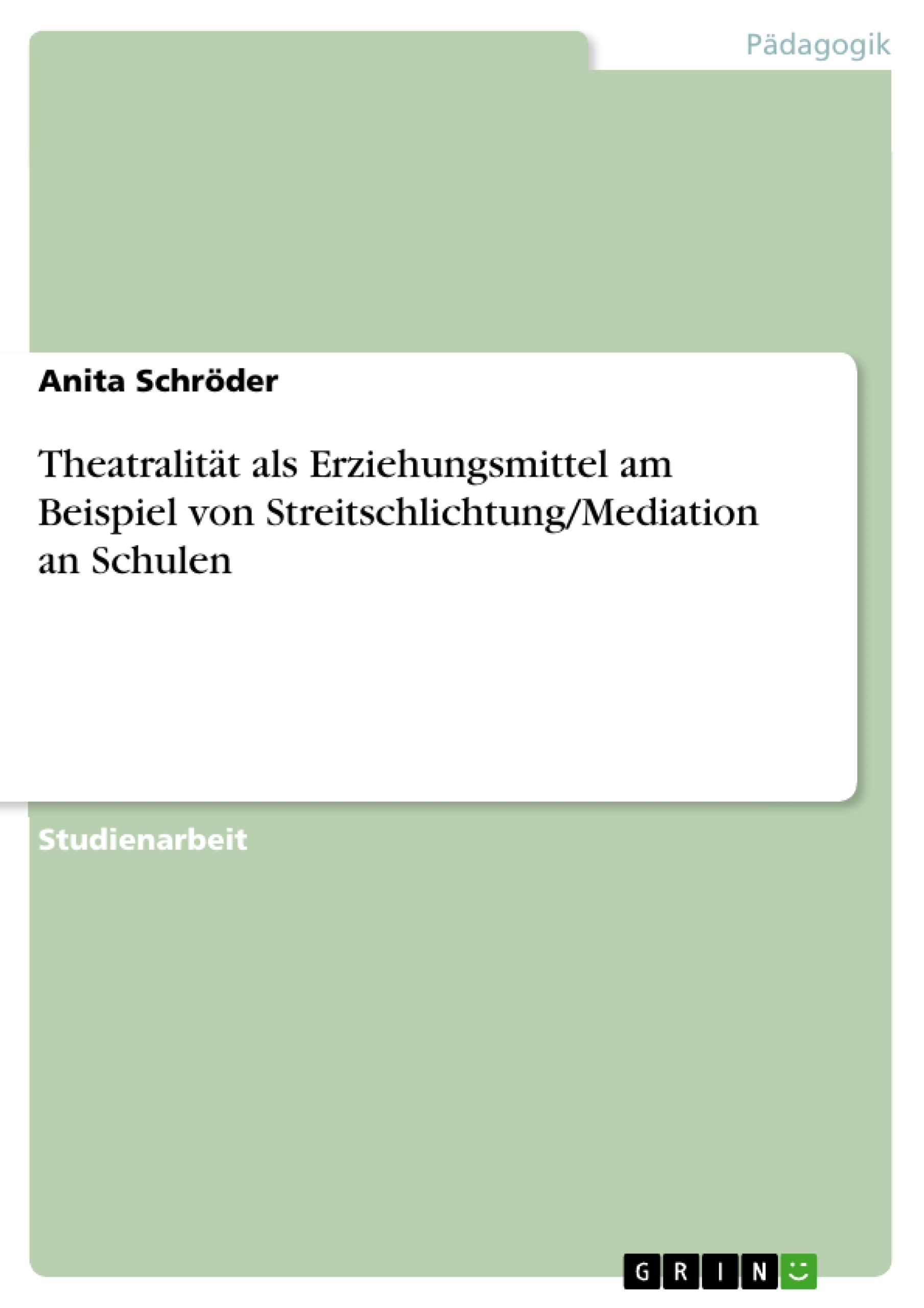Überall kommt Theater bzw. Theatralität zum Einsatz. Schon Erving Goffman sagte 1959 „Wir alle spielen Theater“. Wir wollen uns vor anderen in irgendeiner Weise darstellen und versuchen eine möglichst der Rolle angemessene Performance abzugeben mit einer bestimmten Intention. Kinder zum Beispiel versuchen, Erwachsene mit Vater-Mutter-Kind-Spielen zu imitieren oder mit Weinen um den Finger zu wickeln. Warum soll dann nicht ebenso darauf mit Theatralität als Erzie-hungsmittel geantwortet werden, wie zum Beispiel bei der Konfliktbewältigung? In der Schule gibt es häufig Konflikte, die sogar in Gewalt münden können. Die Streitschlichtung/Mediation dient hierbei als eine Anleitungsmöglichkeit zur Performance einer Konfliktbewältigung, die gleichzeitig gewaltpräventiv wirken kann.
Diese wissenschaftlich begründete Hausarbeit soll nun den Zusammenhang zwischen Theatralität und Streitschlichtung/Mediation genauer darstellen.
Um das weitläufige Thema einzugrenzen, wird dabei nur auf den Begriff der Theatralität nach Erika Fischer-Lichte eingegangen.
Es wird unter anderem die Problemstellung behandelt, inwiefern Theatralität bei der Streitschlichtung/Mediation an Schulen zum Ausdruck kommt und diese überhaupt sinnvoll ist. Ziel ist es, die (Aus-)Wirkung der Theatralität bei der Streitschlichtung an Schulen herauszufinden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Hinführung zum Thema
- 1.2 Problemstellung und Untersuchungsziele der Arbeit
- 1.3 Vorgehensweise
- 2 Begriffliche und theoretische Grundlagen
- 2.1 Definition von Theatralität nach Erika Fischer-Lichte
- 2.2 Definition von Streitschlichtung/Mediation
- 2.2.1 Zustandekommen einer Streitschlichtung/Mediation
- 2.2.2 Rolle und Aufgaben von Streitschlichtern
- 2.2.3 Ablauf einer Streitschlichtung/Mediation
- 3 Inwiefern wirkt Theatralität bei der Streitschlichtung/Mediation?
- 3.1 Performance
- 3.2 Inszenierung
- 3.3 Korporalität
- 3.4 Wahrnehmung
- 4 Ist diese Art der Konfliktbewältigung sinnvoll?
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Theatralität im Sinne von Erika Fischer-Lichte und Streitschlichtung/Mediation an Schulen. Das Hauptziel ist die Analyse der Auswirkung von Theatralität auf die Streitschlichtung und die Bewertung ihrer Sinnhaftigkeit als Erziehungsmittel.
- Definition und Anwendung des Theatralitätsbegriffs nach Erika Fischer-Lichte
- Prozess und Methoden der Streitschlichtung/Mediation an Schulen
- Die Rolle der Performance, Inszenierung, Korporalität und Wahrnehmung in der Mediation
- Bewertung der Effektivität von Streitschlichtung als Konfliktbewältigungsmethode
- Gewaltprävention durch Theatralität in der Konfliktlösung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Theatralität als Erziehungsmittel im Kontext von Streitschlichtung an Schulen ein. Sie stellt die Problemstellung dar, nämlich den Zusammenhang zwischen Theatralität und Mediation zu untersuchen, und definiert die Untersuchungsziele. Die Vorgehensweise der Arbeit, beginnend mit begrifflichen Grundlagen und gefolgt von einer Analyse der Wirkung von Theatralität in der Mediation, wird skizziert. Die Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Arbeit, indem sie den Forschungsfokus und den methodischen Ansatz klar definiert.
2 Begriffliche und theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die begrifflichen Grundlagen für die gesamte Arbeit. Es definiert den Begriff der Theatralität nach Erika Fischer-Lichte, unterteilt in Performance, Inszenierung, Korporalität und Wahrnehmung. Parallel dazu wird der Begriff der Streitschlichtung/Mediation präzise definiert, inklusive der Grundsätze und Techniken. Die Kapitel liefert somit das notwendige theoretische Rüstzeug für die spätere Analyse des Zusammenhangs zwischen Theatralität und Mediation.
3 Inwiefern wirkt Theatralität bei der Streitschlichtung/Mediation?: Dieses Kapitel analysiert die Wirkung von Theatralität auf den Prozess der Streitschlichtung. Es untersucht, wie die von Fischer-Lichte definierten Aspekte der Theatralität (Performance, Inszenierung, Korporalität und Wahrnehmung) in der Mediation zum Tragen kommen. Die Analyse beleuchtet, wie die beteiligten Akteure ihre Rollen gestalten, Strategien entwickeln und die Wahrnehmung der anderen beeinflussen. Die Kapitel untersucht, wie diese theatralen Elemente den Mediationsprozess unterstützen und gestalten.
4 Ist diese Art der Konfliktbewältigung sinnvoll?: Dieses Kapitel bewertet die Sinnhaftigkeit der Anwendung von Streitschlichtung/Mediation als Konfliktbewältigungsmethode an Schulen. Es wägt die Vor- und Nachteile dieser Methode ab und diskutiert ihre Effektivität im Vergleich zu anderen Ansätzen. Dieses Kapitel stellt die kritische Auseinandersetzung mit der untersuchten Methode dar.
Schlüsselwörter
Theatralität, Erika Fischer-Lichte, Streitschlichtung, Mediation, Konfliktbewältigung, Schule, Erziehungsmittel, Performance, Inszenierung, Korporalität, Wahrnehmung, Gewaltprävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Theatralität in der Streitschlichtung/Mediation an Schulen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Theatralität (im Sinne von Erika Fischer-Lichte) und Streitschlichtung/Mediation an Schulen. Das Hauptziel ist die Analyse der Auswirkung von Theatralität auf die Streitschlichtung und die Bewertung ihrer Sinnhaftigkeit als Erziehungsmittel.
Welche Aspekte der Theatralität werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Aspekte Performance, Inszenierung, Korporalität und Wahrnehmung der Theatralität nach Erika Fischer-Lichte im Kontext der Streitschlichtung/Mediation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den begrifflichen und theoretischen Grundlagen (Theatralität nach Fischer-Lichte und Streitschlichtung/Mediation), ein Kapitel zur Analyse der Wirkung von Theatralität in der Mediation, ein Kapitel zur Bewertung der Sinnhaftigkeit dieser Konfliktbewältigungsmethode und ein Fazit.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Definition von Theatralität nach Erika Fischer-Lichte und umfasst eine detaillierte Darstellung der Prozesse und Methoden der Streitschlichtung/Mediation an Schulen.
Welche Fragen werden im Hauptteil der Arbeit untersucht?
Der Hauptteil untersucht, inwiefern Theatralität (Performance, Inszenierung, Korporalität und Wahrnehmung) die Streitschlichtung/Mediation beeinflusst und ob diese Methode der Konfliktbewältigung sinnvoll ist.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit bewertet die Effektivität von Streitschlichtung als Konfliktbewältigungsmethode und diskutiert deren Vor- und Nachteile im Vergleich zu anderen Ansätzen. Der Fokus liegt auch auf der Gewaltprävention durch Theatralität in der Konfliktlösung. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt eine abschließende Bewertung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Theatralität, Erika Fischer-Lichte, Streitschlichtung, Mediation, Konfliktbewältigung, Schule, Erziehungsmittel, Performance, Inszenierung, Korporalität, Wahrnehmung, Gewaltprävention.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Begriffliche und theoretische Grundlagen, Inwiefern wirkt Theatralität bei der Streitschlichtung/Mediation?, Ist diese Art der Konfliktbewältigung sinnvoll?, und Fazit.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die bereitgestellte HTML-Datei enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die jeweiligen Inhalte und Forschungsfragen präzise beschreibt.
- Arbeit zitieren
- Anita Schröder (Autor:in), 2012, Theatralität als Erziehungsmittel am Beispiel von Streitschlichtung/Mediation an Schulen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201724