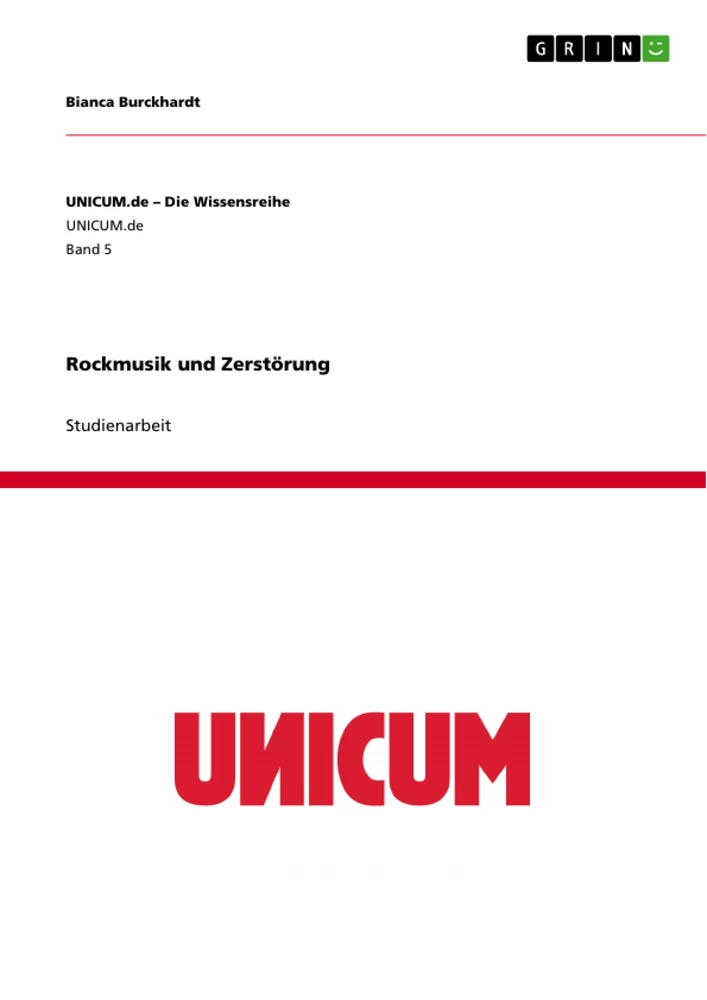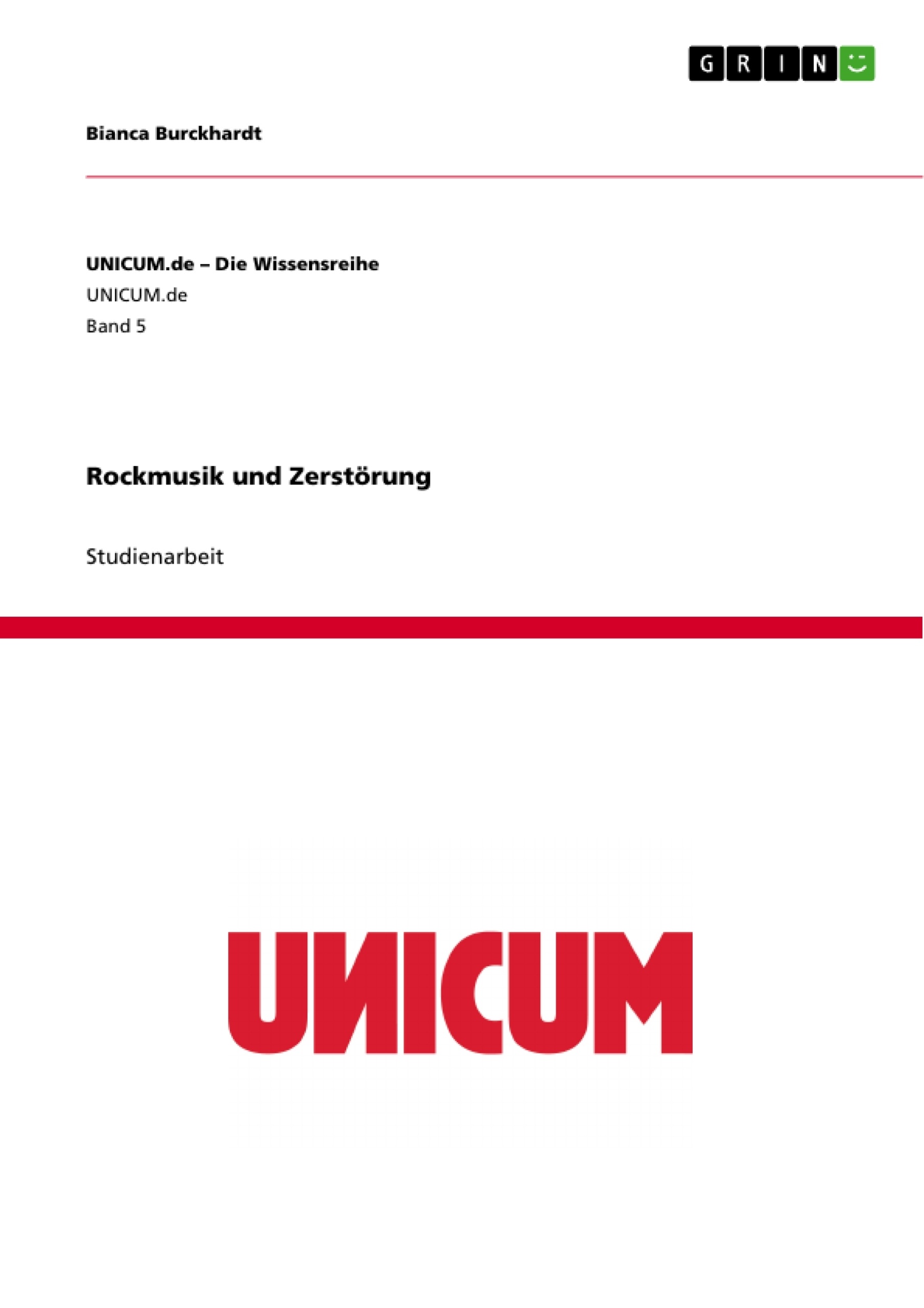Musik ist ein notwendiger Bestandteil unseres Lebens. Sie wendet sich an die ganze Persönlichkeit und entfaltet geistige, seelische und körperliche Kräfte in harmonischer Ausgewogenheit. Deshalb ist das Bedürfnis nach Musik nie so ausgeprägt gewesen wie in unserer Zeit der Spaltung von Verstand, Gefühl und Körper.1 Wie verhält es sich aber mit dem Erfolg der Rockmusik, die entgegen unseres Harmoniestrebens eher zerstörerische Elemente in sich vereint?
Diese Arbeit will einen globalen Überblick geben über verschiedene Ebenen der Zerstörung in der Rockmusik. Angefangen mit dem kulturtheoretischen Ansatz Pierre Bourdieus soll die Entstehung und Entwicklung der Rockmusik im gesellschaftlichen Kontext näher beleuchtet werden. Anschließend wird der musikpsychologischen Wirkung von Rockmusik nachgegangen und die Frage geklärt, wie „zerstörerisch“ die charakteristische Spielweise (z.B. Rhythmus und Lautstärke) auf unseren Körper wirken kann. Abschließend wird anhand der sozialpsychologischen Theorie des französischen Theoretikers Henri Laborit der Frage nach Gewalt als Inszenierung und der Selbstzerstörung der Musiker nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Entstehung und Entwicklung (vgl. Pierre Bourdieu: Les Règles de l’Art)
2.1 Rockmusik als Gesellschaftskritik
2.2 Rockmusik als Generationenkonflikt
3. Wirkungsweisen von Rockmusik
3.1 Hörstress
3.2 Ekstase
4. Zerstörung und Selbstzerstörung (vgl. Henri Laborit: Éloge de la fuite)
4.1 Zerstörung als Element der Inszenierung
4.1.1 Gewalt in Songtexten
4.1.2 Der Antiheld als Vorbild
4.2 Selbstzerstörung als Flucht
4.2.1 Kreativität
4.2.2 Drogenmissbrauch
4.2.3 Depression und Suizid
5. Fazit
6. Bibliographie
Häufig gestellte Fragen
Warum enthält Rockmusik oft zerstörerische Elemente?
Die Arbeit untersucht Rockmusik als Ausdruck von Gesellschaftskritik, Generationenkonflikten und als Ventil für Aggressionen, die im Kontrast zum allgemeinen Harmoniestreben stehen.
Welche körperlichen Auswirkungen hat Rockmusik (Hörstress)?
Hohe Lautstärken und repetitive Rhythmen können zu physischem Stress führen, aber auch Zustände von Ekstase und emotionaler Befreiung auslösen.
Was bedeutet "Selbstzerstörung als Flucht" bei Musikern?
Unter Rückgriff auf Henri Laborit wird analysiert, wie Drogenmissbrauch, Depressionen und Suizidversuche oft eine Fluchtreaktion auf den Leistungsdruck und die Inszenierung im Musikbusiness sind.
Wie wird Gewalt in Songtexten und auf der Bühne inszeniert?
Zerstörung (z. B. von Instrumenten) und gewaltvolle Texte dienen oft als bewusstes Element der Inszenierung des "Antihelden", um Rebellion und Authentizität zu vermitteln.
Welchen kulturtheoretischen Ansatz verfolgt die Arbeit?
Es wird Pierre Bourdieus Ansatz aus "Les Règles de l'Art" genutzt, um die Entstehung der Rockmusik im sozialen Raum und ihre Abgrenzungsfunktion zu erklären.
- Quote paper
- Bianca Burckhardt (Author), 2010, Rockmusik und Zerstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202020