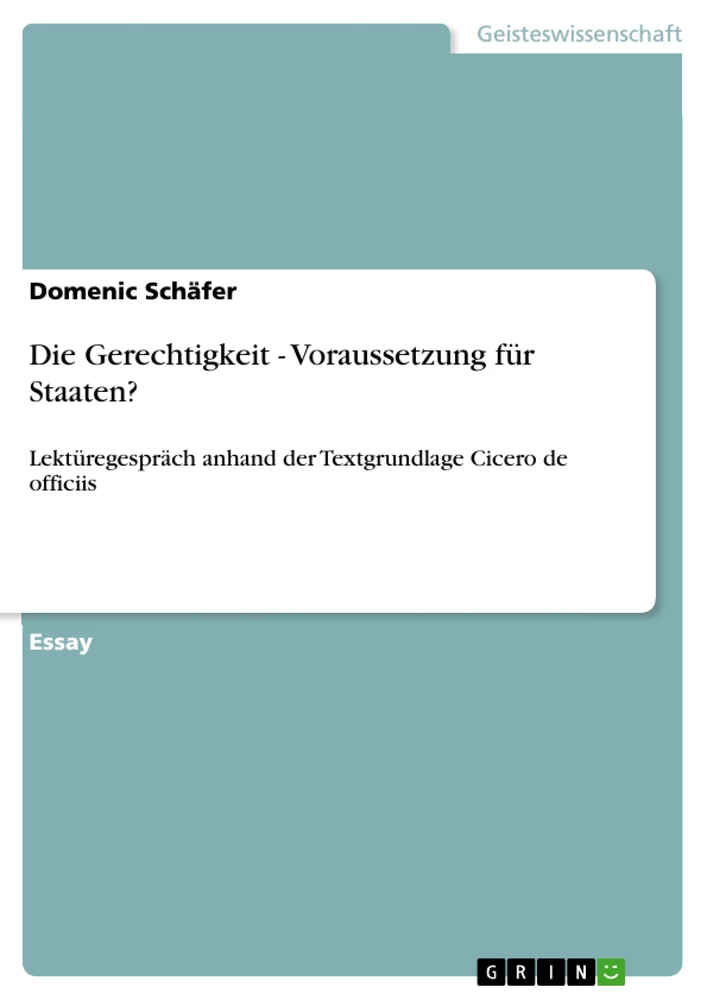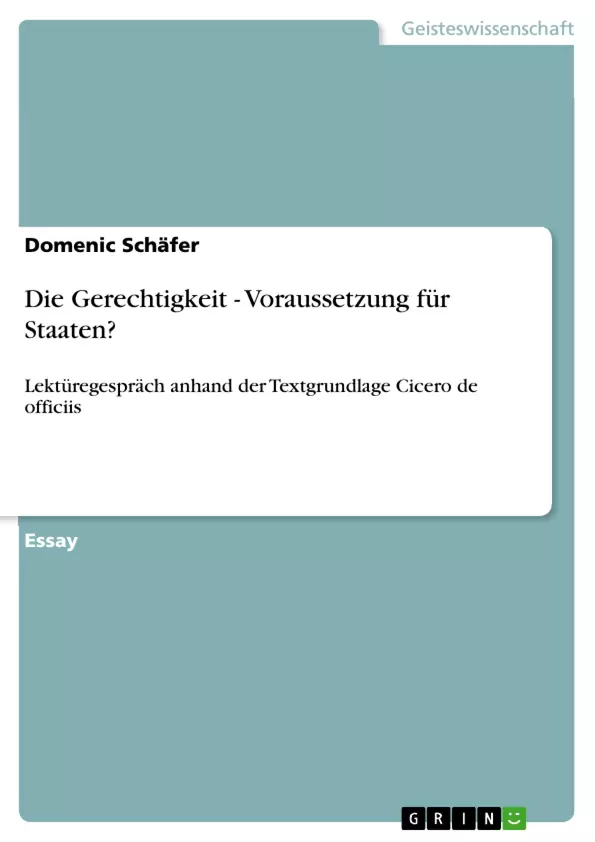Dieser Essay geht von der These aus, dass Gerechtigkeit eine fundamentale Voraussetzung für die Existenz von Staaten ist. Eingehend ist eine ausführliche Definition und Erläuterung zum Begriff Gerechtigkeit eingebaut.
Gliederung
1. Einleitung
2. Vorüberlegungen
2.1 Was ist Gerechtigkeit?
2.2 Was macht einen Staat aus?
3. Der gerechte Herrscher
3.1 Die Auswahl des Herrschers
3.2 Das wahre Wesen des Herrschers
3.3 Übertragbarkeit auf nicht-monarchische Staatsformen
4. Recht und Gesetz
5. Das Vertrauen
5.1 fides und Gerechtigkeit
5.2 Vertrauen als Grundlage eines Staates
6. Schlusswort
7. Anhang
1. Einleitung
„Was sind also Reiche, wenn ihnen Gerechtigkeit fehlt, anderes als große Räuberbanden?“[1] fragt Augustinus rhetorisch. Und selbst eine Räuberbande muss gewissermaßen auf Gerechtigkeit fußen, denn…
„Jener aber, den man Räuberanführer nennt, wird wohl entweder von seinen Kameraden getötet oder verlassen werden, wenn er die Beute nicht gerecht aufteilt. Ja es scheint sogar Räubergesetze zu geben, denen sie gehorchen, nach denen sie sich richten.“[2]
Gerechtigkeit ist folglich eine eklatante Grundlage jeder erdenklichen Art von Staaten, ohne die Staaten schlichtweg keinen festen Bestand haben können. Ebendiese These steht im vorliegenden Essay im Zentrum des Interesses. Zunächst ist eine grundsätzliche Begriffsbestimmung darüber, was man unter Gerechtigkeit versteht[3] und was einen Staat zum Staat macht, in jeglicher Hinsicht unabdingbar. Anschließend sollen dann verschiedene Aspekte beleuchtet werden, die Gerechtigkeit zu einer condicio sine qua non für reibungsfrei funktionierende Staaten machen. Ciceros Abhandlung de officiis wird dazu als Textgrundlage für diesen Essay fungieren. Sämtliche Zitate sind selbst übersetzt.
2. Vorüberlegungen
Wer eine Definition für einen Begriff aufstellt, begibt sich in die Gefahr, dadurch diesen Begriff zu simplifizieren und nicht seine gesamte Tragweite zu erfassen. Gerade bei Abstracta wie dem Gerechtigkeitsbegriff ist diese Problematik besonders präsent.[4] Doch über ebendiesen Begriff „Gerechtigkeit“ lässt sich nur dann sinnvoll disputieren, wenn bereits eine klare Vorstellung in Hinblick auf dessen Begrifflichkeiten vorhanden ist. Demnach wird zunächst das Bedeutungsspektrum des Begriffs „Gerechtigkeit“ in einer Definition umrissen.
2.1 Was ist Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit ist eine Evidenz. Dies bedeutet, dass sich jeder Mensch eo ipso etwas unter diesem Begriff vorzustellen vermag. Sie ist die Tugend schlechthin des sozialen Zusammenlebens. Gleichzeitig ist es schwer, ihre einzelnen Ausprägungen und Facetten[5] auf einen Nenner zu bringen. Die einschlägigste und ursprüngliche Begriffsbestimmung stammt vom Dichter Simonides, den sein Doxograph Platon in der Politeia zitiert: „jedem das Seine“.[6] Cicero greift in seiner Schrift de officiis diese Formulierung auf, als er im ersten Buch die vier Kardinaltugenden einführt. Dabei wird die iustitia wie folgt umschrieben:
„…oder es [ergänze: das Ehrenhafte] besteht darin, Gemeinschaften der Menschen zu schützen, jedem das Seine zuzuteilen und in der Verlässlichkeit von Abmachungen.“[7]
Diese Definition „Gerechtigkeit heißt suum cuique tribuere“ wirft rigorose Anschlussfragen auf: Was ist für jeden das Seine? Warum steht überhaupt irgendjemandem irgendetwas zu?[8] Diese Fragen stellte sich offenbar bereits Cicero und beantwortete sie folgendermaßen:
„Es gibt aber von Natur aus keinerlei Privatbesitz, sondern entweder aufgrund alter Aneignung […] oder eines Sieges oder eines Gesetztes, Vertrags, Übereinkommens, Losentscheids.“[9]
Pragmatisch rät Cicero dazu, bereits vorhandene Besitzverhältnisse zu akzeptieren. Doch zurück zur Gerechtigkeit an sich! Nun seien vier Thesen unkommentiert in den Raum gestellt: Gerechtigkeit basiert einerseits auf einen Gleichheitsgedanken,[10] (1) andererseits auf gegenseitigem Vertrauen (2). Sie ist eine Tugend, die gewissermaßen alle anderen Tugenden bedingt.[11] (3) Und sie steht in einem nicht näher spezifizierten Verhältnis zum Recht.[12] (4)
Und was ist Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit lässt sich ex negativo bestimmen: Ungerechtigkeit ist eben nicht suum cuique tribuere. Ungerechtigkeit bedeutet Willkür und Ungleichheit somit schlichthin das Fehlen von Gerechtigkeit. So nennt Cicero zwei Arten[13] : das iniuriam inferre (iniuria commissiva) eine Passivität, die darauf fußt, sich nicht aktiv für Gerechtigkeit gegenüber seinem Mitmenschen einzusetzen. (iniuria omissiva)[14]
2.2 Was macht einen Staat aus?
In Anschluss an diese Darlegung über den Begriff „Gerechtigkeit“ müssen wir kurz klären, was eigentlich einen Staat auszeichnet. Auch hier gilt der Grundsatz Qualität vor Quantität. Ein Staat lässt sich nach zwei wesentlichen Kriterien bestimmen. Erstens wird er durch ein Staatsgebiet abgegrenzt. Und für zweitens lassen wir Cicero selbst zu Wort kommen:
[...]
[1] Augustinus, de civitate Dei, Kap. IV, 4. Lateinisch: „ Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?”
[2] Cicero, de officiis, II, 40. Lateinisch: „ ille autem, qui archipirata dicitur, nisi aequabiliter praedam dispertiat, aut interficiatur a sociis aut relinquatur. Quin etiam leges latronum esse dicuntur quibus pareant, quas observent.”
[3] In diesem Rahmen lässt sich hier allerdings kein Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
[4] Vgl. Theodor Schramm, Recht und Gerechtigkeit. Zwei Aspekte und Dimensionen im Verhältnis zwischen Bürger und Staat, München 1985, S.11.
[5] Vgl. Elisabeth Holzleithner, Gerechtigkeit, Wien 2009, S.12-15.
[6] Vgl. Platon, Politeia, IV, 433a.
[7] Vgl. Cicero, de officiis, I, 15. Lateinisch: „[honestum…] aut in hominum societate tuenda tribundoque suum cuique et rerum contractarum fide […versatur].”
[8] Vgl. Josef Pieper, Über die Gerechtigkeit, München 1960, S.17.
[9] Vgl. Cicero, de officiis, I, 21. Lateinisch: „Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, […] aut victoria, […], aut lege pactione condicione sorte.”
[10] Aristoteles spricht von arithmetischer Gerechtigkeit. Vgl. Schramm, Recht und Gerechtigkeit, S.26.
[11] Vgl. Schramm, Recht und Gerechtigkeit, S.25.
[12] Vgl. Holzleithner, Gerechtigkeit, S.87-98.
[13] Vgl. Cicero, de officiis, I, 23-29.
[14] FIORI benennt diese zwei Arten der Ungerechtigkeit als iniuria commissiva & omissiva. Vgl. Roberto Fiori, Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone, Napoli 2011, S.222.
- Citation du texte
- Domenic Schäfer (Auteur), 2012, Die Gerechtigkeit - Voraussetzung für Staaten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202714