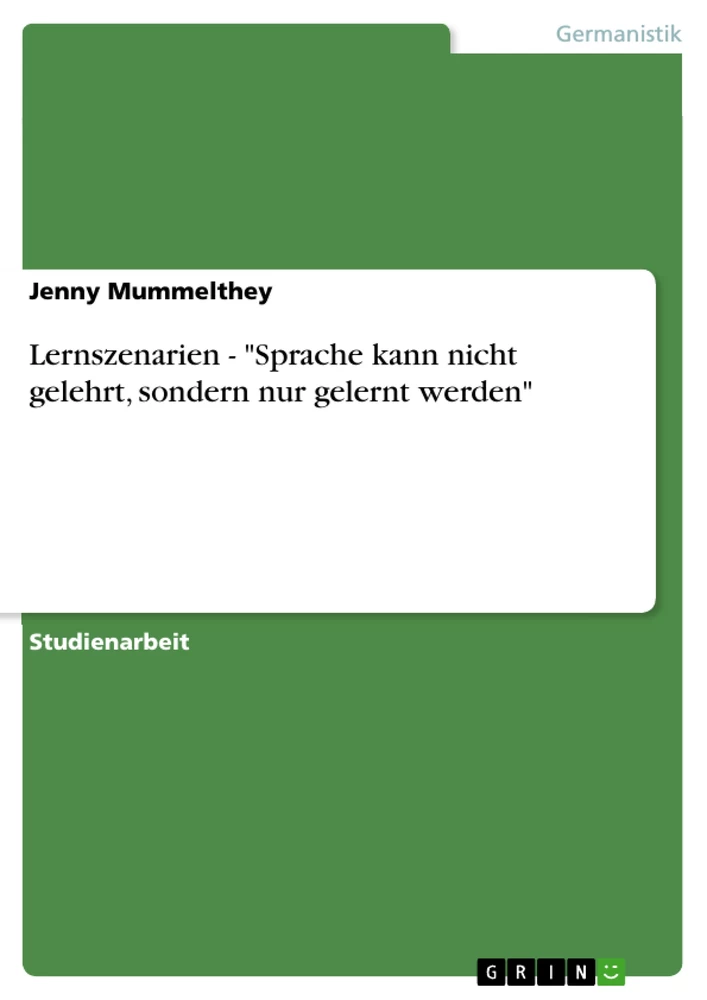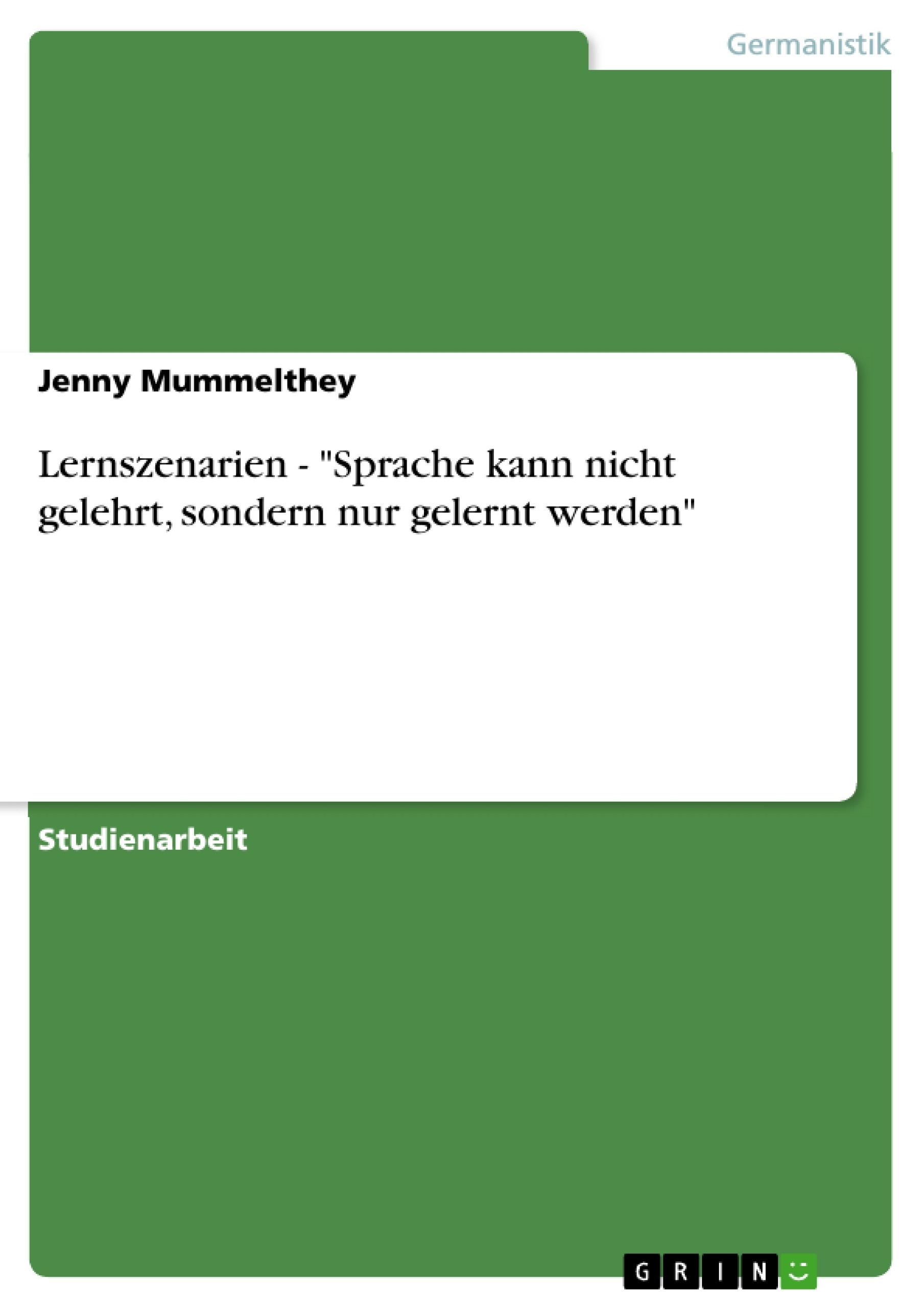Seit 2002 gibt es in Bayern den Lehrplan für das Fach „Deutsch als Zweitsprach“ für alle Schulformen und –arten. Von vielen anderen Bundesländern wurde dieser Rahmenlehrplan aufgrund seiner Effektivität und Umsetzbarkeit bereits übernommen.
Um dem Lehrplan, dem Konzept und dem Fach „Deutsch als Zweitsprache“ gerecht zu werden, um Schülerinnen und Schüler, die Deutsch lernen, optimal fördern zu können, bedarf es einen handlungsorientierten, offenen und lebensnahen Unterricht zu gestalten.
„Die wesentlichen Kriterien des Lehrplans, vor allem die Schüleraktivitäten, die durch Sprachhandeln zum Sprachwachstum führen, sind folgerichtig nur schwer mit Lehrbüchern (…) zu realisieren.“ (Hölscher, Piepho, Roche, 2006, S.20)
Sprache lernen bedeutet nach diesem neuen Konzept nicht mehr lehrgangs- und buchgebunden, linear und starr eine Sprache zu verinnerlichen, sondern mit allen Sinnen, offen, durch das Einbringen von Vorerfahrungen, situationsgemäß und kindgerecht, Sprache zu entdecken, zu erforschen und wahrzunehmen. Einen Weg, Kindern, die Deutsch als Zweitsprache lernen, diese „Entdeckungs-, Forschungsreise“ zur deutschen Sprache zu ermöglichen, sind „Lernszenarien“. „Sprache wird hier nicht mehr linear und formal „durchgenommen“, sondern als inszeniertes Sprachwachstum entwickelt.“ (ebd., S.20)
Die folgende Hausarbeit wird daher das didaktische Konzept der „Lernszenarien“ genauer darstellen und beleuchten. Zunächst werden theoretische Grundlagen und Hintergründe dargelegt. In diesem Zusammenhang wird unter Anderem geklärt, was „Lernszenarien“ eigentlich sind, welches didaktische Konzept hinter diesen steht, wie sie aufgebaut sind und welche Rolle die Lehrkraft spielt. Im Anschluss an die theoretischen Erklärungen werden Materialien zur praktischen Anwendung vorgestellt. In diesem Kontext werden auch Beispiele für mögliche, thematische Auseinandersetzungen vorgestellt.
Gliederung
1. Was sind Lernszenarien?
2. Das Konzept der Lernszenariendidaktik
3. Der Ablauf/ die Phasen eines Lernszenarios
4. Die Rolle der Lehrkraft
5. Die praktische Umsetzung von Lernszenarien
5.1 Materialien zum Thema Lernszenarien in der Grundschule
5.2 Praxis Beispiel: Leitfaden für die Arbeit mit Lernszenarien in Deutsch als Zweitsprache
Einleitung
Seit 2002 gibt es in Bayern den Lehrplan für das Fach „Deutsch als Zweitsprach“ für alle Schulformen und –arten. Von vielen anderen Bundesländern wurde dieser Rahmenlehrplan aufgrund seiner Effektivität und Umsetzbarkeit bereits übernommen.
Um dem Lehrplan, dem Konzept und dem Fach „Deutsch als Zweitsprache“ gerecht zu werden, um Schülerinnen und Schüler, die Deutsch lernen, optimal fördern zu können, bedarf es einen handlungsorientierten, offenen und lebensnahen Unterricht zu gestalten.
„Die wesentlichen Kriterien des Lehrplans, vor allem die Schüleraktivitäten, die durch Sprachhandeln zum Sprachwachstum führen, sind folgerichtig nur schwer mit Lehrbüchern (…) zu realisieren.“ (Hölscher, Piepho, Roche, 2006, S.20)
Sprache lernen bedeutet nach diesem neuen Konzept nicht mehr lehrgangs- und buchgebunden, linear und starr eine Sprache zu verinnerlichen, sondern mit allen Sinnen, offen, durch das Einbringen von Vorerfahrungen, situationsgemäß und kindgerecht, Sprache zu entdecken, zu erforschen und wahrzunehmen. Einen Weg, Kindern, die Deutsch als Zweitsprache lernen, diese „Entdeckungs-, Forschungsreise“ zur deutschen Sprache zu ermöglichen, sind „Lernszenarien“. „Sprache wird hier nicht mehr linear und formal „durchgenommen“, sondern als inszeniertes Sprachwachstum entwickelt.“ (ebd., S.20)
Die folgende Hausarbeit wird daher das didaktische Konzept der „Lernszenarien“ genauer darstellen und beleuchten. Zunächst werden theoretische Grundlagen und Hintergründe dargelegt. In diesem Zusammenhang wird unter Anderem geklärt, was „Lernszenarien“ eigentlich sind, welches didaktische Konzept hinter diesen steht, wie sie aufgebaut sind und welche Rolle die Lehrkraft spielt. Im Anschluss an die theoretischen Erklärungen werden Materialien zur praktischen Anwendung vorgestellt. In diesem Kontext werden auch Beispiele für mögliche, thematische Auseinandersetzungen vorgestellt.
1. Was sind Lernszenarien?
„Ein Lernszenario ist eine offene, [handlungsorientierte] Lernmethode (im Rahmen des sog. Selbstorganisierten Lernens), die aus dem Projektunterricht hervorgegangen ist und Überschneidungen mit dem Lernen an Stationen hat. (…) Schwerpunkt des Lernszenarios ist das Bereitstellen möglichst vielfältiger Handlungssituationen (unterschiedliches Material, Problemlöseaufgaben, vielfältige Handlungs- und Sozialformen), die sich für eine Präsentation der Ergebnisse in der Gesamtgruppe eignen.“ (Bildungsserver. Berlin-Brandenburg)
Lernszenarien wurden ursprünglich für den Einsatz im Englischunterricht (Fremdsprachenunterricht) konzipiert. Sie sind aber auch in jedem anderen Schulfach einsetzbar. „Von allergrößtem Gewinn aber ist die Szenariendidaktik für den Unterricht in Deutsch als Zweit- und Fremdsprache.“ (Hölscher, 2005, S.4) Lernszenarien sind demnach effektiv im Unterricht für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache einsetzbar. „Lernszenarien verbinden muttersprachlichen Deutschunterricht mit dem Sprachwachstum in der Zweitsprache Deutsch und verknüpfen die Inhalte der Lehrpläne für Deutsch und Deutsch als Zweitsprache.“ (Hölscher, Piepho, Roche, 2006, S.9)Lernszenarien stellen dabei ein sehr flexibles Unterrichtmodell dar, welches den individuellen Auf- und Ausbau des Wortschatzes und des Sprachkönnens der Kinder in den Vordergrund stellt. Das alter- und entwicklungsgerechte, sowie das seinem Sprachstand entsprechend angepasste Lernen des Schülers sind zentrale Punkte dieser Didaktik. (Vgl. ebd. S.19) Durch Lernszenarien zu lernen, bedeutet Sprache ganzheitlich wahrzunehmen und aufzufassen. Es ist ein Ansatz, der den Sinn, „ (…), Inhalte und sprachliches Handeln in den Mittelpunkt stellt und Grammatik und Lautung als Hilf-, Struktur- und Ausdruckmittel in die handlungsbezogenen Aspekte der Kommunikation integriert.“ (ebd., S.19)
2. Das Konzept der Lernszenariendidaktik
„Während die individuelle Förderung jedes einzelnen [Schülers] mit herkömmlichen Methoden [, Lehr- und Lernformen] von einer Lehrkraft allein kaum zu leisten ist, stimuliert die Szenariendidaktik individuelles Sprachwachstum ohne aufwendige Vorbereitung der Lehrkraft.“ (Hölscher, S.2)
Lernszenarien berücksichtigen und integrieren die heterogenen Vorrausetzungen und Bedingungen, die in jeder Klasse vorherrschend sind. „(…) [Heterogenität] ist definiert durch
stark individuell ausgeprägte Persönlichkeiten mit je eigenem Weltwissen, durch unterschiedliche
sprachliche Niveaus und Fähigkeiten und durch individuelle Lernvoraussetzungen, also
Lernerfahrungen, Lerngewohnheiten und Lernmotivation. Ein immens bedeutsamer Faktor ist
darüber hinaus die Qualität des Zugangs zu Sprache und Literatur in Familie und sprachlicher
Umgebung.“ (Hölscher, 2010, S. 4) Diese stark vorherrschende Heterogenität wird innerhalb der Szenariendidaktik bedacht und effektiv umgesetzt. Das individuelle, angepasste sprachliche Lernen und Fördern des Kindes/ der Kinder bildet einen zentralen Punkt dieses Unterrichtsmodells.
Damit greift das Lernen durch Szenarien auch das Problem der Unter- bzw. Überforderung der Schüler auf, welches im „normalen“ Unterricht meist unvermeidbar ist. „In der Regel führt die Über- oder Unterforderung dazu, dass Schüler „aussteigen“, sich nicht aktiv am Unterricht beteiligen – die Motivation schwindet, der Lernzuwachs stagniert.“ (Hölscher, 2005, S.4)
Beim Lernen durch Lernszenarien dagegen werden die Kinder sprachlich dort abgeholt, wo sie stehen. Dabei berücksichtigt dieses Unterrichtsmodell die individuellen, sprachlichen Kompetenzen, individuelle Interessen, Neigungen und Fähigkeiten und die eigenen Möglichkeiten, die ein Kind hat, um sein sprachliches Wissen aufzubauen und zu erweitern und motiviert es in seinem eigenen Sprachlernprozess. (Vgl. Hölscher, S.2)
Das Kind wird durch Lernszenarien dazu angeregt, motiviert und ermutigt, selbstständig, offen und handlungsorientiert zu arbeiten, Sprache zu erforschen, zu entdecken und zu erproben, sich als eine Art „Sprachdetektiv“ aktiv zu beteiligen und ganz beiläufig seine sprachlichen Kompetenzen zu entwickeln. (Vgl. Hölscher, S.3) „Das einzelne Kind wird [so] als Persönlichkeit ernst genommen in dem, was es sagt und tut.“ (Hölscher, 2010, S.4)
Innerhalb der Lernszenarien wird vor allem auch dem ungesteuerten, vielfältigen Sprachkontakt, der sprachlichen Anwendung, viel Wert beigemessen. Dabei sollen insbesondere der Aufbau des Wortschatzes der Kinder gefördert werden. Die Erweiterung des individuellen Wortschatzes bildet einen zentralen Mittelpunkt der Szenariendidaktik. Der Aufbau eines umfassenden Vokabulariums ermöglicht einen Zuwachs an Sprache und an weiteren, sprachlichen Kompetenzen. Das „Sprachwachstum“ und der „Sprachzuwachs“ stehen in diesem Unterrichtsmodells vorne an und sind zentrale Kernelemente /-begriffe. (Vgl. Hölscher, 2005, S.5)
Petra Hölscher, Hans-Eberhard Piepho und Jörg Roche, die sich intensiv mit der Lernszenariendidaktik auseinandersetzen und diese stetig entwickeln, gehen von der These aus: „Gebt den Schülern Wortschatz, die Grammatik finden sie von allein!“ (Hölscher, Piepho, Roche,2006, S.14) Durch diese These wird deutlich, welchen Stellenwert der Wortschatz beim Erlernen einer Sprache, nach der Didaktik der Lernszenarien, hat. „In den Lernszenarien erfolgt die Erweiterung des Wortschatzes – ähnlich wie im direkten Worterwerb eines muttersprachlichen Kindes – über die Präsenz eines Objekts, das benannt wird. Die räumliche Nähe, die Anschaulichkeit
– das Begreifen – ist ausschlaggebend für den Erwerb der Wortbedeutung. Zur Wortbedeutung wird so ein Konzept ausgebildet, das die Merkmale und Verwendungszusammenhänge beinhaltet. Das Konzeptwissen wiederum ermöglicht den indirekten Worterwerb über die Vorstellung zu bereits bekannten Wortbedeutungen. So kann ein neues Konzept im Vorstellungsraum ausgebildet werden. Genau das wird in den Lernszenarien ermöglicht.“ (ebd., S.15)
So wie die Kinder durch Lernszenarien ihren Wortschatz effektiv erweitern können, können auch die Lesekompetenz und das Textverstehen nachhaltig geübt und ausgebaut werden. Durch das individuelle, vielfältige Bearbeiten von ausgewählten schriftlichen und mündlichen Texten, lernen die Sprachschüler, Informationen zu verarbeiten, sie zu ordnen, zu bearbeiten und sie sprachlich nutzbar aufzubereiten. (Vgl. ebd. S.15) Die Anwendung von Sprache, in der Umsetzung von Lernszenarien, verfolgt immer einen realen, kommunikativen Zweck. „In Lernszenarien erlernen Kinder, neues Wissen auszudrücken und auf ihren jeweiligen Niveau zu versprachlichen.“ (Hölscher, 2005, S.5)
Durch den Einsatz verschiedener Methoden, Medien- und Arbeitsformen ist jedes Kind in der Lage sprachlichen Zuwachs zu erreichen und Sprache entsprechend anzuwenden. Lernszenarien berücksichtigen damit auch verschiedene Lerntypen. Jedem Kind wird so die Möglichkeit gegeben Sprache aktiv und passiv zu Verarbeiten. (Vgl. ebd., S.5) „Die Möglichkeit zur Mitgestaltung des Szenarios fördert zu dem das Bewusstwerden über Lernprozesse und den jeweils eigenen Lernzuwachs.“ (Hölscher, 2005, S.5)
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was sind Lernszenarien im Unterricht?
Lernszenarien sind offene, handlungsorientierte Lernmethoden, bei denen Sprache durch vielfältige Situationen und Materialien ganzheitlich entdeckt und erforscht wird.
Warum sind Lernszenarien besonders für „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) geeignet?
Sie ermöglichen ein individuelles „Sprachwachstum“ ohne Über- oder Unterforderung, da jedes Kind auf seinem eigenen Niveau sprachlich handeln kann.
Welche Rolle nimmt die Lehrkraft in einem Lernszenario ein?
Die Lehrkraft fungiert weniger als Dozent, sondern als Begleiter und Arrangeur von Lernsituationen, die zum selbstständigen Sprachhandeln anregen.
Warum steht der Wortschatz im Zentrum der Szenariendidaktik?
Nach der These „Gebt den Schülern Wortschatz, die Grammatik finden sie von allein“ wird Wortschatz als Schlüssel zum Sprachverständnis und zur Kommunikation gesehen.
Wie werden Lernszenarien in der Grundschule praktisch umgesetzt?
Die Arbeit bietet Leitfäden und Materialien, die zeigen, wie Themen lebensnah inszeniert werden können, um Lesekompetenz und Textverstehen nachhaltig zu fördern.
- Citar trabajo
- Jenny Mummelthey (Autor), 2012, Lernszenarien - "Sprache kann nicht gelehrt, sondern nur gelernt werden", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203003