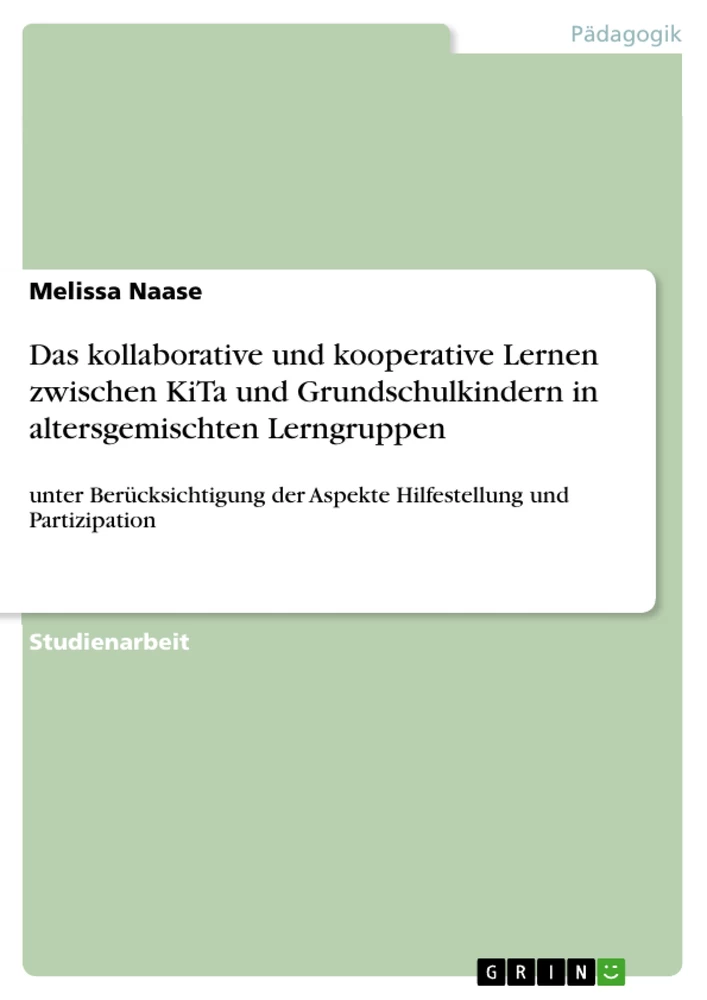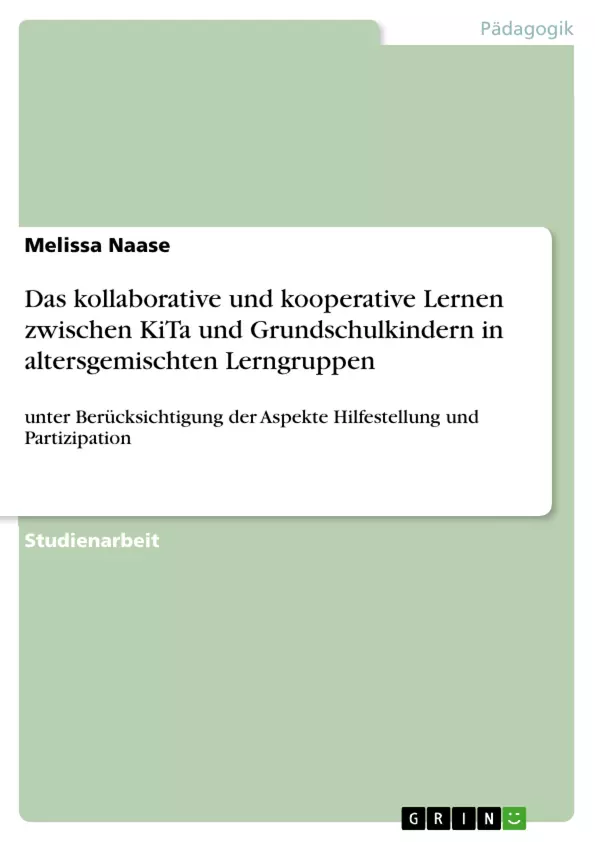In dieser Arbeit soll anhand einer Videosequenz zu einer Gruppenarbeit eine systematische, qualitative Beobachtung durchgeführt werden. Bei der Beobachtung werde ich einen Fokus die Oberthemen Hilfestellung und Partizipation legen und alle Handlungen in ein entsprechenes Beobachtungsraster einfügen, welches sich aus den Beobachtungen ergibt. Uns interessiert auh, ob Unterschiede bei diesen beiden Oberkategorien in Bezug auf das Alter der Kinder festzustellen sind.
So ist insgesamt das Ziel dieser Beobachtung herauszufinden, wie sich das kollaborative und kooperative Lernen zwischen KiTa und Grundschulkindern in altersgemischten Lerngruppen unter Berücksichtigung der Aspekte Hilfestellung und Partizipation gestaltet, um daraus Anregungen für entsprechende Bildungsangebote abzuleiten.
Dazu werde ich zunächst die Begriffe Hilfestellung und Partizipation definieren, sowie die theoretische Basis, die dieser Beobachtung zugrunde liegt erläutern. Da das beobachtete Video eine Szene des kooperativen Lernens zeigt gehe ich genau auf die theoretische Basis kooperativen Lernens ein: einmal auf den sozio-kulturellen Ansatz von Wygotski und auch auf die sozio-kognitven Ansätze von Piaget und Youniss.
Anschließend werde ich dann die gewählte Beobachtungsmethode der nicht-teilhabenden qualitativen Beobachtung darstellen und zu anderen Methoden abgrenzen und das Beobachtungstranskript aufführen, bevor die bereits im Seminar vorgestellten Beobachtungskategorien vorgestellt werden. Diese sind nicht deduktiv erstellt worden, sondern haben sich aus dem Material und den Gesprächen innerhalb der Arbeitsgruppe ergeben.
Anschließend folgt eine Auswertung und Interpretation der Ergebnisse, bevor im letzten Kapitel „Pädagogische Konsequenzen“ entsprechende Anregungen für mögliche Bildungsangebote in Hinblick auf die Fragestellung abgeleitet werden.
Festlegung des theoretischen Begriffsrahmens
Klärung zentraler theoretischer Begriffe
An dieser Stelle möchte ich zunächste die Begriffe kollaboratives und kooperatives Lernen sowie die Begriffe Hilfestellung und Partizipation definieren, welche dieser gesamten Arbeit zugrunde liegen.
Viele deutschsprachige Autoren verwenden die Begriffe kollaboratives und kooperatives Lernen synonym, und bezeichnen dieses Lernen als Gruppenlernen oder kooperatives Lernen, wohingegen in englischsprachigen Veröffentlichungen ein klarer Unterschied gezogen wird....
Inhaltsverzeichnis
- 1. Entwicklung einer präzisen Fragestellung
- 2. Festlegung des theoretischen Begriffsrahmens
- a. Klärung zentraler theoretischer Begriffe
- b. Weitere theoretische Grundlagen
- 3. Festlegung und Begründung der Methodenwahl
- a. Durchführung:
- 1. BEGRÜNDETE AUSWAHL DER BEOBACHTUNGSMETHODE ENTSPRECHEND DER FRAGESTELLUNG
- 11. DOKUMENTATION DER BEOBACHTUNG (PROTOKOLL)
- 111. BESCHREIBUNG DES KONTEXTES: LERNGRUPPE/LERNAUFGABE
- b. Auswertung:
- 1. ENTWICKLUNG EINES AUSWERTUNGSDESIGNS
- Hilfestellung
- Partizipation
- a. Durchführung:
- 4. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse
- 5. Pädagogische Konsequenzen
- a. Zusammenfassung
- b. Reflexion
- 6. Literaturverzeichnis
- 7. Selbstständigkeitserklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert eine Videosequenz einer Gruppenarbeit in einer altersgemischten Lerngruppe, um das kollaborative und kooperative Lernen zwischen KiTa- und Grundschulkindern unter Berücksichtigung der Aspekte Hilfestellung und Partizipation zu untersuchen. Ziel ist es, aus den Beobachtungen Anregungen für entsprechende Bildungsangebote abzuleiten.
- Kooperatives und kollaboratives Lernen in altersgemischten Lerngruppen
- Hilfestellung und Partizipation in Gruppenarbeitsprozessen
- Rollenverständnis und Interaktion zwischen Kindern unterschiedlichen Alters
- Pädagogische Konsequenzen für die Gestaltung von Bildungsangeboten
- Individuelle Förderung und selbstständiges Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Fragestellung der Arbeit vor, die sich auf die Untersuchung von Hilfestellung und Partizipation in einer Videosequenz einer Gruppenarbeit in einer altersgemischten Lerngruppe konzentriert. Kapitel 2 definiert die zentralen theoretischen Begriffe der Arbeit, wie kollaboratives und kooperatives Lernen, Hilfestellung und Partizipation, und erläutert die theoretischen Grundlagen der Beobachtung, die sich auf den sozio-kulturellen Ansatz von Wygotski sowie die sozio-kognitven Ansätze von Piaget und Youniss stützen. Kapitel 3 beschreibt die gewählte Beobachtungsmethode der nicht-teilnehmenden qualitativen Beobachtung und die strukturierende Inhaltsanalyse, die zur Auswertung des Videomaterials genutzt wird. Kapitel 4 stellt die Ergebnisse der Beobachtung dar und interpretiert diese im Kontext der theoretischen Grundlagen. Kapitel 5 leitet pädagogische Konsequenzen aus den Beobachtungen ab, beleuchtet die Bedeutung von altersgemischten Lerngruppen für die kognitive Entwicklung und die Förderung von Selbstständigkeit und Teamfähigkeit. Der Abschnitt enthält auch eine Reflexion über den Prozess der Gruppenarbeitsphase und die Seminarveranstaltung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen kollaboratives und kooperatives Lernen, altersgemischte Lerngruppen, Hilfestellung, Partizipation, sozio-kultureller Ansatz, sozio-kognitiver Ansatz, Wygotski, Piaget, Youniss, Pädagogische Konsequenzen, individuelle Förderung, selbstständiges Lernen, offener Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Beobachtung von KiTa- und Grundschulkindern?
Ziel ist es herauszufinden, wie sich das gemeinsame Lernen in altersgemischten Gruppen gestaltet, insbesondere in Bezug auf gegenseitige Hilfestellung und Partizipation.
Welche theoretischen Ansätze liegen der Arbeit zugrunde?
Die Arbeit stützt sich auf den sozio-kulturellen Ansatz von Wygotski sowie die sozio-kognitiven Ansätze von Piaget und Youniss.
Wie unterscheiden sich kollaboratives und kooperatives Lernen?
Während sie im Deutschen oft synonym verwendet werden, zieht die Arbeit (basierend auf englischsprachiger Literatur) feine Unterschiede in der Art der Zusammenarbeit.
Welche Beobachtungsmethode wurde gewählt?
Es wurde eine nicht-teilnehmende qualitative Beobachtung einer Videosequenz mit einem strukturierten Beobachtungsraster durchgeführt.
Welche pädagogischen Konsequenzen ergeben sich aus der Studie?
Die Ergebnisse liefern Anregungen für Bildungsangebote, die die kognitive Entwicklung und Teamfähigkeit in altersgemischten Gruppen fördern.
- Quote paper
- Melissa Naase (Author), 2012, Das kollaborative und kooperative Lernen zwischen KiTa und Grundschulkindern in altersgemischten Lerngruppen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203180