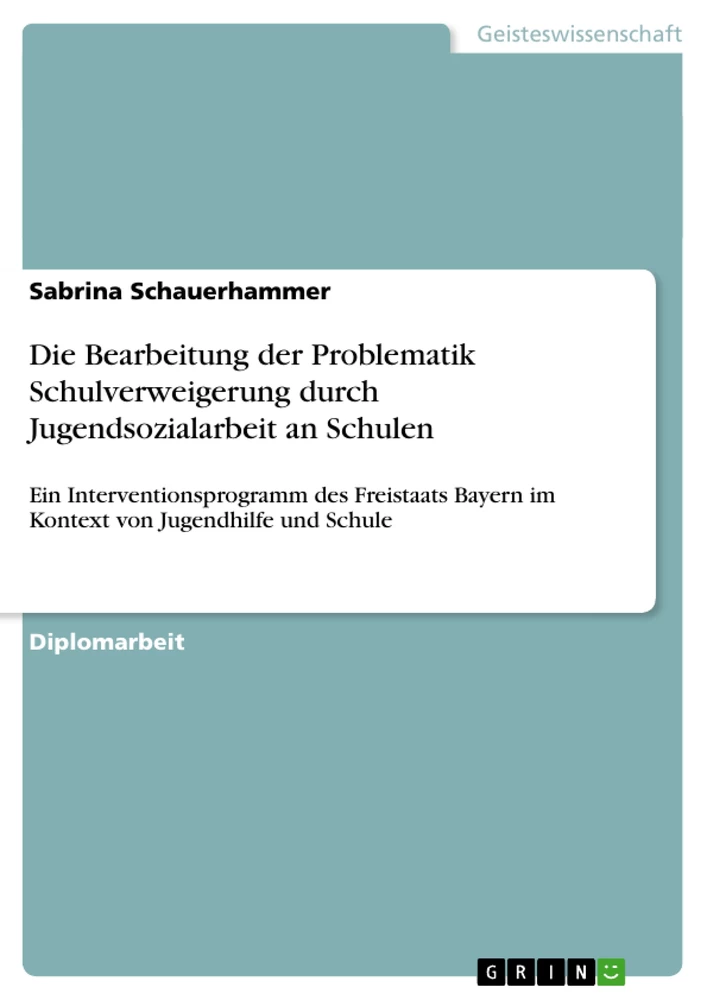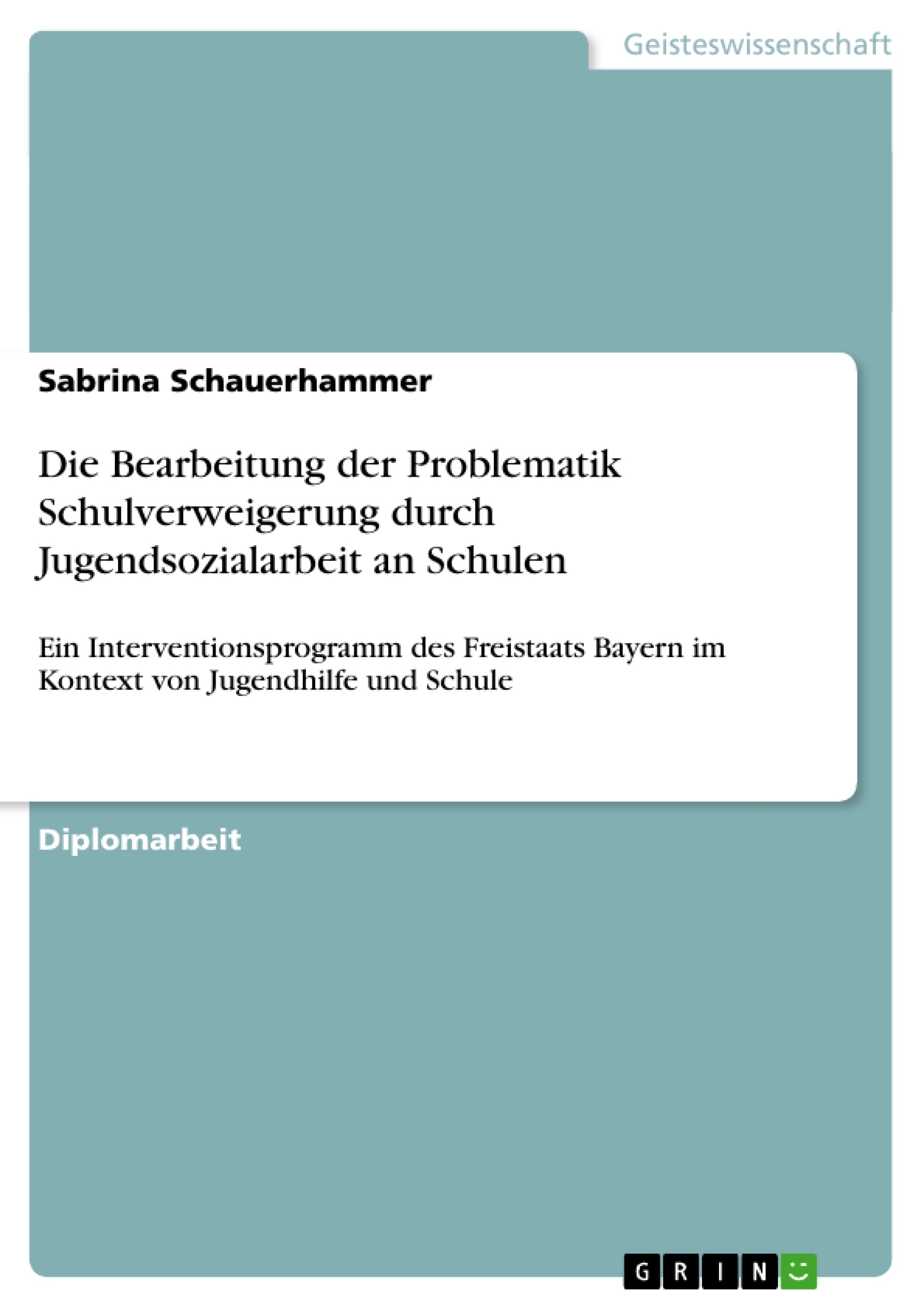Trotz Schulpflicht bleiben Kinder und Jugendliche der Schule fern. Schulverweigerung, ein Phänomen das wahrlich nicht neu ist, wird zu einer Alltagserscheinung, dessen Ausnahmecharakter immer mehr verblasst. Alarmierende Meldungen über die steigende Zahl an Kindern und Jugendlichen, die ohne einen Schulabschluss die Schulen verlassen, verunsichern und irritieren nicht nur Vertreter der Bildungspolitik. In den letzten Jahren ist das Thema Schulverweigerung auch in das Blickfeld von Wissenschaftlern und Praxisexperten, der Schule, der Jugendhilfe, sowie deren Organisationen geraten. Die Forderung nach möglichen Erklärungen und Interventionsmöglichkeiten zur Abschaffung von schulverweigernden Verhaltensweisen werden immer lauter (vgl. Schreiber-Kittl 2001, S. 5).
Aktuell geführte Debatten zum Thema Schulverweigerung finden auch immer häufiger den Weg in die Medien und erregen damit eine stetig wachsende, öffentliche Aufmerksamkeit. Dabei sind die Konsequenzen mangelnder oder gar fehlender Qualifizierung, als auch ausdauernder Schulabwesenheit nicht nur für die betroffenen Schüler/innen selber gravierend (vgl. Schreiber-Kittl 2000, S. 8; ebd. 2001, S. 5)
Laut Maria Schreiber-Kittl, die im Auftrag des Deutschen Jugendinstituts an der Problematik forscht, ist Schulverweigerung „zu einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung geworden.“ (Schreiber-Kittl 2000, S. 8).
Allerdings ist es der Erziehungswissenschaft in Deutschland in den vergangen Jahrzehnten nicht gelungen, den Problembereich theoretisch in ausreichendem Maße zu klären und den im Problemfeld Schulabsentismus und Schulverweigerung tätigen Praktikern, effiziente Maßnahmen und Strategien anzubieten. Erst in den letzten Jahren ist eine gesteigerte schulpädagogische und öffentliche Diskussion, ein Anwachsen entsprechender Fachliteratur, ein
vergrößertes Angebot an Tagungen und Weiterbildungen zum Themenkomplex Schulverweigerung, sowie zahlreiche Erlässe und Empfehlungen der Kultusministerien mitzuerleben. Das alles sind Indikatoren dafür, dass das Phänomen des Schulabsentismus, speziell das der Schulverweigerung, auch in Deutschland aufgegriffen, bearbeitet und aktualisiert wird (vgl. Ricking 2003, S. 19f.).
Trotz gestiegener Aufmerksamkeit und einem gewachsenem Interesse der Gesellschaft, der Medien und der Forschung, ist die Problematik Schulverweigerung noch längst nicht völlig durchdrungen und ausgereizt. Karlheinz Thimm, ein Experte auf dem Gebiet des Schulabsentismus, äußert sich..
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
1 Einleitung
2 Annäherung an den Untersuchungsgegenstand Schulverweigerung
2.1 Schulpflicht und Schulzwang in Deutschland
2.2 Schulpflicht nach dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
2.3 Maßnahmen zur Durchführung der Schulpflicht
3 Schulverweigerung - Begriffsbestimmung
3.1 Begriffsvielfalt - Definitionsversuch
3.2 Begriffskategorisierung
4 Gesellschaftliches Problem Schulverweigerung – Ursachen, Ausprägungen und Konsequenzen
4.1 Ausprägung des Phänomens
4.1.1 Altersverteilung
4.1.2 Geschlechterverteilung
4.1.3 Risikogruppen
4.1.4 Schultyp/Schulformen
4.1.5 Ausmaß und Reichweite
4.2 Ursachen und Anreize für Schulverweigerung
4.2.1 Mögliche, schulinterne Faktoren
4.2.2 Mögliche, schulexterne Faktoren
4.3 Entwicklungsrisiken und Konsequenzen
5 Schulsozialarbeit – Kooperation von Jugendhilfe und Schule „unter einem Dach“
5.1 Begriffsklärung Schulsozialarbeit
5.1.1 Begriffsverständigung
5.1.2 Begriffsdefinition
5.2 Kooperation von Jugendhilfe und Schule
5.2.1 Begriffsbestimmung der Kooperationspartner
5.2.2 Prinzipien der Kooperation und Datenschutzbestimmungen
5.2.3 Allgemeine und strukturelle Besonderheiten und Gegensätze der beiden Systeme
5.2.4 Voraussetzungen einer gelingenden Kooperation
6 Jugendsozialarbeit an Schulen „JaS“ – in Bayern
6.1 Begriffsbestimmung und Profil
6.1.1 Definition und Abgrenzung
6.1.2 Zielgruppen und Zielformulierung
6.1.3 Pädagogische Arbeitsweisen
6.1.4 Qualitätsaspekte
6.2 „JaS“ – in Kooperation mit Schulen in Bayern
6.2.1 Rechtliche Grundlagen
6.2.2 Förderprogramm und Kooperationsvereinbarung
7 Pädagogische Handlungsoptionen – Kooperation von „JaS“ und Schule im Problemfeld Schulverweigerung
7.1 Pädagogische Handlungsoptionen
7.1.1 Präventive Maßnahmen
7.1.2 Intervenierende Maßnahmen
7.1.3 Sozialarbeiterische Hilfsmaßnahmen
7.2 Kooperation von „JaS“ und Schule bei Schulverweigerung
7.2.1 Chancen und Möglichkeiten
7.2.2 Hemnisse, Risiken und Grenzen
8 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
URL – Verzeichnis
Erklärung
Danksagung
An erster Stelle möchte ich meiner Familie für die tatkräftige Unterstützung und Motivation danken.
Des Weiteren möchte ich auch meinem Freund Steven danken, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand und immer ein offenes Ohr für mich hatte.
Nachdrücklich danken möchte ich Herrn Geiling, der mich bereitwillig und geduldig durch den gesamten Zeitraum geführt hat und mir, besonders am Anfang, viele wertvolle Anregungen für die vorliegende Arbeit gab.
1 Einleitung
Trotz Schulpflicht bleiben Kinder und Jugendliche der Schule fern. Schulverweigerung, ein Phänomen das wahrlich nicht neu ist, wird zu einer Alltagserscheinung, dessen Ausnahmecharakter immer mehr verblasst. Alarmierende Meldungen über die steigende Zahl an Kindern und Jugendlichen, die ohne einen Schulabschluss die Schulen verlassen, verunsichern und irritieren nicht nur Vertreter der Bildungspolitik. In den letzten Jahren ist das Thema Schulverweigerung auch in das Blickfeld von Wissenschaftlern und Praxisexperten, der Schule, der Jugendhilfe, sowie deren Organisationen geraten. Die Forderung nach möglichen Erklärungen und Interventionsmöglichkeiten zur Abschaffung von schulverweigernden Verhaltensweisen werden immer lauter (vgl. Schreiber-Kittl 2001, S. 5).
Aktuell geführte Debatten zum Thema Schulverweigerung finden auch immer häufiger den Weg in die Medien und erregen damit eine stetig wachsende, öffentliche Aufmerksamkeit. Dabei sind die Konsequenzen mangelnder oder gar fehlender Qualifizierung, als auch ausdauernder Schulabwesenheit nicht nur für die betroffenen Schüler/innen selber gravierend (vgl. Schreiber-Kittl 2000, S. 8; ebd. 2001, S. 5)
Laut Maria Schreiber-Kittl, die im Auftrag des Deutschen Jugendinstituts an der Problematik forscht, ist Schulverweigerung „zu einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung geworden.“ (Schreiber-Kittl 2000, S. 8).
Allerdings ist es der Erziehungswissenschaft in Deutschland in den vergangen Jahrzehnten nicht gelungen, den Problembereich theoretisch in ausreichendem Maße zu klären und den im Problemfeld Schulabsentismus und Schulverweigerung tätigen Praktikern, effiziente Maßnahmen und Strategien
anzubieten. Erst in den letzten Jahren ist eine gesteigerte schulpädagogische und öffentliche Diskussion, ein Anwachsen entsprechender Fachliteratur, ein
vergrößertes Angebot an Tagungen und Weiterbildungen zum Themenkomplex Schulverweigerung, sowie zahlreiche Erlässe und Empfehlungen der Kultusministerien mitzuerleben. Das alles sind Indikatoren dafür, dass das Phänomen des Schulabsentismus, speziell das der Schulverweigerung, auch in Deutschland aufgegriffen, bearbeitet und aktualisiert wird (vgl. Ricking 2003, S. 19f.).
Trotz gestiegener Aufmerksamkeit und einem gewachsenem Interesse der Gesellschaft, der Medien und der Forschung, ist die Problematik Schulverweigerung noch längst nicht völlig durchdrungen und ausgereizt. Karlheinz Thimm, ein Experte auf dem Gebiet des Schulabsentismus, äußert sich diesbezüglich wie folgt: „Schulverweigerung im erweiterten Sinne kann als ein empirisch schwach erforschtes und theoretisch undurchdrungenes Phänomen gelten.“ (Thimm 2000, S. 23).
Das Interesse an der Problematik Schulverweigerung und die Motivation, diese Thematik im Rahmen meiner Diplomarbeit aufzugreifen, beruhen auf persönlichem Interesse und auf Erfahrungen mit schulverweigernden Klassenkameraden. Während eines sechs-wöchigen Praktikums im Arbeitsfeld von Straßensozialarbeit und Schulsozialarbeit kam mehrmals Kontakt mit schulverweigernden Kindern und Jugendlichen zustande, der mich zum Nachdenken über das Phänomen Schulverweigerung anregte.
Es stellte sich heraus, dass oft ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster Faktoren dafür verantwortlich ist, wenn Schüler/innen sich der Schule entziehen wollen, ihr fernbleiben oder sich ganz verweigern. Diese Auffassung teilt auch Heinrich Ricking, der festhält: „Schulabsentismus (…)
zeigt sich unter wissenschaftlicher Perspektive als komplexes Phänomen mit vielfältigen Einflussfaktoren auf sozialer, familiärer, schulischer und individueller Ebene. Zwar stellt es sich in seiner Symptomatik relativ ähnlich dar, basiert aber als Entwicklungsergebnis auf ganz unterschiedlichen Problemkonstellationen zwischen Schüler- und Umfeldvariablen.“ (Ricking o. J., S. 1).
Die vorliegende Arbeit betrachtet das Phänomen Schulverweigerung genauer, deckt mögliche Ursachen und Hintergründe von schulverweigerndem Verhalten auf und entfaltet pädagogische Handlungsoptionen. Das Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit wird näher beleuchtet und am Beispiel der Jugendsozialarbeit an Schulen in Bayern erläutert. Auch eine eingehende Begutachtung der Kooperationsbeziehung von Jugendhilfe und Schule erfolgt. Wie sich die Zusammenarbeit konkret gestalten lässt, wird anhand der Kooperationsarbeit von JaS und Schule ganz allgemein untersucht und im Anschluss daran speziell für den Problembereich Schulverweigerung offengelegt.
Die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit lauten:
1. Welche Ursachen, Ausprägungen und Konsequenzen sind möglich, wenn Kinder und Jugendliche trotz Schulpflicht nicht mehr in die Schule gehen und sich ihr verweigern?
2. Was muss und kann Schulsozialarbeit, aufgezeigt am Beispiel von Jugendsozialarbeit an Schulen in Bayern – kurz JaS genannt – leisten, um Schulverweigerung angemessen zu begegnen und entgegen zu wirken?
3. Welche Grundlagen sind essenziell für eine gelingende Kooperation von Jugendhilfe und Schule im Problemfeld Schulverweigerung und wo liegen Chancen und Grenzen dieser Zusammenarbeit?
Den Forschungsfragen ist der thematische Aufbau, als auch die optische Gliederung dieser Arbeit zu entnehmen. Sie geben einen ersten Einblick in die ausgewählte Problematik.
Kapitel 1 leitet die Arbeit thematisch ein.
In Kapitel 2 folgt eine Vorstellung der allgemeinen Schulpflicht und des Schulzwangs in Deutschland. Nachdem die Historie der Bundesrepublik und die allgemeinen Regelungen, die in den Schulgesetzen und Schulpflichtparagraphen der einzelnen Bundesländer schriftlich festgehalten sind, dargelegt wurden, soll das Schulgesetz des Freistaats Bayern in den Mittelpunkt rücken und eingehender erläutert werden. Mit der Vorstellung von Maßnahmen zur Durchsetzung der allgemeinen Schulpflicht in Deutschland endet dieser Abschnitt.
Kapitel 3 führt verschiedene Begriffsbestimmungen von Schulverweigerung auf. Neben der gebräuchlichen Verwendung des Schulschwänzens, finden sich in Forschungs- und Fachlektüren noch zahlreiche andere Bezeichnungen wie Schulabsentismus, Schulmüdigkeit, Schulverdrossenheit oder eben auch Schulverweigerung. Einige der verschiedenen Begriffe werden ausführlicher erklärt und ihre Unterschiede, die sich auf Schwankungen in den Bedeutungsinhalten zurückführen lassen, dargestellt. Vor dem Hintergrund der Vielfalt an Bezeichnungen, wird in dieser Arbeit versucht, den Begriff Schulverweigerung in allen seinen Facetten zu erfassen und in Abgrenzung, als auch in Anlehnung an andere Begrifflichkeiten zu definieren. Den Abschluss des Kapitels bildet eine mögliche Steigerungsform des Phänomens Schulverweigerung, dargelegt anhand der Kategorisierung von Karlheinz Thimm.
In Kapitel 4 rückt die eigentliche Problematik Schulverweigerung vollends ins Zentrum der Betrachtung. Neben der Erläuterung von Faktoren, die als Ursachen für schulverweigerndes und schulabsentes Verhalten von Kindern und Jugendlichen identifiziert werden können, sollen die unterschiedlichen Ausprägungen des Phänomens, mit Blick auf die Determinanten Alter, Geschlecht, Risikogruppe und Schulform, ausführlich erklärt werden. Das Kapitel endet mit der Vorstellung von Konsequenzen und möglichen Entwicklungsrisiken von Schulverweigerung.
Kapitel 5 betrachtet das Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit und die Kooperation von Jugendhilfe und Schule, die sich als Grundlage dieses Arbeitsbereiches ausmachen lässt. Die Klärung des Begriffs Schulsozialarbeit erfolgt über eine Begriffsverständigung und eine Begriffsdefinition. Zudem wird geklärt, welche Voraussetzungen und Bedingungen notwendig sind, damit trotz Besonderheiten und Gegensätzen der beiden Professionen Jugendhilfe und Schule, eine Kooperation in Theorie und Praxis gelingen kann.
Wie Schulsozialarbeit im Konkreten aussehen kann, wird in Kapitel 6 anhand von Jugendsozialarbeit an Schulen in Bayern aufgezeigt. Einer kurzen Begriffsdefinition von JaS folgt eine ausführliche Profildarstellung, die im Einzelnen auf Ziele und Zielgruppen, pädagogische Arbeitsweisen, als auch auf Qualitätsaspekte eingeht. Den Abschluss bildet die nähere Untersuchung der Kooperation von Schule und Jugendsozialarbeit an Schulen im Hinblick auf die Rechtsgrundlage, die bestehende Kooperationsvereinbarung und das aufgestellte Förderprogramm.
In Kapitel 7 werden alle bisher vorgestellten Gliederungspunkte zusammengeführt und die konkrete Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule im Problemfeld Schulverweigerung am Beispiel von JaS aufgezeigt. Angesichts möglicher, pädagogischer Handlungsoptionen wird dargelegt, wie
auf Schulverweigerung angemessen reagiert werden kann. Dazu werden präventive und intervenierende Maßnahmen, sowie mögliche sozialarbeiterische Hilfsmaßnahmen vorgestellt. Abschließend erfolgt eine Analyse der Chancen und Möglichkeiten, sowie der Hemmnisse, Risiken und Grenzen der Kooperationsarbeit von JaS und Schule im Problemfeld Schulverweigerung.
Kapitel 8 bildet ein abschließendes Fazit mit Ausblick.
Aus Gründen der Lesbarkeit werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit nur die männlichen Formen wie beispielsweise Schüler oder Lehrer verwendet. Auch wenn nicht explizit angesprochen, sind damit immer jeweils beide Geschlechter gemeint. Liegen geschlechtsspezifische Ergebnisse oder Unterschiede vor, sind diese an den entsprechenden Stellen ersichtlich gekennzeichnet.
2 Annäherung an den Untersuchungsgegenstand Schulverweigerung
Im folgenden Kapitel werden die Schulpflicht und der Schulzwang in Deutschland eingehender analysiert. Anhand der Historie und allgemeiner schulischer Regelungen der Bundesrepublik, soll die Bedeutung und Stellung der Schulpflicht erläutert werden. Daran anknüpfend steht die Schulpflicht des Freistaats Bayern im Fokus der Betrachtung.
Den gesetzlichen Regelungen kommt eine entscheidende Bedeutung zu, „(…) da es ohne die bestehende Schulpflicht auch keine Schulverweigerung geben würde.“ (Ricking 2006, S. 12).
Nachdem die Schulgesetze erläutert wurden, werden die aktuellen pädagogischen, staatlichen und disziplinarischen Maßnahmen vorgestellt, die Schulverweigerer beim Verstoß gegen die gesetzliche Schulpflicht erwarten.
2.1 Schulpflicht und Schulzwang in Deutschland
In der Bundesrepublik Deutschland untersteht das gesamte Schulwesen nach Artikel 7 des Grundgesetzes der Aufsicht des Staates (vgl. Grundgesetz 2011, Art. 7).
Dementsprechend besteht das Schulrecht „aus Gesetzen, Rechtsverordnungen, Erlässen, Verfügungen, Empfehlungen etc., durch die die Inhalte der Lehrerarbeit, Art und Häufigkeit der Beurteilung von Schülerleistungen, die Durchführung der Aufsichts- und Disziplinarfunktion u.v.m. geregelt sind.“ (Thimm 2000, S. 72).
Gemäß Thimm unterliegt das bundesdeutsche Schulrecht bis heute einer hohen Dichte an Regulierungen und einer erheblichen Affinität gegenüber Reglementierungen (vgl. ebd.).
Da die einzelnen Bundesländer Deutschlands eine Kulturhoheit innehaben, sind sie für den Bereich des Schulwesens selbst verantwortlich. Das führt dazu, dass jeweils eigene, unterschiedliche Schulgesetze erlassen werden können, die u.a. die Schulpflicht regeln (vgl. Ricking 2006, S. 17).
Trotz der Eigenverantwortlichkeit der Bundesländer weichen die selbständig aufgestellten Gesetzgebungen kaum voneinander ab. So liegt die Schulpflicht von Kindern und Jugendlichen in allen Bundesländern in der zeitlichen Spanne zwischen sechs und achtzehn Jahren. Des Weiteren herrscht Einigkeit darüber, dass die Schulpflicht zwölf Jahre nachdem sie begonnen hat, endet (vgl. Sibbe 2007, S. 5).
Eine allgemeine Schulpflicht besteht nach Artikel 145 der Weimarer Reichsverfassung in Deutschland flächendeckend seit dem Jahre 1919. Vor dieser Zeit regelten nur vereinzelt aufgestellte Gesetze die Schulpflicht. Die Schulpflichtgesetze dienten der Vermittlung von Mindestkenntnissen, notwendig für diejenigen, die über keinen häuslichen Privatunterricht verfügten und damit keinen Zugang zu den sogenannten Mindeststandards hatten. Schulzwang d.h. ein Pflichtbesuch von Schule, bestand zu dieser Zeit nicht. Dies änderte sich im Dritten Reich, wo auf die Nichteinhaltung der Schulpflicht nach dem Schulgesetz Geld- oder Haftstrafen folgten. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kamen diese Sanktionen und Sanktionsandrohungen gegenüber schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen nicht zum Einsatz. Erst im Januar 1975 wurde die Verletzung der Schulpflicht als Ordnungswidrigkeit eingestuft (vgl. Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002, S. 25).
Wenn Schüler ihrer Schulpflicht nicht nachkommen, drohen unterschiedliche Konsequenzen wie beispielsweise das zwangsweise Zuführen der Schule mit Hilfe der Polizei. Die Erziehungssorgeberechtigten, in der Regel die Eltern, haben deswegen Sorge zu tragen, dass ihr Kind/ihre Kinder die Schulpflicht einhalten. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen haben den Unterricht
regelmäßig, als auch pünktlich zu besuchen. Wird sich dieser Forderung wiedersetzt, sind administrative Zwangsmaßnahmen vorgesehen (vgl. Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002, S. 24f.).
Gemäß Neukäter und Ricking gehören zu diesen Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht, neben schriftlichen Verwarnungen und Anzeigen beim Ordnungsamt in Form von Bußgeldbescheiden, auch das zwangsweise Zuführen des Schülers zur Schule bis hin zur Androhung von Ersatzzwangshaft gegenüber den Erziehungssorgeberechtigten (vgl. Neukäter/Ricking 1997, S. 182).
Dass trotz der erlaubten Sanktionsmöglichkeiten die Erziehung zu moralischem Verhalten immer noch an erster Stelle steht, zeigt sich in einem Auszug einer Stellungnahme des Niedersächsischen Kulturministeriums. Dort heißt es: „Bevor irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, muss deshalb untersucht werden, die Hintergründe für den Nichtbesuch der Schule zu ermitteln. Pädagogische Maßnahmen haben grundsätzlich Vorrang vor Ordnungsmaßnahmen.“ (Niedersächsisches Kultusministerium 1986, S. 236f.).
Für die Diskussion von Schulzwang und Schulpflicht ist es notwendig, die beiden Begriffe differenziert zu betrachten. „Während die gesetzlich festgelegte Schulpflicht die Verpflichtung zum Schulbesuch in staatlichen, staatlich anerkannten oder staatlich genehmigten Bildungsstätten für alle Kinder und Jugendlichen meint, impliziert der Schulzwang staatliche Interventionen zur Durchsetzung der Schulpflicht im Fall dauerhafter Zuwiderhandlungen.“ (Thimm 2000, S. 73).
2.2 Schulpflicht nach dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
Im IV. Abschnitt des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) ist die Schulpflicht in den Artikeln 35-44 fest-
geschrieben (vgl. GVBl Bayern 2000, S. 414).
In Artikel 35 Absatz 1 des BayEUG ist verankert, das alle Kinder und Jugendliche, die die altersmäßigen Voraussetzungen zum Besuch einer Schule mitbringen, ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Bayern haben bzw. dort in einem Berufsausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis stehen, der Schulpflicht unterliegen (vgl. ebd.).
Die Schulpflicht in Bayern dauert im Regelfall 12 Schuljahre und ist gegliedert in eine Vollzeitschulpflicht und eine Berufsschulpflicht. Nach Artikel 37 Absatz 3 BayEUG endet die Vollzeitschulpflicht nach neun Schuljahren. Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus ist befugt, die Vollzeitschulpflicht durch das Überspringen von Jahrgangsstufen nach entsprechenden Regelungen in den Schulordnungen zu verkürzen (vgl. ebd.).
Ist die Vollzeitschulpflicht beendet oder der freiwillige Besuch einer Hauptschule nach Artikel 38 BayEUG abgeschlossen, gilt nach Artikel 39 Absatz 1 BayEUG die Schulpflicht durch den Besuch einer Berufsschule als weiter erfüllt, insofern keine andere Schule nach Artikel 36 des BayEUG aufgeführt, besucht wird (vgl. ebd.).
Berufsschulpflichtig ist laut Artikel 39 Absatz 2 des BayEUG jeder, der sich nach der Handwerksordnung oder dem Berufsbildungsgesetz in einem Ausbildungsverhältnis befindet, bis spätestens zum Ende des Schuljahres, in dem das 21. Lebensjahr beendet wird, ausgenommen Auszubildende, die eine
Hochschulzugangsberechtigung besitzen. Mit Abschluss einer staatlich anerkannten Berufsausbildung gilt auch die Berufsschulpflicht als abgeschlossen (vgl. GVBl Bayern 2000, S. 414).
2.3 Maßnahmen zur Durchführung der Schulpflicht
Schulverweigerndes Verhalten in der Form des Schulschwänzens ist grundsätzlich eine normverletzende Tat, die als sozial abweichendes Verhalten bezeichnet und generell mit negativen Sanktionen gerichtet wird. Über die Androhung und Durchsetzung von Sanktionen soll eine Reintegration von schulmüden Schülern in die Schule erreicht und wieder ein regemäßiges Schulbesuchsverhaltens herbeigeführt werden. Dabei kann die Institution Schule auf pädagogische, disziplinarische, sowie staatliche Maßnahmen zurückgreifen (vgl. Sibbe 2007, S. 7).
Die Möglichkeiten der Sanktionierung sind vielfältig. Angefangen bei der Verhängung von Bußgeldern, über den zwangsweise herbeigeführten Schulbesuch von Kindern und Jugendlichen mit Hilfe von staatlicher Gewalt, bis hin zu Freiheitsstrafen von einer Dauer bis zu sechs Monaten (vgl. Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002, S. 27f.).
Erst wenn genannte Maßnahmen nicht greifen, sind Schulen dazu angehalten, Schulschwänzen mit Geldbußen zu sanktionieren. In allen Bundesländern werden Schulpflichtverletzungen, wie das Fernbleiben der Schule, als Ordnungswidrigkeit eingestuft und können demnach auch geahndet werden. Die Größenordnungen der Geldbußen in Deutschland sind dabei jedoch von Bundesland zu Bundesland verschieden (vgl. Ehmann/Rademacker 2003, S. 63).
Nicole Steinbach vom bayerischen Kultusministerium wird in einem Onlineartikel von Beatrix Altmann vom 28.05.2009 mit dem Titel: „Eltern aufgepasst. Urlaub außerhalb der Ferien kann teuer werden.“, auf www.Bild.de zum Thema Bußgeld wie folgt zitiert: „Wir haben eine Schulpflicht in Deutschland. Grundsätzlich kann wegen Schulschwänzens ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro verhängt werden.“ (Steinbach zitiert nach Altmann 2009, Ratgeber Recht).
Wie eine mögliche Sanktionssteigerung der zuständigen Ämter als Reaktion auf das Schulschwänzen von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen aussehen kann, hat Thimm in einem Schaubild1 zusammengefasst. Aus diesem geht hervor, dass zunächst erst einmal Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen zum Einsatz kommen. Bleiben diese wirkungslos, wird in einem nächsten Schritt mit Zwangsgeld gedroht. Bei den Erziehungssorgeberechtigten, als den Empfängern des Zwangsgeldbescheides, wird das Zwangsgeld in einem weiteren Schritt dann versucht einzutreiben. Gegebenenfalls kann auch gegen die Erziehungsberechtigen, den volljährigen Jungerwachsenen oder den nur bedingt strafmündigen, noch minderjährigen Betroffenen selbst, ein Bußgeld verhängt werden. Bringt auch diese Sanktionierungsmaßnahme keinen Erfolg, so kann der junge Mensch gegebenenfalls auch polizeilich zwangsvorgeführt werden. Im nächsten Schritt wird den Erziehungssorgeberechtigen, wenn das Bußgeld nicht entrichtet wurde, mit Ersatzzwangshaft gedroht oder dem Jugendlichen „gemeinnützige Arbeit“ auferlegt. Sollte jedoch selbst diese Arbeit noch verweigert werden, bleibt dem Jugendlichen im letzten Schritt nur noch der Jugendarrest (vgl. Thimm 2000, S. 74f.).
Diese dargestellte Vorgehensweise zeigt nicht den Regelfall, sondern stellt lediglich einen Überblick dar, wie eine mögliche Sanktionssteigerung aussehen kann. Da sich Ordnungswidrigkeitsverfahren zeitlich gesehen oft hinziehen und dadurch ihren sanktionierenden Charakter bei den Betroffenen verfehlen, ist es gerade bei dem Phänomen Schulverweigerung notwendig und wichtig, so schnell wie möglich eingreifend tätig zu werden. Bestrafungen wie auferlegte Geldzahlungen oder zwangsweises Zuführen in die Schule können sich nur dann als nachhaltig und sinnvoll erweisen, wenn die Schulverweigerung des Schülers auf der Entscheidung der Erziehungssorgeberechtigen beruht. (vgl. Thimm 2000, S. 74ff.)
„Wenn der/die Schüler/in die Schule tief und entschieden bzw. affektiv besetzt ablehnt, bleibt Sanktionierung wirkungslos. Aber auch wenn Eltern (…) ein Zwangs- oder Bußgeld ohnehin nicht bezahlen können oder weil ihr Einfluss nicht ausreicht, das Kind oder die Jugendliche zum Schulbesuch anzuhalten.“ (Thimm 2000, S. 77).
3 Schulverweigerung - Begriffsbestimmung
Für die Abwesenheit von Schule werden in der Theorie und Praxis, im Alltag und in den Medien, als auch in der Fachliteratur verschiedene Bezeichnungen verwendet. So kommen neben dem Begriff der Schulverweigerung auch Begrifflichkeiten wie Schulschwänzen, Schulmüdigkeit, Schulverdrossenheit, Schulflucht, Schulangst oder Schulphobie zum Einsatz. Aufgrund der Vielfalt an Begriffen und Bezeichnungen erheben die Ausführungen im Anschluss keine Ambition auf Vollständigkeit. Es wird lediglich versucht das Phänomen Schulverweigerung in seiner Breite zu erfassen und darüber hinaus zu definieren. Zum Abschluss dieses Kapitels erfolgt eine Begriffskategorisierung von Karlheinz Thimm.
3.1 Begriffsvielfalt – Definitionsversuch
Trotz der vorherrschenden Begriffsvielfalt sind die zahlreichen, verschiedenen Definitionsbemühungen im Grundkern alle gleich. Sie begründen das Fernbleiben von Schule auf differenzierte Weise und in unterschiedlichem Ausmaß. Entscheidend dafür, welcher Begriff zur Anwendung kommt, ist die Intensität mit der der Schulbesuch verweigert und/oder abgelehnt wird (vgl. Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002, S. 34f.).
So wird ein Schüler, der gelegentlich im Unterricht fehlt, nicht sofort als Schulverweigerer deklariert. Stattdessen gelten solche gelegentlichen Verhaltensweisen es als eine Art Kavaliersdelikt, da so gut wie jedes Schulkind im Laufe seine Schulkarriere mal dem Schulunterricht fern bleibt (vgl. ebd.).
Heinrich Ricking und Karlheinz Thimm beurteilen die scheinbaren Kavaliersdelikte etwas differenzierter und äußern sich wie folgt: „Ein solches Schule meidendes Verhalten kann sich vom Fehlen einzelner Stunden und Tage bis hin zu einer längeren Abwesenheit und der totalen Abkopplung erstrecken. Die Häufigkeit und die Dauer der Nicht-Teilnahme am Unterricht kann zur Differenzierung in die Stadien gelegentlich (Stunden, Einzeltage), mittlere Häufigkeit (regelmäßig wiederkehrend) und massiv/ intensiv (sehr häufig, gewohnheitsmäßig) führen.“ (Thimm/Ricking 2004, S. 46).
Dementsprechend bezeichnet Ricking ein andauerndes, sich stetig wiederholendes Versäumnis des Schulunterrichts von Schülern, ohne hinreichende erklärende Begründung als Schulabsentismus (vgl. Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002, S. 35).
Den Begriff Schulabsentismus untergliedert er in:
- Zurückhalten,
- Schulschwänzen und
- Schulverweigerung (vgl. Sibbe 2007, S. 25).
Mit der Begrifflichkeit Zurückhalten umschreibt Ricking das Verhalten des Ausbildungspersonals oder der Erziehungssorgeberechtigen, wenn diese Schüler vom Schulbesuch zurück- bzw. abhalten. Anstatt dem Unterricht beizuwohnen, sind die Schüler mit ihren Eltern oder Auszubildenden außerhalb der Schule unterwegs oder befinden sich zu Hause. Treten Erwachsene mit solchen Verhaltensweisen in Erscheinung, so liegt bei diesen in der Regel eine starke Abneigung und/oder ein klares Desinteresse an der Einrichtung Schule vor. Schulschwänzen wiederum versteht Ricking als Eigeninitiative von Schülern, sich einem anderen, angenehmen Zeitvertreib hinzugeben, anstatt den Schulunterricht zu besuchen. Schulverweigerung definiert er schließlich als eine gefühlsmäßige, verinnerlichte Störungsform, die sich über schwerwiegende, schulische Ängste wie beispielsweise der
Angst vor Lehrkräften oder Schulversagen begründen lässt (vgl. Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002, S. 35f.).
Ein weiterer Begriff zur Beschreibung schulischer Abwesenheit zeigt sich bei Susanne Müller. Sie unterscheidet zwischen:
- Schulschwänzen,
- Schulverweigerung und
- Schulphobie (vgl. Engel 2006, S. 35).
Schulschwänzen steht diesbezüglich für eine Verhaltensweise bei der versucht wird, unangenehmem Erlebnissen und Situationen auszuweichen, ohne das die Erziehungssorgeberechtigten davon wissen oder etwas mitbekommen. Bei der Schulverweigerung sind die Eltern dagegen in der Regel involviert d.h. sie sind über die schulische Abwesenheit ihres Sohnes oder ihrer Tochter informiert und können aber an dieser Situation nichts ändern und müssen demzufolge den Zustand der Verweigerung missbilligend hinnehmen. Schulphobie indessen stellt eine Form der Schulverweigerung dar, die einer klinischen Behandlung, beispielsweise in einer psychiatrischen Einrichtung, bedarf. Diese Sonderform ist also einem anderen Arbeitsfeld, nämlich dem der Psychologie zuzuordnen (vgl. ebd.).
Maria Schreiber-Kittl und Haike Schröpfer untergliedern Schulverweigerung wie viele andere Fachautoren in folgende Formen:
- aktive und
- passive Schulverweigerung.
Schulverweigerer gelten als aktiv, wenn sie mit ihrem Verhalten in eindeutiger Art und Weise mitteilen, dass es ihnen nicht möglich ist oder sie einfach nicht gewillt sind, die Anforderungen der Institution Schule zu erfüllen. Aktive Schulverweigerer lassen nochmals in zwei Gruppen differenzieren. Auf der einen Seite die Schüler, die zwar weiterhin die schulische Einrichtung und damit den Schulunterricht besuchen, dort aber mit nicht zumutbaren Verhaltensweisen, wie Destruktivität oder Aggressivität gegenüber ihren Mitschülern und/oder dem Lehrpersonal auffallen. Auf der anderen Seite die Kinder und Jugendlichen, die mit ihrem Wegbleiben vom Schulunterricht auf sich aufmerksam machen wollen. Schulabwesenheit wird hier als Problemlösestrategie benutzt, um der Außenwelt etwas mitzuteilen (vgl. Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002, S. 39).
Zur Gruppe der passiven Schulverweigerer gehören die Schüler, die sich den geistigen, schulischen Aufgaben entziehen, indem sie zwar dem Schulunterricht körperlich beiwohnen, sich aber ansonsten aus dem Unterrichtsgeschehen ausklinken, indem sie vor sich hin träumen oder apathisch sind. Solch passives Verhalten fällt in der Regel nicht sofort als schulverweigerndes Verhalten auf. Das Lehrpersonal muss daher sehr aufmerksam sein, um auch diese unauffällige Form von Schulverweigerung überhaupt zu erkennen (vgl. ebd., S. 38).
Laut Schreiber-Kittl wird auch eine neue Art von Schulverweigerung, nämlich eine sogenannte Mischform beobachtet. Die Spezifik dieser Ausprägung führt wie bei der passiven Schulverweigerung häufig dazu, dass sie vom Lehrpersonal nicht immer sofort erkannt wird. Gemeint ist die Problematik des verspäteten Unterrichts- und Schulbesuchs. Schüler, die sonst relativ regelmäßig die Einrichtung besuchen, schaffen es nicht mehr pünktlich zum Unterrichtsbeginn in die Klasse. Anstatt sich dann trotz der Verspätung, unverzüglich in die Schulklasse zu begeben, halten sich die Schüler lieber in der Nähe des Schulgebäudes auf und besuchen erst ab der nächsten Stunde wieder den Unterricht. Von dieser Form von Schulverweigerung werden meist einzelne Lehrkräfte oder bestimmte Unterrichtsfächer tangiert (vgl. Schreiber-Kittl 2001, S. 19).
Wie Schreiber-Kittl und Schröpfer favorisiert auch Karlheinz Thimm den Begriff Schulverweigerung, Zu seiner Begriffswahl äußert er sich wie folgt: „(…) für ein Spektrum unterschiedlich motivierter und konstellierter Handlungen ein angemessener, eher noch unverbrauchter Oberbegriff mit sozialpädagogischem Praxisanschluss.“ (Thimm 2000, S. 301).
In Bezug auf Schulverweigerung unterscheidet er die vier Formen:
- aktionistische Schulverweigerung,
- vermeidende Schulverweigerung,
- Schulverdrossenheit und
- Totalausstieg (vgl. ebd., S. 164f.)
Aktionistische Schulverweigerung steht für Verhaltensweisen von Schülern bei dem das Lehrpersonal Ablehnung erfährt und Beleidigungen ertragen muss. Die Schüler stören überdurchschnittlich und systematisch den Schulunterricht und provozieren die Lehrkräfte damit exzessiv. Ihr destruktives Verhalten im Schulunterricht äußert sich in Nichterfüllung, der an sie herangetragenen Aufgaben und Anforderungen, sowie über Regelverstoße (vgl. Thimm 1998, S. 44; Thimm 2000, S. 164).
Bei der vermeidenden Schulverweigerung geben sich die Schüler, anstatt dem Unterrichtsgeschehen zu folgen, anderen Beschäftigungen hin. Diese Form der Schulverweigerung kann als eine Art Flucht aus der Schule gesehen werden. Solches Verhalten von Kindern und Jugendlichen ist nur schwer umzukehren und beruht in der Regel auf besonders prägenden und eingehenden Erfahrungen innerhalb der Familie, des Elternhauses, sowie der Schule (vgl. Thimm 1998, S. 44).
Schulverdrossenheit wiederum stellt eine Residualkategorie dar und umfasst in dieser Funktion: „Formen der inneren Emigration im Unterricht, der gezeigten Lernunlust, kalkulierte bzw. dosierte Nicht-Erfüllung von Lehrererwartungen ohne einschneidende Abkoppelungskonsequenzen im Sinne des Rollenverlustes.“ (Thimm 2000, S. 163).
Demnach fallen die Schüler den Lehrkräften mit geistiger Abwesenheit in Form von Tagträumereien oder über die mutwillige Störung Anderer auf (vgl. Thimm 1998, S. 44).
Ein klassischer Schulabbruch ist mit dem Begriff des Totalausstiegs gleichzusetzen und bedeutet, dass das Verlassen der Schule auf Gründen beruht, die von einer rationellen und nüchternen Kalkulation der momentanen Situation geprägt sind. Solche Totalaussteiger sind oft überalterte Schüler, die durch Sitzenbleiben, sich nun in Klassen befinden, deren Mitschüler nicht ihrem Alter und ihrem Entwicklungsstand entsprechen. Diese Art Schüler, die sich nach eigens aufgestellter Kosten und Nutzenabwägung gegen den Schulbesuch entscheiden, sind als Totalaussteiger zu bezeichnen (vgl. Thimm 2000, S. 165).
Viele sozialpädagogischen Angebote und Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe benutzen den Begriff Schulverweigerung bei der Formulierung ihres Arbeitsauftrages. So beispielsweise auch das Programm „Schulverweigerung – Die 2. Chance“2 (vgl. Ehmann/Rademacker 2003, S. 25).
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird der Begriff Schulverweigerung als ausgewählter Oberbegriff verwendet, da diese Bezeichnung am Geläufigsten und am Bekanntesten erscheint. Zudem stellt Schulverweigerung, egal in welcher Form oder wie definiert, ein Problem dar, dass auch dem Titel dieser Arbeit gerecht wird.
3.2 Begriffskategorisierung
Als mögliche Kategorisierung des Begriffes Schulverweigerung soll nun beispielhaft die nach Karlheinz Thimm aufgeführt werden.
Die Indikatoren „Dauer“ und „Häufigkeit“ der Nichtteilnahme von Schülern am Schulunterricht stellen die Kriterien zur Unterscheidung der einzelnen Steigerungsformen dar. Die Steigerungsformen wiederum ergeben sich aus der weiteren Differenzierung der verschiedenen Formen von Schulverweigerung3 (vgl. Thimm 2000, S. 162).
Karlheinz Thimm untergliedert seine Formen von Schulverweigerung in die Steigerungsformen:
- Gelegenheitsschwänzen,
- Regelschwänzen und
- Intensivschwänzen als Schulverweigerung (vgl. ebd., S. 162f.).
Die erste Steigerungsform, das sogenannte Gelegenheitsschwänzen, beinhaltet neben gelegentlichen Tagesschwänzen, auch das als solches betitelte Eckstundenschwänzen, das für sporadisches, eventuell auch kalkuliertes Schwänzen einzelner Schulstunden steht und von den Schülern meist bei unbeliebten Unterrichtsfächern oder auch ungeliebtem Lehrpersonal zur Anwendung kommt (vgl. ebd., S. 162).
Das Regelschwänzen wurde von Thimm nochmals untergliedert in:
- regelmäßiges Schwänzen von Fächern,
- Kurzzeitschwänzen von mehreren Tagen,
- Intervallschwänzen und
- gelegentliches Langzeitschulschwänzen (vgl. Thimm 2000, S. 162f.).
Dem regelmäßigen Schwänzen von Fächern sind die Kinder und Jugendlichen zuzuteilen, die aus Protest, Unlust, kühler Berechnung oder anderen Gründen, den Schulbesuch eines Faches oder einzelner Fächer mit mehr oder weniger Konsequenz und Systematik einstellen. Das Kurzzeitschwänzen mehrerer Tage beschreibt die Schüler, die in einer einmaligen Periode für einen begrenzten Zeitraum von einer Woche bis maximal zwei Wochen, absent sind. Intervallschwänzen meint im Gegenzug die Kinder und Jugendlichen, die regelmäßig in der Schule für einige Tage fehlen. Den letzten Unterpunkt des Regelschwänzens bildet das gelegentliche Langzeitschulschwänzen. Charakteristisch für Schüler dieser Gruppe ist ein nahezu regelmäßiger Schulbesuch, zumindest über längere Zeitperioden hinweg betrachtet, um dann einmal oder für einige Wochen, der Institution Schule, fern zu bleiben. Der Wiedereinstieg solcher Kinder und Jugendlichen gelingt in der Mehrheit der Fälle nicht oder wenn doch, dann nur mit immensem, pädagogischen Engagement und unter günstigen, auffindbaren Umständen (vgl. ebd.).
Die letzte Steigerungsform stellt das Intensivschwänzen als Schulverweigerung dar. Differenziert wird in die reversible und tendenziell irreversible Schulverweigerung.
Obwohl bei reversibler Schulverweigerung die betroffenen Kinder und Jugendlichen, wochen-, wenn nicht sogar monatelang im Schulunterricht absent sind, halten sie dennoch soziale Kontakte zu Mitschülern aufrecht. Das zeigt sich in häufigen Aufenthalten nahe der Schule. Solche Kinder und Jugendlichen haben noch nicht gänzlich mit der Schule abgeschlossen und
gebrochen. Hier besteht demnach durchaus die Aussicht auf eine Rückkehr zur Schule. Währenddessen ist bei der tendenziell irreversiblen Schulverweigerung der Kontakt zur Schule und den schulischen Kontaktpersonen komplett abgerissen und eine Rückkehr damit höchst
zweifelhaft, wenn nicht ausgeschlossen (vgl. Thimm 2000, S. 163).
4 Gesellschaftliches Problem Schulverweigerung – Ursachen, Ausprägungen und Konsequenzen
Am 07.10.2009 äußerte sich der Karlheinz Thimm in einem Interview mit Spiegel Online, vertreten durch Menke Birger, zur Problematik Schulverweigerung und Schulschwänzen. Dort berichtete er: „Die Kultusministerien und Wissenschaftler gehen von rund 300.000 Schulverweigerern in Deutschland aus - Schüler, die an mindestens zehn Schultagen pro Halbjahr fehlen. Hinzu kommen viele Gelegenheitsschwänzer. (…) Ich beschäftige mich damit seit 15 Jahren, in dieser Zeit sind die Zahlen nicht gestiegen. Das konstante Level: rund zwei Prozent der gesamten Schülerschaft schwänzen in einem erheblichen Ausmaß.“ (Spiegel Online 2009, Interview mit Karlheinz Thimm).
Zu dieser Ansicht kommen auch Ehmann und Rademacker. Sie sehen bei der Betrachtung der wenigen, ohnehin schlecht miteinander vergleichbaren Studien keine Indizien oder Hinweise dafür, dass es in den letzten Jahrzehnten einen Anstieg an Schulversäumnissen gegeben hat (vgl. Ehmann/Rademacker 2003, S. 57f.).
Die Entstehung schulverweigernder Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen kann neben der Schule auch durch andere Lebensbereiche begünstigt werden. In der Regel lassen sich Verweigerungsneigungen auf familiäre, schulische, biographische und gesellschaftliche Aspekte zurückverfolgen, was die Vielfalt an möglichen Ursachen des Phänomens erklärt (vgl. Schreiber-Kittl 2000, S. 8f.).
4.1 Ausprägung des Phänomens
4.1.1 Altersverteilung
Bereits in der Grundschule sind Anzeichen zu beobachten, die für eine Abkehr von Schule sprechen. Das betrifft insbesondere den Wechsel von der Grundschule in die weiterführende Sekundarstufe I, der in der Mehrheit der Bundesländer mit dem Übergang von der vierten in die fünfte Klasse erfolgt. In diesem Zeitraum findet der frühere Ausstieg aus der Schule besonders häufig statt. Aber auch das zwölfte Lebensjahr ist als besonders kritischer Zeitpunkt in der Schullaufbahn eines Kindes hervorzuheben (vgl. Schreiber 2007, S. 216).
Ausgeprägte, verweigernde Verhaltensweisen manifestieren sich Untersuchungen zufolge bereits innerhalb des 12. bis 14. Lebensjahres. Aber auch ab dem 15. Lebensjahr, also bei älteren Schülern höherer Klassen, besteht die Gefahr, dass sich Verweigerungstendenzen zeigen. Obwohl vorher regelmäßig die Schule besucht wurde, kann sich der Übertritt in die Arbeitswelt der Erwachsenen für die Schüler so problematisch gestalten, dass sie sich erst am Ende ihrer Schulpflicht dazu entschließen, dem Unterricht fern zu bleiben und damit zu Schulverweigerern zu werden (vgl. ebd., S. 216f.).
Gemäß Schreiber-Kittl und Schröpfer verweigern jüngere Schüler eher passiv, während Ältere zunehmend über aktive Verweigerung, wie Unterrichtsstörungen, stunden- oder tageweises Schulschwänzen bis hin zum Totalausstieg von Schule auf sich aufmerksam machen. Die jüngeren Schüler verhalten dabei unauffälliger und fallen dem Lehrpersonal nicht etwa durch körperliche Abwesenheit vom Unterricht auf, sondern über ihre fehlende Bereitschaft und Anteilnahme am Unterrichtsgeschehen (vgl. Schreiber-Kittl 2001, S. 13).
Aktive Schulverweigerung verhält sich demnach in Abhängigkeit zum Alter des Schülers, wobei das 13. Lebensjahr als Einstiegsalter angesehen und die Zeitspanne zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr als Höhepunkt gedeutet werden kann. Die Verweigerungsquote der Schüler ist folglich umso höher, je älter die Kinder und Jugendlichen sind (vgl. Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002, S. 103).
Begründen lässt der mögliche Beginn aktiver Schulverweigerung, etwa ab der 6. Klasse, über die „einsetzende Pubertät im Zusammenhang mit einer zunehmenden Bedeutung Gleichaltriger und einer wachsenden Ablösung der Jugendlichen von Eltern und anderen Erwachsenen (…) Variablen, die ohnehin vorhandene Schulverweigerungstendenzen erheblich verstärken können.“ (Schreiber-Kittl 2001, S. 21).
4.1.2 Geschlechterverteilung
Gemäß Erfahrungen von Experten auf dem Forschungsgebiet der Schulverweigerung sind die Problemlagen, die zur Verweigerung von Schule führen, weitgehend unabhängig vom Geschlecht (vgl. ebd., S. 23).
Unterschiede bei den Geschlechtern zeigen sich allerdings in der Art, wie mit Problemen umgegangen wird. Wesentliche Differenzen zeigen sich diesbezüglich bei der Bewältigung von Konflikten, in Verhaltensmustern, bei Strategien der Problemverarbeitung, als auch bei Folgeerscheinungen (vgl. Schreiber 2007, S. 217).
Konfrontiert mit Fehlern, reagieren Mädchen häufig hilfloser als Jungen. Sie deuten aufgetretene (Leistung-)Probleme im Gegensatz zu den Jungen eher als Defizite ihres Könnens. Für Jungen sind solche Unzulänglichkeiten dagegen nur ein Beweis mangelnder Anstrengung (vgl. Thimm 1998, S. 30).
Mädchen verweigern im Schulunterricht eher passiv und ziehen sich dementsprechend bei Problemen zurück. Ihre Verweigerung äußert sich über eine zurückhaltende oder unterlassende Einbringung am Unterrichtsgeschehen. Im Vergleich mit den Jungen zeigen Mädchen viel häufiger abweichendes Verhalten in Form von Depressionen, Störungen im Essverhalten oder psychosomatischen Störungen. Jungen präsentieren sich im Schulunterricht dagegen öfters aktiv schulverweigernd und treten mit Aggressivität und Gewaltbereitschaft in Erscheinung. Sie suchen verstärkt bei gleichgesinnten Freunden Bestätigung, Erfolgserlebnisse und Anerkennung und bleiben dem Unterricht gleich ganz fern (vgl. Schreiber 2007, S. 218).
Da Untersuchungen im deutschsprachigen Raum, sowie Meinungen und Erfahrungen von Lehrkräften voneinander abweichen, kann Schulverweigerung nicht explizit als ein Problem des einen oder des anderen Geschlechtes betrachtet werden. Allerdings werden Mädchen in fachlichen Diskursen seltener erwähnt, wenn es um die Bereitschaft zum Absentismus von Schule geht, als Jungen (vgl. Ricking 2006, S. 71).
Zusammenfassend und abschließend kann die Auffassung Titus Simons genannt werden. Dieser betont, dass Äußerungen darüber, dass Mädchen seltener die Schule schwänzen als Jungen, so nicht stimmen, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass „die intensiveren Formen des Fernbleibens bei Jungen häufiger auftreten.“ (Simon 2002, S.12).
4.1.3 Risikogruppen
Gemäß Schreiber-Kittl und Schröpfer gibt es Gruppen, die ein erhöhtes Risiko aufzeigen, Schulverweigerung zu begehen. Die Autoren benennen diese Gruppen als Risikogruppen. Wer zu dieser Einteilung gehört, ergibt sich für
Schreiber-Kittel und Schröpfer aus der PISA-Studie4. Diese enthält zwar keine Untersuchung speziell über Schulverweigerung, aber mit der PISA-Studie werden Bedingungen, pädagogischer, sozialer und ökonomischer Art getestet und geprüft, die das Risiko des Auftretens von schulverweigernden Verhaltensweisen und die Entwicklung zu einer schulverweigernden Persönlichkeit, unverkennbar erhöhen (vgl. Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002, S. 50).
Laut Schreiber-Kittl und Schröpfer können aus den PISA-Resultaten Gruppen abgeleitet werden „(…), die vermehrt sozial bedingte Leistungsschwächen haben und insofern möglicherweise auch ein erhöhtes Risiko für Schulverweigerung und Schulabbruch tragen (…).“ (Schreiber-Kittl/Schröpfer 2002, S.50).
Zu diesen sogenannten Risikogruppen zählen:
- Schüler, die eine oder mehrere Klassen wiederholen mussten
- Schüler, die von einer höheren in eine niedrige Schulform wechseln oder absteigen mussten
- Schüler bestimmter Schulformen
- Schüler, die vom Schulbesuch zurück gestellt wurden
- Kinder und Jugendliche aus Familien die zugewandert sind (mit Migrationshintergrund)
- Kinder und Jugendliche sozial schwacher Familien (vgl. ebd.).
[...]
1 Das von Thimm erstellte Schaubild über den möglichen Vorgehensweg der zuständigen Ämter bei Schulverweigerung ist abgebildet in: Thimm, K. (2000): Schulverweigerung. Zur Begründung eines neuen Verhältnisses von Sozialpädagogik und Schule. Münster: Votum-Verlag, S. 75.
2 Auf dieses Programm wird in Kapitel 7.1.3 dieser Arbeit genauer eingegangen und Bezug genommen.
3 Schulverweigerungsformen gemäß Thimm sind: die aktionistische Schulverweigerung, die vermeidende Schulverweigerung, Schulverdrossenheit und Totalausstieg, die bereits in Kapitel 3.1 dieser Arbeit dargelegt wurden.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Schulverweigerung?
Schulverweigerung umfasst verschiedene Formen des Fernbleibens vom Unterricht, von gelegentlichem Schwänzen bis hin zur totalen Verweigerung des Schulbesuchs.
Was ist Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)?
JaS ist ein Angebot der Jugendhilfe direkt in der Schule, das Schüler bei sozialen und persönlichen Problemen unterstützt und die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe stärkt.
Welche Ursachen führen zu Schulabsentismus?
Die Ursachen sind komplex und liegen oft in einem Zusammenspiel von individuellen Faktoren, familiären Problemen und schulischen Rahmenbedingungen.
Welche Konsequenzen hat dauerhafte Schulverweigerung?
Betroffene riskieren den Schulabschluss, was zu langfristigen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt und sozialer Ausgrenzung führen kann.
Wie können Schulen präventiv gegen Verweigerung vorgehen?
Durch ein positives Schulklima, frühe Erkennung von Warnsignalen und eine enge Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit können Interventionsmaßnahmen rechtzeitig greifen.
- Citar trabajo
- Sabrina Schauerhammer (Autor), 2012, Die Bearbeitung der Problematik Schulverweigerung durch Jugendsozialarbeit an Schulen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/203933