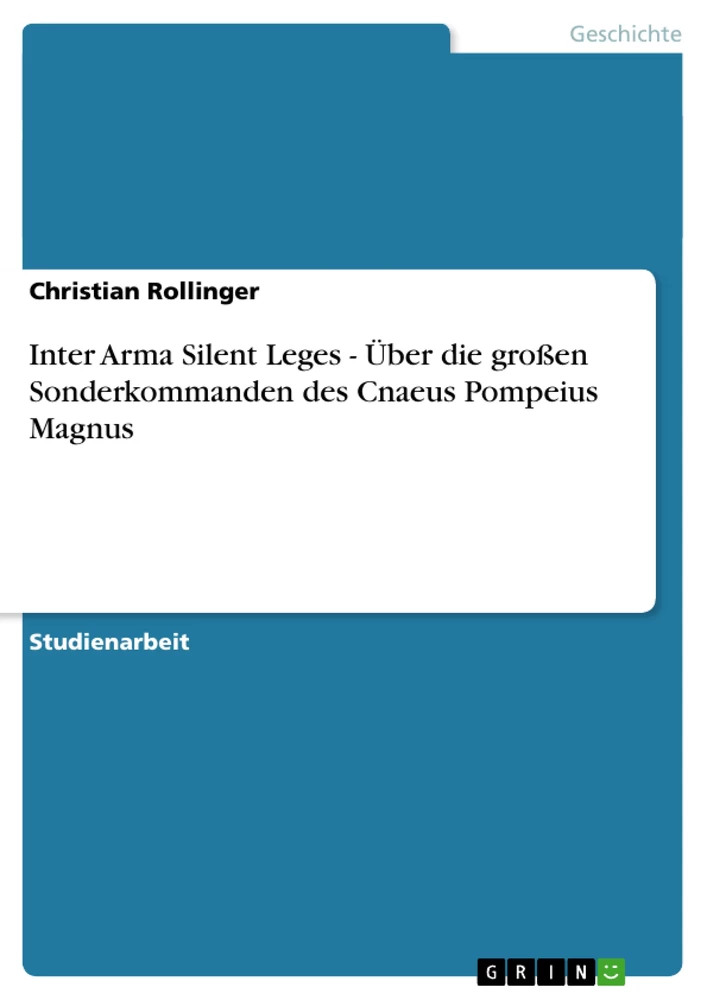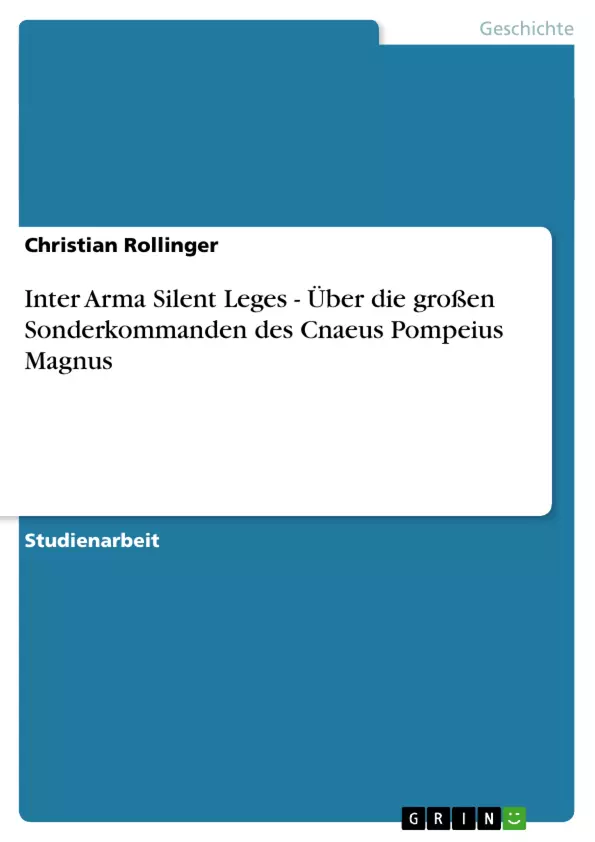Cnaeus Pompeius Magnus war und ist eine umstrittene Gestalt. Aus dem Dunkel des
sullanischen Bürgerkrieges stieg dieses “aufgehende Gestirn” 1 empor, überflügelte den
Diktator Sulla und stieg auf zu höchsten Ehren, bis einem kometenhaften Aufstieg ein
ebenso plötzlicher Fall folgte. Theodor Mommsen sah in ihm einen guten Offizier,
“übrigens aber von mittelmäßigen Gaben des Geistes und des Herzens, […] ein
Beispiel falscher Größe[…], wie es die Geschichte kein zweites kennt”2, und dieser
Einschätzung sind viele gefolgt.
Schon die Zeitgenossen Pompeius’ übten schwere Kritik an ihm: die drei wichtigsten
Zeitzeugen, deren Werke auf uns gekommen sind – Caesar, Cicero und Sallust – waren
allesamt keine Bewunderer Pompeius. Cicero blieb auf Distanz zu ihm, buhlte zuweilen
um seine Unterstützung, versuchte gar, ihn auf die Seite der boni zu ziehen, doch
behielt er stets einige Vorbehalte. Daß das Urteil Caesars nicht positiver ausfiel
wundert nicht weiter, und Sallust, der im Bürgerkrieg auf Seiten Caesars kämpfte, wird
ebenso von der Gegnerschaft des Pompeius beeinflußt worden sein.
Trotz der vielfältigen zeitgenössischen Literatur – über keine Periode der Antike sind
wir besser informiert, als über die letzten Jahrzehnte der Republik – ist das Bild, das
uns durch sie vermittelt wird, einseitig: sie ist vor allem von Cicero geprägt. Umso
wichtiger sind daher die Werke späterer Autoren, die sich nicht ausschließlich auf
Caesar, Cicero oder Sallust berufen, und uns so einen Einblick in andere, verlorene
Quellen verschaffen. Am interessantesten sind dabei sicherlich die Biographien
Plutarchs und die noch erhaltenen, im Jahr 68 vor Christus einsetzenden Bücher der
“Römischen Geschichte” von Cassius Dio. Auch Velleius Paterculus ist von einiger
Bedeutung: in seiner “Historia romana” behandelt er unter anderem die Jahre 83 bis
44. Auch die “Annales” des Publius Cornelius Tacitus sind, bei der Frage nach der
Natur des pompeianischen imperiums , von Bedeutung. [...]
1 Plutarch, Vies Parallèles II, Pompée, 14, 4.
2 Theodor Mommsen, Römische Geschichte, Bd. 3, s. 436.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Vorgeschichte: Die Ereignisse bis 83 v. Chr.
- Das imperium des Pompeius im Seeräuberkrieg
- Die kilikischen Seeräuber
- Die lex Gabinia
- Das imperium des Pompeius im Dritten Mithridatischen Krieg
- Der Konflikt mit Mithridates VI. Eupator
- Die lex Manilia
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der außergewöhnlichen Karriere des römischen Feldherrn Cnaeus Pompeius Magnus und seiner Rolle in der Krise der römischen Republik. Sie analysiert seine bedeutenden militärischen Feldzüge sowie die verfassungsrechtlichen Abnormitäten, die mit seinen Kommandos verbunden waren.
- Pompeius' Aufstieg und Fall in der römischen Politik
- Das Wirken Pompeius' im Seeräuberkrieg und im Dritten Mithridatischen Krieg
- Die lex Gabinia und lex Manilia: Verleihung von außergewöhnlichen Imperien an Pompeius
- Die Auswirkungen der pompeianischen Imperien auf die römische Verfassung und die Entwicklung der Republik
- Die Kritik an Pompeius' Machtansammlung und seine Stellung als "Außenseiter" im römischen System
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Cnaeus Pompeius Magnus als umstrittene Gestalt vor und beleuchtet die unterschiedlichen Einschätzungen seiner Persönlichkeit und Karriere. Sie diskutiert die Bedeutung der zeitgenössischen Quellen, insbesondere die Werke Ciceros, Caesars und Sallusts, und betont die Wichtigkeit der späteren Autoren, die neue Einblicke in Pompeius' Leben und Wirken bieten.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Vorgeschichte Pompeius' Karriere und beschreibt die innenpolitische Situation in Rom im 2. Jahrhundert v. Chr. Es behandelt die Entwicklung der römischen Republik und die Herausforderungen, die mit dem Erhalt des Imperiums verbunden waren.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Seeräuberkrieg und den Ereignissen, die zur Verleihung des ersten Imperiums an Pompeius führten. Es beleuchtet die Bedrohung durch die kilikischen Seeräuber und die Verabschiedung der lex Gabinia, die Pompeius außergewöhnliche Vollmachten verleiht.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf den Dritten Mithridatischen Krieg und die Rolle Pompeius' in diesem Konflikt. Es analysiert die Auseinandersetzung mit Mithridates VI. Eupator und die Verleihung des zweiten Imperiums an Pompeius durch die lex Manilia.
Schlüsselwörter
Cnaeus Pompeius Magnus, Römische Republik, Imperium, Senatsherrschaft, Seeräuberkrieg, Kilikische Seeräuber, Dritter Mithridatischer Krieg, Mithridates VI. Eupator, lex Gabinia, lex Manilia, Optimaten, Popularen, Republik, Machtansammlung, Verfassungskrise, Geschichte Roms, Antike.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Cnaeus Pompeius Magnus?
Pompeius war ein bedeutender römischer Feldherr und Politiker, dessen kometenhafter Aufstieg und außergewöhnliche Machtbefugnisse die Endphase der Römischen Republik prägten.
Was regelte die Lex Gabinia?
Die Lex Gabinia verlieh Pompeius ein außergewöhnliches Imperium (Vollmachten) zur Bekämpfung der kilikischen Seeräuber im gesamten Mittelmeerraum.
Welche Bedeutung hatte die Lex Manilia?
Durch die Lex Manilia erhielt Pompeius das Oberkommando im Dritten Mithridatischen Krieg, was seine Machtstellung gegenüber dem Senat weiter festigte.
Wie beurteilten Zeitgenossen wie Cicero oder Caesar Pompeius?
Das Bild war gespalten: Cicero schwankte zwischen Bewunderung und Distanz, während Caesar ihn als politischen Rivalen sah; oft wurde ihm „falsche Größe“ vorgeworfen.
Warum führten Pompeius' Sonderkommanden zur Krise der Republik?
Die Anhäufung militärischer und politischer Macht in einer Person widersprach der traditionellen Senatsherrschaft und ebnete den Weg für das Ende der Republik.
- Citation du texte
- Christian Rollinger (Auteur), 2003, Inter Arma Silent Leges - Über die großen Sonderkommanden des Cnaeus Pompeius Magnus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20396