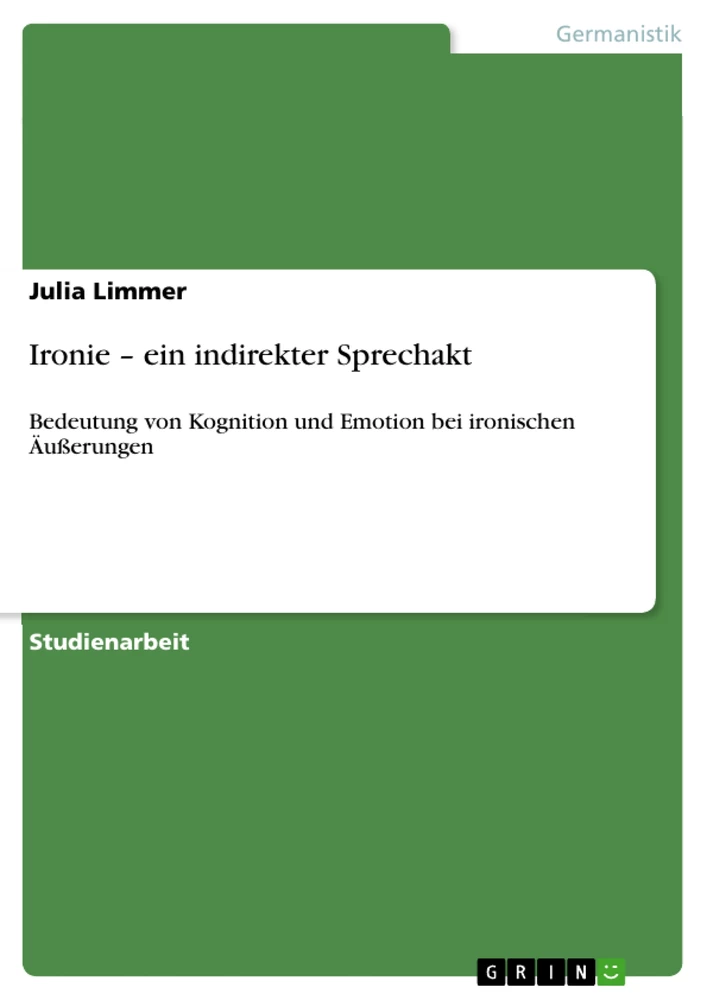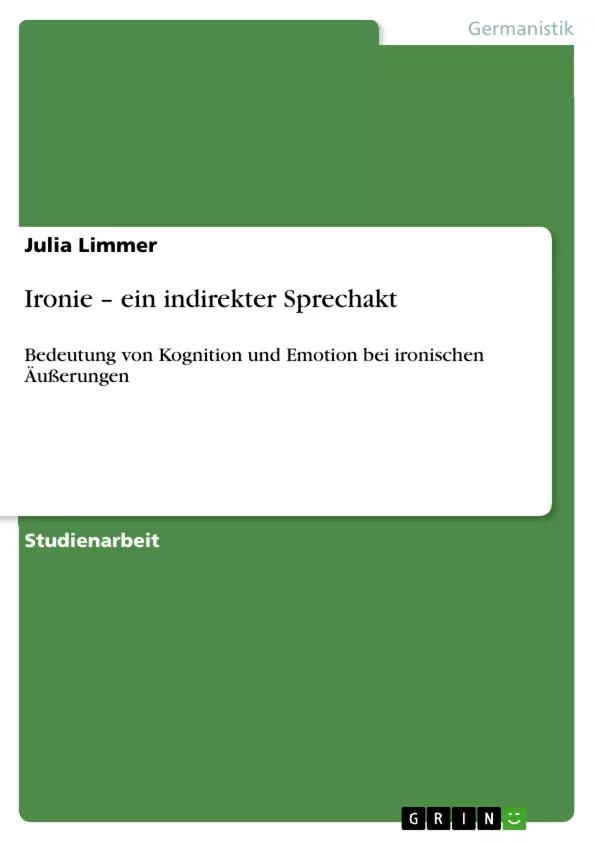Ein nicht seltenes Phänomen im allgemeinen Sprachgebrauch ist die Verwendung ironischer Äußerungen. Besonders das Verstehen dieser wird in der Ironieforschung auffallend häufig thematisiert, vor allem im Zusammenhang mit der Frage nach dem Grund für die Verwendung nichtwörtlicher Rede. Aber warum wird hier so ein starker Fokus gesetzt? Welche Besonderheit weist die Verwendung von Ironie und das Verständnis dieser auf, die das Interesse der Linguistik derart auf sich zieht?
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse ironischer Äußerungen unter folgenden Fragestellungen:
I. Wie funktioniert Ironie und woran erkennt man, dass der Sprecher Ironie verwendet?
II. Was sind die Ziele ironischer Äußerungen?
III. In welcher Form finden kognitive und emotionale Bewertungen durch die
Verwendung von Ironie statt?
IV. Ist Ironie ein kognitiver und/oder emotionaler Akt?
Nachdem die theoretischen Grundlagen geklärt worden sind, wird das Thema Ironie unter Berücksichtigung folgender Thesen betrachtet:
I. Ironie vermittelt sowohl kognitive als auch emotionale Bewertungen
II. Die emotionale Einstellung des Produzenten bei der Verwendung von Ironie muss durch eine doppelte Implikaturziehung erschlossen werden.
III. Eine ironische Äußerung ist immer ein impliziter expressiver Sprechakt.
Ziel der Arbeit ist es, neben der Beantwortung der oben gestellten Fragen, die Bedeutung der Emotion bei der Verwendung von Ironie herauszuarbeiten, da dieser Gesichtspunkt bisher von der Forschung – unberechtigterweise – nur partiell und ungenügend berücksichtig wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Materialkorpus
- Definition des Ironiebegriffs
- Kognitiver Aspekt der Ironie
- Überblick
- Funktionsweise von Ironie
- Unterschied zwischen Ironie und Lüge
- Ironiesignale
- Emotionaler Aspekt der Ironie
- Funktion und Ziele ironischer Äußerungen
- Ironie – kognitive Doppelimplikatur und emotionale Bewertung
- Ironie als indirekter expressiver Sprechakt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert ironische Äußerungen und untersucht deren kognitive und emotionale Aspekte. Sie beleuchtet die Funktionsweise von Ironie, die Ziele ironischer Äußerungen und die Rolle von Emotionen im Prozess der Ironieproduktion und -rezeption. Die Arbeit strebt danach, die Bedeutung der Emotionen bei der Verwendung von Ironie herauszuarbeiten, ein Aspekt, der in der bisherigen Forschung unzureichend behandelt wurde.
- Funktionsweise und Erkennung von Ironie
- Ziele und Funktionen ironischer Äußerungen
- Kognitive und emotionale Bewertungen in der Ironie
- Ironie als kognitiver und/oder emotionaler Akt
- Die Rolle der Emotionen bei der Verwendung von Ironie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Ironie ein und begründet die Relevanz der Forschungsfrage. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor, die sich mit der Funktionsweise, den Zielen und den kognitiven und emotionalen Aspekten von Ironie befassen. Die Arbeit basiert auf drei zentralen Thesen, die im weiteren Verlauf untersucht werden: Ironie vermittelt kognitive und emotionale Bewertungen; die emotionale Einstellung des Sprechers muss durch eine doppelte Implikatur erschlossen werden; eine ironische Äußerung ist ein impliziter expressiver Sprechakt. Das Ziel der Arbeit ist die Herausarbeitung der Bedeutung von Emotionen bei der Verwendung von Ironie, ein Aspekt, der in der bisherigen Forschung vernachlässigt wurde.
Das Materialkorpus: Dieses Kapitel beschreibt das verwendete Materialkorpus: die ersten beiden Staffeln der deutschen Fernsehserie "Stromberg". Die Wahl dieses Korpus wird damit begründet, dass in Comedyserien häufig ironische Äußerungen vorkommen und die Analyse von Ironie in gesprochener Sprache ermöglicht wird. Die bestehende Struktur des Mediums ermöglicht wiederholtes Anschauen und reduziert die Flüchtigkeit mündlicher Kommunikation. Die Grenzen dieser Wahl werden ebenfalls erwähnt: Fernsehkommunikation unterscheidet sich von spontaner Alltagskommunikation. Die Methode der Analyse beinhaltet die Untersuchung der digitalen Episoden auf Ironie und die Transkription der identifizierten Stellen.
Definition des Ironiebegriffs: Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung und die verschiedenen Definitionen des Ironiebegriffs. Es werden historische Definitionen, beginnend mit Sokrates, vorgestellt und mit aktuellen wissenschaftlichen Ansätzen verglichen. Kritisch wird der Mangel an Präzision in älteren Definitionen beleuchtet, insbesondere die fehlende Abgrenzung zur Lüge. Die Arbeit vertritt schliesslich eine präzisere Definition von verbaler Ironie, die den Aspekt der simulierten Unaufrichtigkeit, die für den Rezipienten durchschaubar sein muss, betont.
Kognitiver Aspekt der Ironie: Dieses Kapitel befasst sich mit dem kognitiven Aspekt der Ironie. Es werden die Funktionsweise von Ironie, der Unterschied zwischen Ironie und Lüge und die Rolle von Ironiesignalen analysiert. Das Kapitel beleuchtet die kognitiven Prozesse, die beim Verständnis und der Produktion von Ironie beteiligt sind, und wie der Hörer die intendierte Bedeutung aus der Inkongruenz zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten erschließt. Die Analyse der Ironiesignale soll Aufschluss darüber geben, wie Sprecher Ironie markieren und wie Hörer diese Signale interpretieren.
Emotionaler Aspekt der Ironie: Dieses Kapitel erörtert den emotionalen Aspekt von Ironie. Es untersucht die Funktionen und Ziele ironischer Äußerungen sowie die Rolle von Emotionen in der kognitiven Doppelimplikatur und der emotionalen Bewertung. Der Fokus liegt auf der Analyse von Ironie als indirektem expressivem Sprechakt, wodurch Emotionen zwar nicht explizit ausgedrückt, aber implizit vermittelt werden. Es wird untersucht, wie Emotionen sowohl von der sprechenden als auch von der hörenden Person erlebt und interpretiert werden. Die Analyse betont die Interaktion zwischen kognitiven und emotionalen Prozessen bei der Produktion und Rezeption von Ironie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse ironischer Äußerungen in "Stromberg"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert ironische Äußerungen und untersucht deren kognitive und emotionale Aspekte anhand der ersten beiden Staffeln der deutschen Fernsehserie "Stromberg". Der Fokus liegt auf der Funktionsweise von Ironie, den Zielen ironischer Äußerungen und der Rolle von Emotionen in der Produktion und Rezeption von Ironie.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Fragen zur Funktionsweise und Erkennung von Ironie, den Zielen und Funktionen ironischer Äußerungen, kognitiven und emotionalen Bewertungen in der Ironie, sowie der Rolle der Emotionen bei der Verwendung von Ironie. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung der Emotionen, einem Aspekt, der in der bisherigen Forschung oft vernachlässigt wurde.
Welche Methodik wird angewendet?
Das verwendete Materialkorpus besteht aus den ersten beiden Staffeln der Serie "Stromberg". Die Wahl begründet sich auf dem häufigen Vorkommen ironischer Äußerungen in Comedyserien und der Möglichkeit, Ironie in gesprochener Sprache zu analysieren. Die Analyse beinhaltet die Untersuchung der digitalen Episoden auf Ironie und die Transkription der identifizierten Stellen. Die Grenzen dieser Methodik (Unterschied zwischen Fernseh- und Alltagskommunikation) werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird der Begriff "Ironie" definiert?
Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung und verschiedene Definitionen des Ironiebegriffs, von Sokrates bis zu aktuellen wissenschaftlichen Ansätzen. Sie kritisiert den Mangel an Präzision in älteren Definitionen und bietet eine präzisere Definition verbaler Ironie an, die den Aspekt der simulierten Unaufrichtigkeit betont, die für den Rezipienten erkennbar sein muss.
Welche Aspekte der Ironie werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl den kognitiven als auch den emotionalen Aspekt der Ironie. Der kognitive Aspekt umfasst die Funktionsweise von Ironie, den Unterschied zwischen Ironie und Lüge, und die Rolle von Ironiesignalen. Der emotionale Aspekt konzentriert sich auf die Funktionen und Ziele ironischer Äußerungen, die Rolle von Emotionen in der kognitiven Doppelimplikatur und der emotionalen Bewertung, sowie die Analyse von Ironie als indirektem expressivem Sprechakt.
Welche zentralen Thesen werden vertreten?
Die Arbeit basiert auf drei zentralen Thesen: Ironie vermittelt kognitive und emotionale Bewertungen; die emotionale Einstellung des Sprechers muss durch eine doppelte Implikatur erschlossen werden; eine ironische Äußerung ist ein impliziter expressiver Sprechakt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Materialkorpus, ein Kapitel zur Definition des Ironiebegriffs, Kapitel zum kognitiven und emotionalen Aspekt der Ironie und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Ironieanalyse.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit im bereitgestellten Text enthalten, aber es wird implizit deutlich, dass die Arbeit die Bedeutung der Emotionen bei der Verwendung von Ironie herausarbeiten und einen Beitrag zur bisherigen Forschung leisten will.)
- Citation du texte
- Julia Limmer (Auteur), 2010, Ironie – ein indirekter Sprechakt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204088