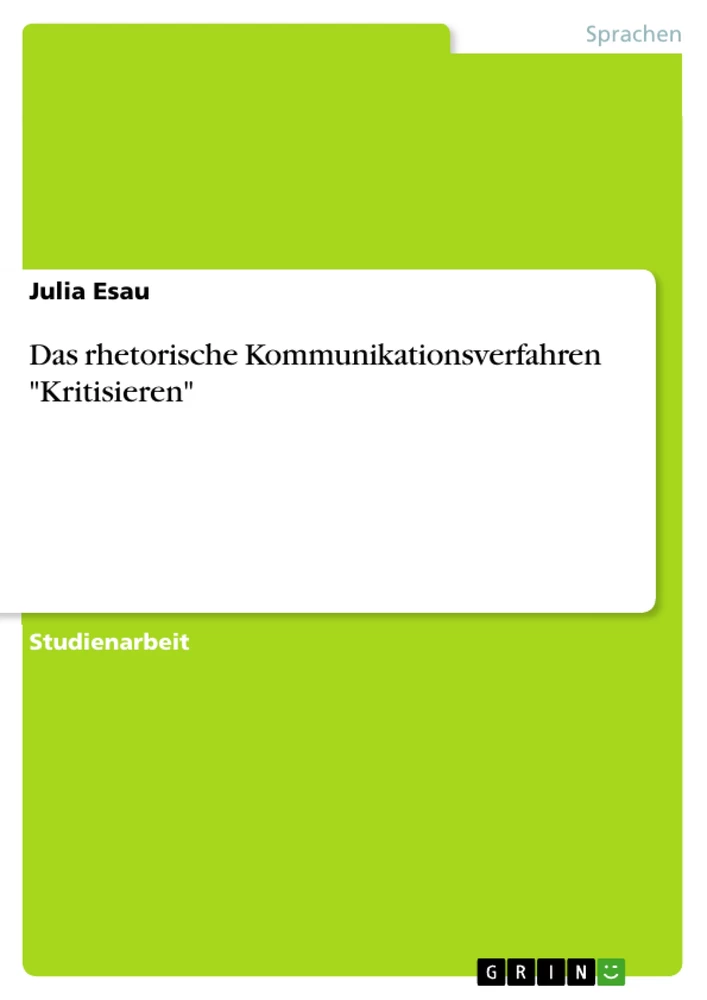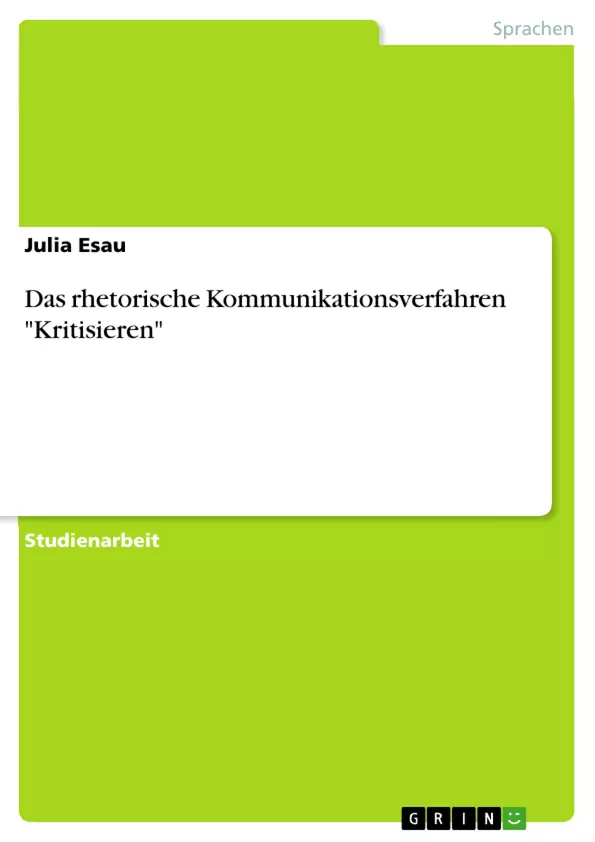I. Einleitung
Fast täglich wird man mit dem Kritisieren konfrontiert. Entweder ist man selber derjenige, der einen Missstand oder eine Person kritisiert, oder man wird kritisiert. Schon wenn man morgens die Zeitung aufschlägt, trifft man auf negative und positive Literatur- oder Filmkritik. Doch was genau ist das Kritisieren? Gibt es tatsächlich eine positive Kritik, obwohl Kritik intuitiv negativ belegt ist? Kritik kann kommunikativ oder non-verbal, zum Beispiel durch eine Benotung, ausfallen. Aus rhetorischer Perspektive beschränken wir uns auf den kommunikativen Aspekt des Kritisierens und untersuchen das Kritisieren als Kommunikationsverfahren.
Es soll definiert werden, was ein Kommunikationsverfahren ist und ob das Kritisieren auch als Kommunikationsverfahren zählt. Hierfür muss die Terminologie des Kritisierens erläutert werden, auch in Abgrenzung zu anderen ähnlichen Begriffen. Eine Hilfestellung bietet die Potsdamer Schule. Es wird geklärt, was Kritisieren bedeutet, was das Proprium des Kritisierens ist und wer kritisiert. Um schlussendlich das Kritisieren als rhetorisches Kommunikationsverfahren einordnen zu können, wird erörtert, was das Rhetorische am Verfahren des Kritisierens ist. Betrachtet werden der Orator (Kritiker), der Adressat (Kritisierte), das Setting und die sprachliche Ausformulierung des Kritisierens.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition „Kommunikationsverfahren"
- Terminologie „Kritisieren"
- Etymologie
- Sprachkritik
- Literaturkritik
- Filmkritik
- Der Kritiker bzw. Orator
- Abgrenzung benachbarter Begriffe
- Potsdamer Schule
- Versuch einer Synthese
- Das Kommunikationsverfahren Kritisieren aus rhetorischer Perspektive
- Orator
- Adressat
- Setting
- Elocutio
- Zusammenfassung
- Literaturangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Kritisieren als Kommunikationsverfahren aus rhetorischer Perspektive. Er untersucht die Definition und Terminologie des Begriffs „Kritisieren", analysiert seine Anwendung als Kommunikationsverfahren und beleuchtet die Rolle des Orators, des Adressaten und des Settings. Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind die Abgrenzung des Kritisierens von ähnlichen Begriffen, die Analyse der Potsdamer Schule im Kontext des Kritisierens, die Bedeutung der Elocutio für das Verfahren sowie die Erörterung des Kritisierens als ein grundlegendes rhetorisches Verfahren.
- Definition und Terminologie des Kritisierens
- Das Kritisieren als Kommunikationsverfahren
- Die Rolle des Orators, des Adressaten und des Settings
- Die Bedeutung der Elocutio für das Kritisieren
- Das Kritisieren als ein grundlegendes rhetorisches Verfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz des Kritisierens im Alltag heraus. Sie skizziert den Forschungsgegenstand und die Zielsetzung des Textes. Im zweiten Kapitel wird der Begriff „Kommunikationsverfahren" definiert und die Frage geklärt, ob das Kritisieren als ein solches Verfahren verstanden werden kann. Die Terminologie des Kritisierens wird im dritten Kapitel anhand verschiedener Aspekte wie Etymologie, Sprachkritik, Literaturkritik und Filmkritik beleuchtet. Dabei wird die Bedeutung der Argumentation und der Autorität des Kritikers hervorgehoben. Das vierte Kapitel widmet sich dem Kommunikationsverfahren Kritisieren aus rhetorischer Perspektive. Es werden die Rollen des Orators, des Adressaten und des Settings sowie die Bedeutung der Elocutio für den Erfolg des Verfahrens erörtert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kommunikationsverfahren, Kritisieren, Rhetorik, Orator, Adressat, Setting, Elocutio, Argumentation, Autorität, Persuasion, Metabolie, Systase, Kritik, Terminologie, Definition, Potsdamer Schule, Sprachkritik, Literaturkritik, Filmkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Kommunikationsverfahren "Kritisieren"?
Kritisieren wird aus rhetorischer Perspektive als ein spezifisches Kommunikationsverfahren definiert, das über die bloße negative Bewertung hinausgeht und rhetorisch-sprachliche Mittel nutzt.
Wer ist der "Orator" im Prozess der Kritik?
Der Orator bezeichnet in diesem Kontext den Kritiker, der die Kritik formuliert und dabei bestimmte rhetorische Strategien anwendet.
Welche Rolle spielt die Potsdamer Schule in diesem Text?
Die Potsdamer Schule dient als theoretische Hilfestellung zur Erläuterung der Terminologie und Abgrenzung des Kritisierens von ähnlichen Begriffen.
Was bedeutet "Elocutio" im Zusammenhang mit Kritik?
Elocutio bezieht sich auf die sprachliche Ausformulierung der Kritik, die entscheidend für den Erfolg und die Wirkung des Verfahrens ist.
Gibt es einen Unterschied zwischen verbaler und non-verbaler Kritik?
Ja, Kritik kann kommunikativ (verbal) oder non-verbal (z. B. durch Benotung) erfolgen, wobei sich die rhetorische Analyse primär auf den kommunikativen Aspekt konzentriert.
- Quote paper
- Julia Esau (Author), 2012, Das rhetorische Kommunikationsverfahren "Kritisieren", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204528