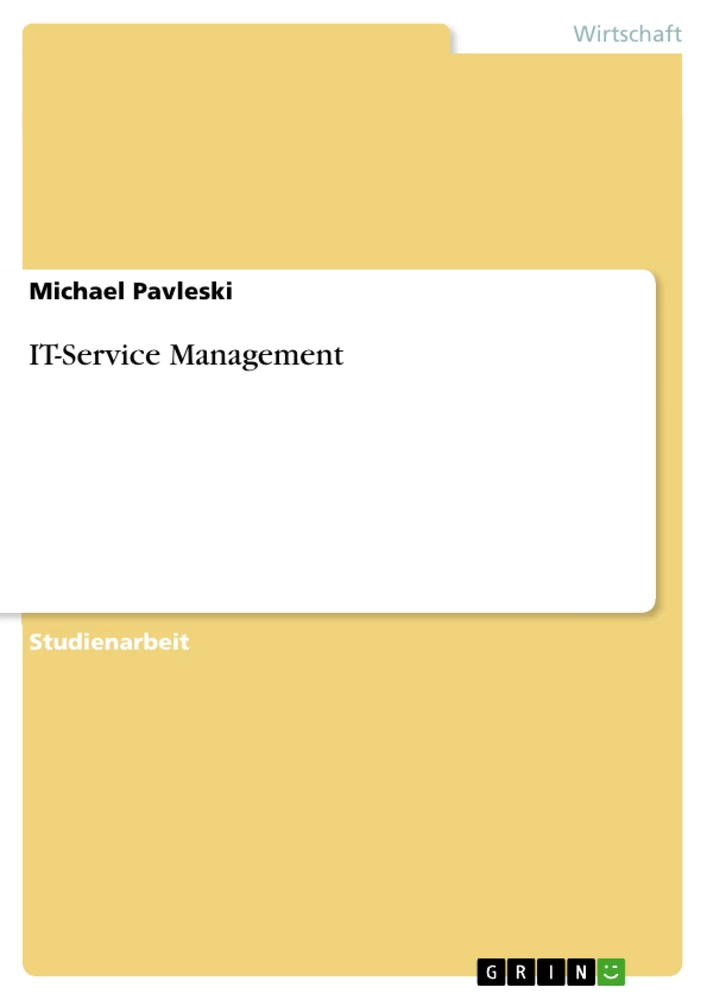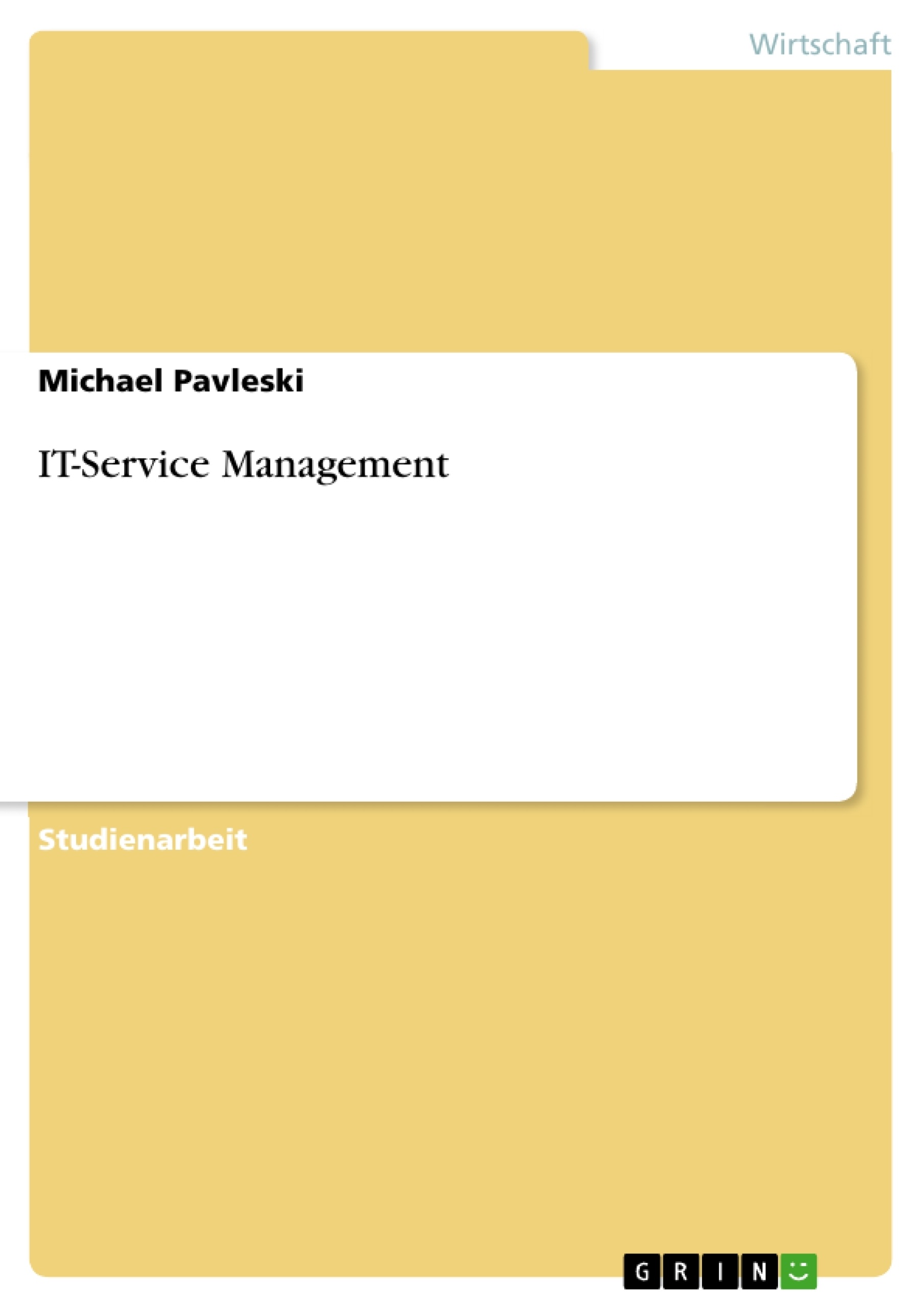Zur Realisierung der Unternehmensziele ist die Informationstechnologie (IT) von entscheidender Bedeutung. Die Unternehmensansprüche an die IT sind jedoch größer als jemals zuvor. Die Unternehmen fordern eine immer bessere und disziplinierte Bereitstellung von IT-Services, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Außerdem wird eine hohe geschäftliche Agilität der IT zum befriedigen der Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse gefordert. Im Gegenzug sind Unternehmen aber nicht bereit die IT-Budgets zu erhöhen. Eine Optimierung der Geschäftsprozesse durch den IT-Einsatz zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten ist erforderlich. Des Weiteren ist eine konsequente Ausrichtung der IT-Services an den Kundenanforderungen notwendig. Die Herausforderung der IT erfordern ein Zusammenspiel zwischen Menschen, Prozessen und Technologie, um die IT-Services effizient, effektiv und kundenorientiert zu gestalten. Zum meistern dieser Herausforderungen ist die Einführung eines IT-Service-Management (ITSM) in Unternehmen unverzichtbar.
Aus dieser Problemstellung ergeben sich folgende Forschungsfragen: Welche Auf-gaben und Ziele umfasst das ITSM und warum ist dieses in Unternehmen notwen-dig? Welche Konzepte und Standards bestehen in der Praxis zur Umsetzung des ITSM? Das Ziel dieser Seminararbeit ist es die Notwendigkeit, die Aufgaben und Ziele sowie die bekanntesten Ansätze des ITSM umfangreich zu beschreiben.
Zunächst werden für die Seminararbeit grundlegende Begriffe definiert und erläutert. Eine begriffliche Abgrenzung von IT-Services, ITSM und Service Level Agreements (SLA) folgt. Im Anschluss der Klärung und Abgrenzung der grundlegenden Begriffe folgt eine umfangreiche Darstellung des ITSM. Hierbei wird auf die Notwendigkeit des ITSM in Unternehmen eingegangen. Außerdem werden die Ziele und Aufgaben des ITSM diskutiert. Aufbauend auf den Festlegungen der vorigen Abschnitte werden Konzepte und Standards zur Umsetzung des ITSM in der Praxis vorgestellt. Die relevantesten Konzepte mit der IT-Infrastructure Library (ITIL), der Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) und der ISO/IEC 20000 werden vorgestellt. Abschließend folgt im Fazit eine Zusammenfassung der vorigen Ergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Problemstellung und Zielsetzung
2. Begriffliche Abgrenzungen
2.1. IT-Services
2.2. IT-Service Management
2.3. Service Level Agreements
3. Darstellung des ITSM
3.1. Notwendigkeit des ITSM
3.2. Ziele und Aufgaben des ITSM
4. ITSM Konzepte und Standards
4.1. ITIL
4.2. COBIT
4.2.1. Val-IT
4.2.2. Risk-IT
4.3. ISO/IEC 20000
5. Fazit
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Michael Pavleski (Author), 2012, IT-Service Management, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204820