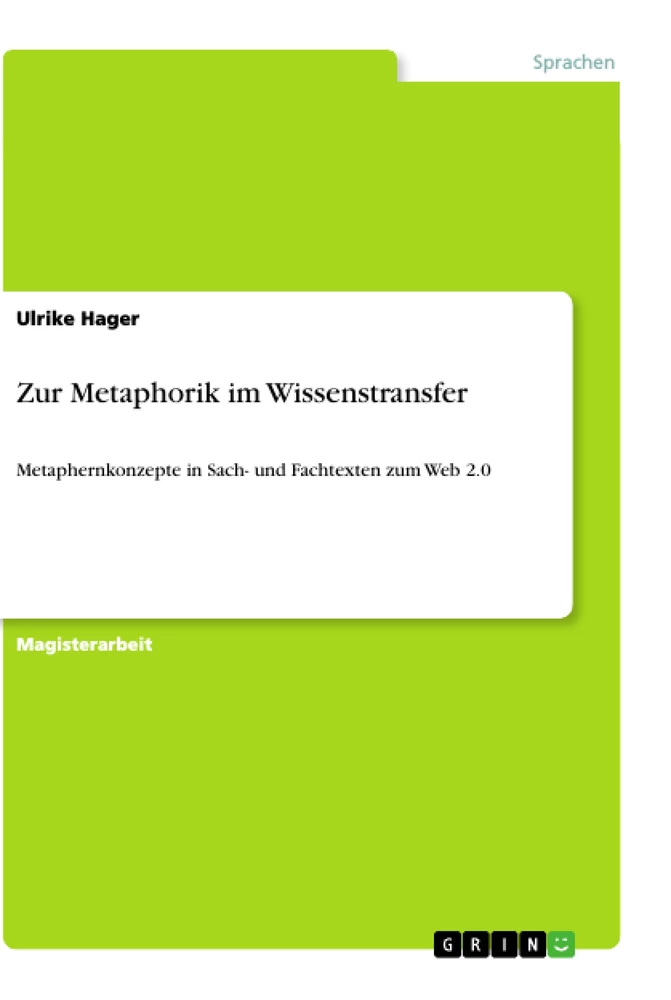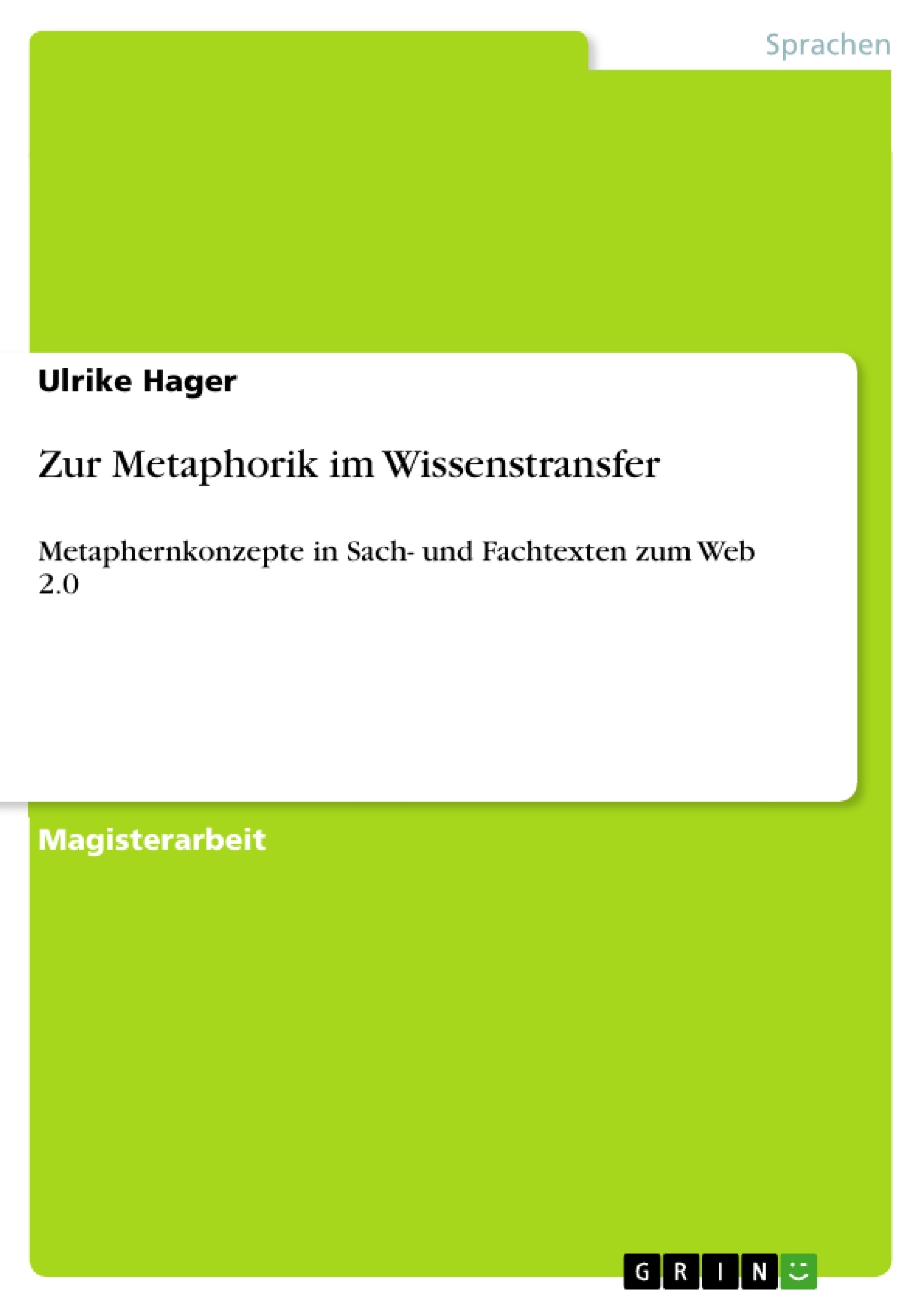Innerhalb wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Textproduktion ist eine Wissensdarstellung gefragt, die den jeweiligen Sachverhalt hinsichtlich des adressierten Rezipienten in angemessener Länge, Explizitheit und Genauigkeit darstellt. Für die Förderung des Verständnisses beim Rezipienten werden verschiedene sprachliche Mittel eingesetzt, sodass der dargestellte Sachverhalt in seiner Komplexität begriffen werden kann. Als ein solches Mittel wird seit dem Durchbruch der kognitiven Linguistik zu Anfang der 1980er Jahre auch die Metapher anerkannt. Die bedeutende Rolle der Metapher für kognitive Prozesse wie Denken, Sprechen und Handeln heben der Linguist George Lakoff und der Philosoph Mark Johnson hervor. Deren Werk „Metaphors we live by“ (1980) bildet die Grundlage der kognitiven Metapherntheorie. Nach ihrer Theorie basieren die kognitiven Prozesse auf metaphorischen Konzepten, die zur Strukturierung des Alltags aber auch anderen Lebensbereichen dienen. Neues Wissen wird in Analogie zu bekannten Konzepten verstanden. Das allgemeine Verständnis der Metapher als nicht-wörtlichen Gebrauch eines Lexems wird in dieser Theorie deutlich erweitert auf ihre Rolle beim alltäglichen Verstehensprozess.
Die Metapher gilt in der kognitiven Linguistik als ein wesentliches Werkzeug des Denkens. So ist eine beträchtliche Zahl an Publikationen zur Metapher und ihrer Bedeutung in verschiedenen Bereichen zu finden. Neben den gemeinsamen Arbeiten von Lakoff und Johnson zur Metaphorik in der Sprache des Alltags und der Philosophie, widmete sich Lakoff auch der Sprache der Politik sowie in Zusammenarbeit mit dem Linguisten Mark Turner der poetischen Metapher. Seit den 1990er Jahren wird auch die Metaphorik in Fachsprachen untersucht und Forschungsarbeiten zu populärwissenschaftlichen Diskursen haben gezeigt, dass in diesem Bereich eine Fülle von Metaphern zur Verständnisförderung eingesetzt wird. Dazu sind die Arbeiten von Liebert und Biere zur Metaphorik in der Wissenschaft und den Medien (1997) zu nennen, Jäkels Ausführungen zur Metapher in den Bereichen Geistestätigkeit, Wirtschaft, Wissenschaft und Religion (2003) sowie Baldaufs Werk zur Alltagsmetapher (1997).
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob korrespondierende Metaphern-konzepte in Fachtexten und Sachbüchern eingesetzt werden, um konkrete Wissensbereiche von Experten an Experten und von Experten an Laien zu vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Annäherung an die Metapher: Begriffsbestimmung, Typen und Funktionen
- Begriffsbestimmung „Metapher“ im Allgemeinen
- Der klassische Metaphernbegriff nach Aristoteles
- Die Bildfeldtheorie nach Harald Weinrich
- Klassifizierung der Metapher nach dem Konventionalitätsgrad
- Konventionelle Metaphern
- Neue Metapher
- Funktionen von Metaphern
- Metaphern und Kognition
- Die kognitive Linguistik und Semantik als Rahmen der kognitiven Metapherntheorie
- Die kognitive Metapherntheorie: Einleitung
- Komponenten und der Prozess der Übertragung einer konzeptuellen Metapher
- Ursprungs- und Zielbereich der konzeptuellen Metapher
- Ursachen und Motivierung für Ursprungs- und Zielbereich
- Mapping – Eigenschaften und Prinzipien der metaphorischen Übertragung
- Klassifikation von konzeptuellen Metaphern
- Die Klassifikation nach Lakoff und Johnson (1980, 2008)
- Die Klassifikation der kognitiven Metapher nach Christa Baldauf (1997)
- Kritik an der kognitiven Metapherntheorie
- Metaphern und Wissensvermittlung
- Metaphern und Modelle des Wissens
- Wissensformen und die Verortung der Metapher
- Speicherformen von Wissen: Konzepte und Schemata
- Verstehen von Metaphern: Analogiebildung und mentale Modelle
- Vermittlung von semantischem Wissen mit Texten
- Arten und Prinzipien des Wissenstransfers
- Spezifika fachinternen und fachexternen Wissenstransfers
- Merkmale des fachinternen Wissenstransfers
- Merkmale des fachexternen Wissenstransfers
- Zur Rolle von Metaphern in der Wissensvermittlung
- Metaphern und Modelle des Wissens
- Metaphernkonzepte in der fachinternen und fachexternen Wissensvermittlung
- Fragestellung
- Das Korpus
- Texte der Hochschul- und Expertenkommunikation: Lehrbücher und wissenschaftliche Artikel
- Texte der Experten-Laien-Kommunikation: Sachbücher
- Zum Untersuchungsgegenstand Web 2.0
- Methodisches Vorgehen für die Metaphernanalyse
- Darstellung der Ergebnisse
- Quantitative Aspekte zum Auftreten der Metapherntypen
- Gemeinsam verwendete Ursprungsbereiche
- Die Netz-Metapher als Ausgangspunkt verschiedener Metaphernkonzepte
- Attributsmetaphern
- Ontologische Metaphern
- Bildschematische Metaphern
- Behälter-Metapher
- Weg-Metapher
- Skalen-, Distanz- und Gleichgewichtsmetapher
- Konstellationsmetaphern
- Metaphorik des Sehens
- Wert-Metapher
- Fahrzeug-Metapher
- Transport-Metapher
- Werkzeug-Metapher
- Theater-Metapher
- Bauwerk-Metapher: Plattform
- Personifikation/Animation
- Kriegs-Metapher
- Kreative Metaphern
- Lagerhaus-Metapher
- Krankheits-Metapher
- Unterschiedlich verwendete Konstellationsmetaphern
- Sport-Metapher
- Handels-Metapher
- Bürotätigkeiten-Metapher
- Wasser- und Flut-Metapher
- Maschinen-Metapher
- Diskussion der Ergebnisse
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Metaphorik im Wissenstransfer, speziell in Sach- und Fachtexten zum Web 2.0. Ziel ist es, Metaphernkonzepte in verschiedenen Kommunikationssituationen (fachintern/fachextern) zu identifizieren und zu analysieren.
- Kognitive Metapherntheorie und ihre Anwendung auf Fachtexte
- Metaphern als Werkzeug des Wissenstransfers
- Unterschiede in der Metaphorik zwischen fachinterner und fachexterner Kommunikation
- Analyse von Metaphernkonzepten im Kontext Web 2.0
- Quantitative und qualitative Auswertung der Metapherndaten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Metaphorik im Wissenstransfer ein und skizziert den Forschungsstand sowie die Zielsetzung der Arbeit. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung von Metaphern in Fachtexten zum Web 2.0 und umreißt die methodische Vorgehensweise.
Theoretische Annäherung an die Metapher: Begriffsbestimmung, Typen und Funktionen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene metapherntheoretische Ansätze. Es werden klassische und kognitive Definitionen der Metapher diskutiert, verschiedene Typen von Metaphern klassifiziert (konventionell, neu) und deren Funktionen im sprachlichen Kontext erläutert. Die Kapitelteile befassen sich mit Aristoteles' klassischer Metapherntheorie, Weinrichs Bildfeldtheorie und der Klassifizierung nach dem Konventionalitätsgrad.
Metaphern und Kognition: Das Kapitel widmet sich der kognitiven Metapherntheorie, die Metaphern als kognitive Prozesse versteht. Es beschreibt die Komponenten konzeptueller Metaphern (Ursprungs- und Zielbereich, Mapping), deren Klassifizierung nach verschiedenen Ansätzen (Lakoff & Johnson, Baldauf) und kritische Auseinandersetzungen mit der Theorie.
Metaphern und Wissensvermittlung: Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Metaphern in der Wissensvermittlung. Es beleuchtet die Verbindung zwischen Metaphern, Wissensmodellen, Analogiebildung und mentalen Modellen. Es differenziert zwischen fachinternem und fachexternem Wissenstransfer und deren spezifischen Merkmalen, um die Funktion von Metaphern in beiden Kontexten zu beleuchten.
Metaphernkonzepte in der fachinternen und fachexternen Wissensvermittlung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, die Auswahl des Korpus (Lehrbücher, wissenschaftliche Artikel, Sachbücher zum Web 2.0) und das methodische Vorgehen zur Metaphernanalyse. Es skizziert die Forschungsfrage und stellt den Untersuchungsgegenstand "Web 2.0" vor.
Schlüsselwörter
Metapher, Wissenstransfer, kognitive Linguistik, Web 2.0, Fachkommunikation, Experten-Laien-Kommunikation, Metaphernanalyse, konzeptuelle Metapher, Ursprungs- und Zielbereich, Konventionalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Metaphern im Wissenstransfer: Eine Analyse von Fach- und Sachtexten zum Web 2.0"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verwendung von Metaphern im Wissenstransfer, speziell in Sach- und Fachtexten zum Thema Web 2.0. Der Fokus liegt auf der Identifizierung und Analyse von Metaphernkonzepten in verschiedenen Kommunikationssituationen (fachintern/fachextern).
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Metaphernkonzepte in fachinternen und fachexternen Kommunikationssituationen zu identifizieren und zu analysieren. Dabei werden die kognitive Metapherntheorie angewendet, die Rolle von Metaphern im Wissenstransfer beleuchtet und Unterschiede in der Metaphorik zwischen den Kommunikationstypen untersucht. Die quantitative und qualitative Auswertung der Metapherndaten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene metapherntheoretische Ansätze, darunter die klassische Metapherntheorie (Aristoteles), die Bildfeldtheorie (Weinrich) und vor allem die kognitive Metapherntheorie (Lakoff & Johnson, Baldauf). Die kognitive Linguistik und Semantik bilden den Rahmen für die Analyse.
Welche Arten von Metaphern werden betrachtet?
Die Arbeit differenziert zwischen konventionellen und neuen Metaphern und klassifiziert diese weiter anhand verschiedener Kriterien. Es werden verschiedene Kategorien von Metaphern untersucht, darunter Attributsmetaphern, ontologische Metaphern, bildschematische Metaphern (z.B. Behälter-, Weg-Metapher), Konstellationsmetaphern (z.B. Netz-, Fahrzeug-, Kriegs-Metapher) und kreative Metaphern.
Wie ist der Korpus aufgebaut?
Der Korpus besteht aus Texten der Hochschul- und Expertenkommunikation (Lehrbücher, wissenschaftliche Artikel) und Texten der Experten-Laien-Kommunikation (Sachbücher) zum Thema Web 2.0. Die Auswahl der Texte erlaubt den Vergleich der Metaphorik in fachinternen und fachexternen Kontexten.
Welche Methode wird für die Metaphernanalyse verwendet?
Die Arbeit beschreibt ein methodisches Vorgehen für die Metaphernanalyse, das sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte umfasst. Die quantitative Analyse konzentriert sich auf das Auftreten verschiedener Metapherntypen. Die qualitative Analyse untersucht die verwendeten Metaphernkonzepte und deren Funktion im Kontext des Wissenstransfers.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse werden sowohl quantitativ (Häufigkeit verschiedener Metapherntypen) als auch qualitativ (Analyse der verwendeten Metaphernkonzepte und deren Funktion) dargestellt und diskutiert. Die Analyse konzentriert sich auf gemeinsam und unterschiedlich verwendete Metaphern in fachinternen und fachexternen Texten zum Web 2.0.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Rolle von Metaphern im Wissenstransfer im Kontext von Web 2.0 und beleuchtet die Unterschiede in der Metaphorik zwischen fachinternen und fachexternen Kommunikationssituationen. Ein Ausblick auf weitere Forschungsfragen rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Metapher, Wissenstransfer, kognitive Linguistik, Web 2.0, Fachkommunikation, Experten-Laien-Kommunikation, Metaphernanalyse, konzeptuelle Metapher, Ursprungs- und Zielbereich, Konventionalität.
- Quote paper
- Ulrike Hager (Author), 2012, Zur Metaphorik im Wissenstransfer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204907