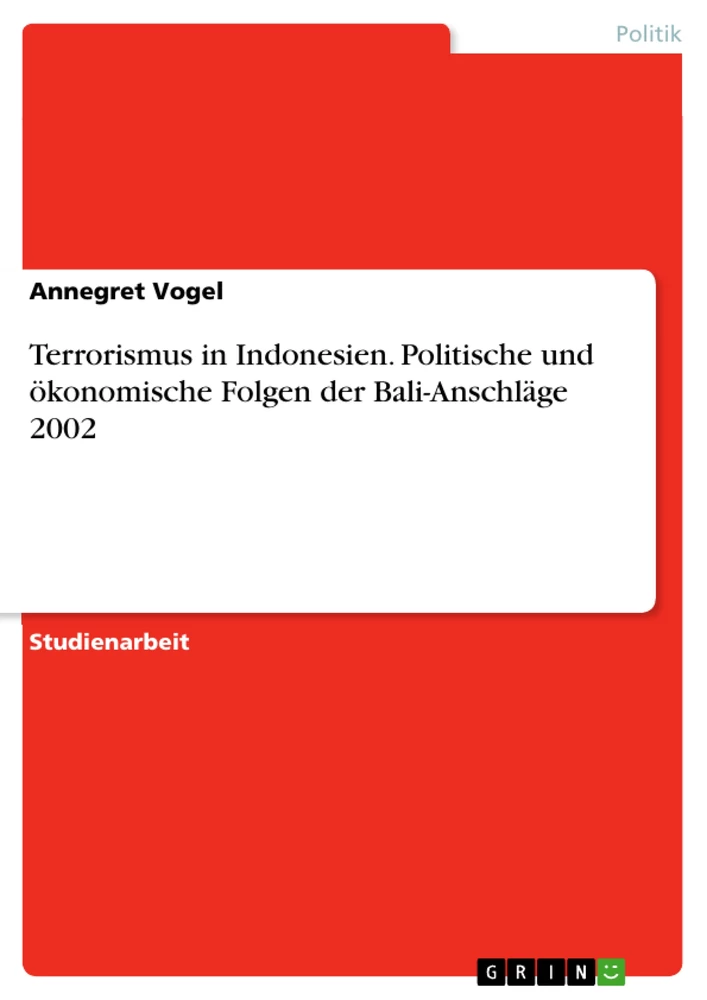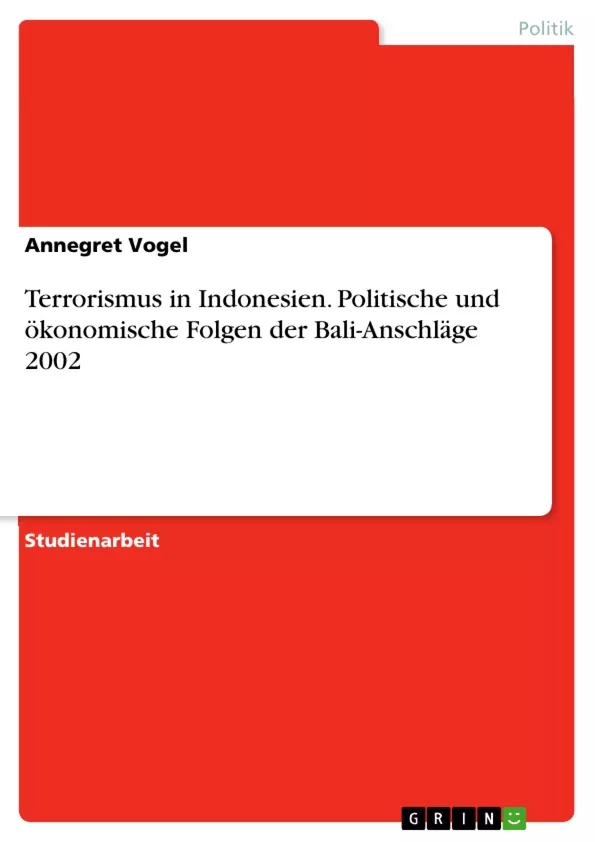Wie gestalten sich die politischen und ökonomischen Konsequenzen der Bali-Anschläge für Indonesien im Hinblick auf den Prozess der Demokratisierung?
Die Attentate auf die Ferieninsel Bali im Oktober 2002, bei denen 202 Menschen ums Leben kamen, gelten als verheerendster terroristischer Anschlag in der Geschichte Indonesiens.
Das Ereignis traf Indonesien in der kritischen Übergangsphase zur Demokratie und schädigt das internationale Ansehen sowie die schon durch die Ostasienkrise 1997/98 stark angegriffene Wirtschaft des Landes. Auch begünstigt die innenpolitische Instabilität, verbunden mit einer schwachen Regierung, das Aufkommen von religiös motivierter Gewalt.
Um das Attentat von Bali 2002 als terroristischen Akt einzuordnen, scheint es zunächst sinnvoll, den Begriff des „Terrorismus“ zu definieren. Folgend wird der Demokratisierungsprozess, in dem sich Indonesien befand (und immer noch befindet), hinsichtlich politischer, wirtschaftlicher und sozialer Gesichtspunkte beschrieben. Dabei wird auch auf die politische Gewalt und islamistische Gruppierungen, insbesondere die Jemaah Islamiyah, eingegangen.
Nach der Hinführung werden konkrete Folgen der Bali-Attentate für Indonesien untersucht. Neben den ökonomischen Auswirkungen, mit dem Schwerpunkt auf der touristischen Entwicklung, werden die politischen Reaktionen analysiert. Das besondere Augenmerk liegt hierbei auf den wechselseitigen Beziehungen mit den anderen ASEAN-Staaten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Aufbau
1.3 Forschungsstand
2. Definition Terrorismus a
3. Indonesien zwischen Autoritarismus und Demokratie
4. Folgen der Anschläge auf Bali 2002
4.1 Politisch
4.2 Ökonomisch
5. Schlussbetrachtung
6. Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Annegret Vogel (Author), 2012, Terrorismus in Indonesien. Politische und ökonomische Folgen der Bali-Anschläge 2002, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205002