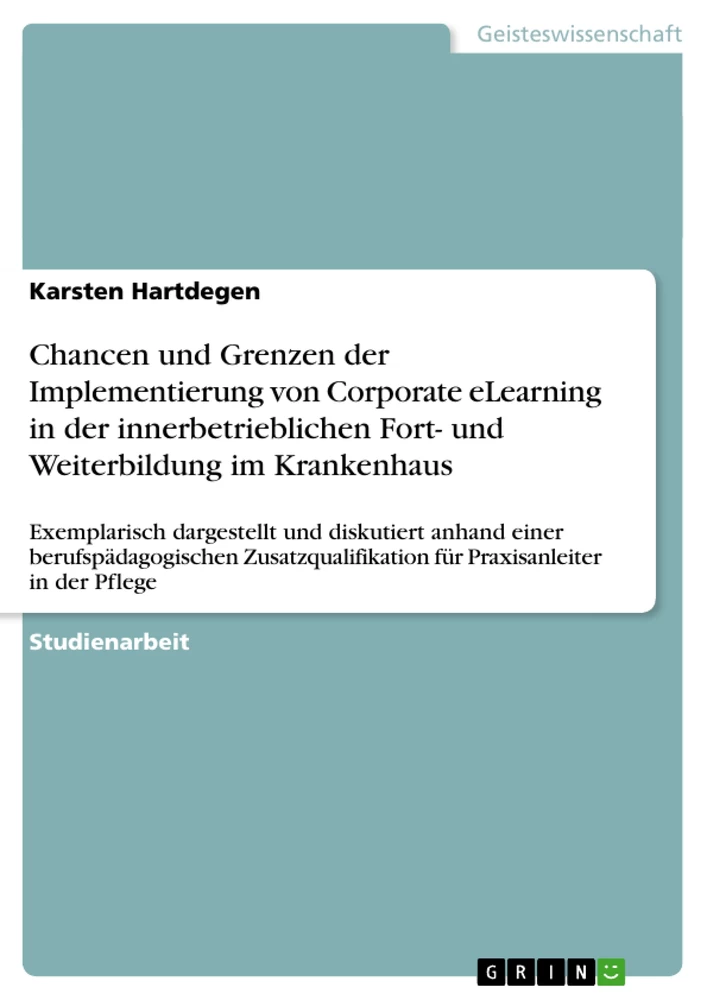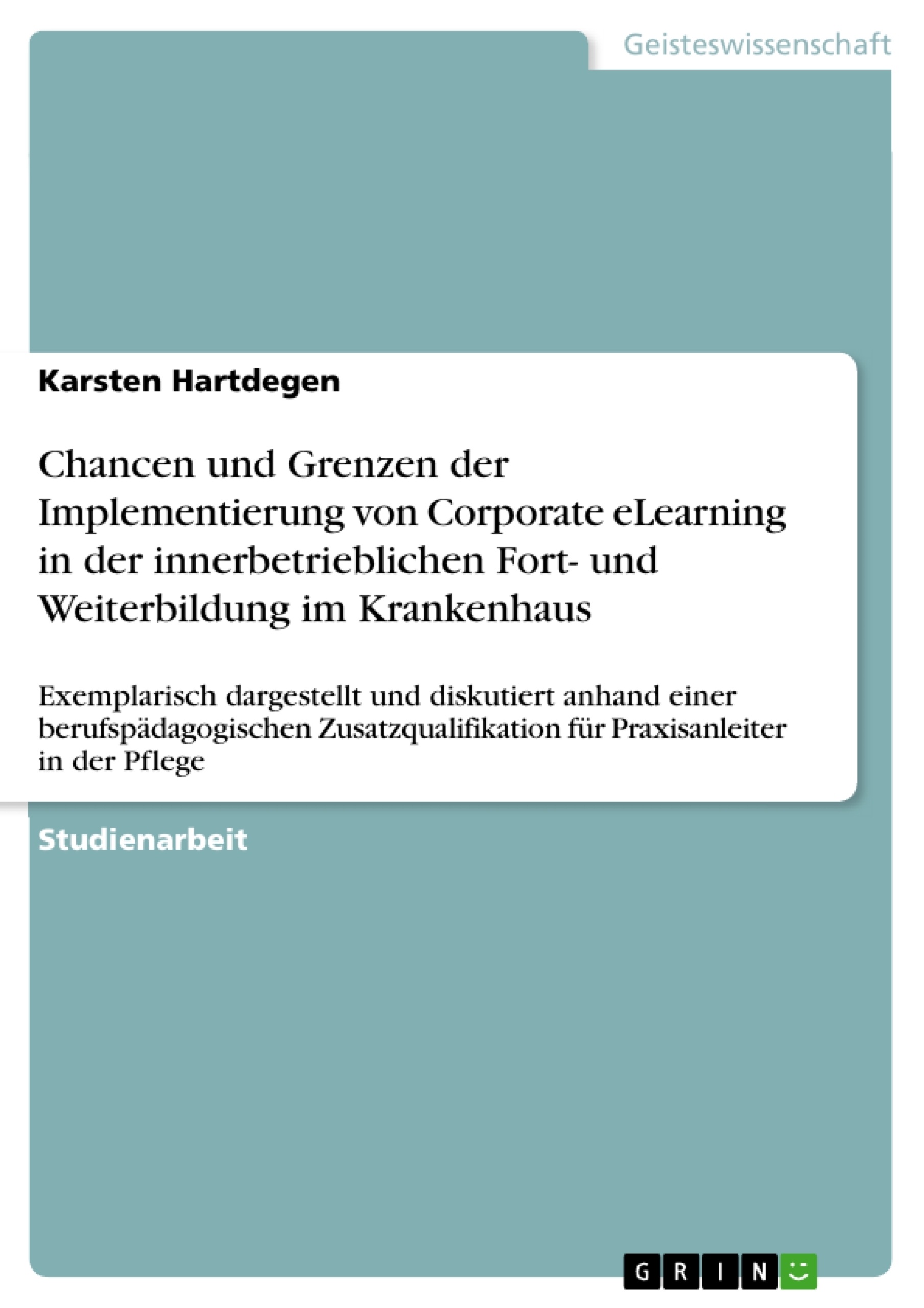Im Gesundheitssystem ist durch die stetige wissenschaftliche Weiterentwicklung der Medizin und Pflege und aufgrund des technischen Fortschritts ein so großer Fort- und Weiterbildungsbedarf wie in kaum einem anderen Bereich vorhanden (Erbe, 2010; Boucsein, 2010; Renken-Olthoff, 2010; Großkopf 2010).
Hinzu kommt, dass in den Krankenhäusern ein zunehmender kaufmännischer Einfluss auf die medizinische und pflegerische Therapie spürbar ist. Der immense Kostendruck nach Einführung der mit dem Gesundheitsreformgesetz 2000 initiierten DRGs als reines Vergütungs- und Entgeltsystem führt dazu, dass die Verweildauer der Patienten möglichst kurz, die Ausgaben pro Prozedur und diagnostischer Intervention so gering wie nur denkbar sein müssen.
Diese Veränderungen führen zwangsläufig zu einer Verstärkung des innerbetrieblichen Controllings und zu einer multiprofessionellen Prozesssteuerung durch Einführung von Clinical Pathways und Case Management. Um als Krankenhausbetrieb überleben zu können, müssen sektorenübergreifende Kooperationen und Versorgungsstrukturen eingerichtet sein, was bei Pflegekräften zu einer umfassenden Veränderung der Rahmenbedingungen ihrer Arbeit einschließlich Arbeitsabläufe und organisatorischer Strukturen führt (Reinhardt, 2006, S. 34 f.; Bohnes et al., 2008, S. 218; Westermann Redaktion, 2008, S. 244 f.).
Die zentralen Herausforderungen für eine aktivierende Gesundheitspolitik bestehen deshalb darin, sowohl Qualität als auch Effizienz zu erhöhen. Waren in den letzten Jahren die öffentlichen und politischen Diskussionen sehr stark geprägt von Kostendruck-Argumenten und von dem Streit um Rationalisierungen und Rationierungen, so steht das Gesundheitswesen nun vor einer nachhaltigen Innovations- und Qualifizierungswelle (MFJFG, 2000, S. 66 ff.; Stempel, 2010).
Aus diesen Gründen entsteht nicht nur ein hoher Bedarf an gut aus-, fort- und weitergebildeten Ärzten, sondern auch an entsprechend gut ausgebildeten Pflegekräften, welche diese Strukturveränderungen und Kostenreduzierungen umsetzen müssen. Der Bedarf an einer kostengünstigen, effizienten und effektiven Weiterbildung spielt in diesem Kontext eine große Rolle. Hinzu kommen Veränderungen in den Anforderungen aufgrund von zahlreichen neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen und Auflagen (Pflege heute, 2007, S. 47 f.).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Allgemeine Analyse der Ausgangslage im Gesundheitssystem, an Krankenhäusern und in der Weiterbildung von Pflegefachkräften
- 3 Ausgangslage E-Learning in Krankenhäusern
- 4 Bedarfsanalyse und erwarteter Nutzen des Blended Learning-Angebotes für die Krankenhäuser
- 5 Ökonomische und strukturelle Dimensionen der Umsetzung des Projektes am Bildungszentrum im Kreis Ahrweiler
- 6 Nutzen der Implementierung des Blended Learning-Angebotes für Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens
- 7 Grenzen des Blended Learning-Ansatzes in Krankenhäusern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Chancen, Grenzen und Auswirkungen von Corporate E-Learning in der Fort- und Weiterbildung im Krankenhaus. Anhand der Weiterbildungsmaßnahme zum Praxisanleiter in der Pflege am Bildungszentrum im Kreis Ahrweiler wird die Thematik veranschaulicht.
- Der zunehmende Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal im Kontext des demografischen Wandels und des Kostendrucks im Gesundheitssystem.
- Die Herausforderungen des Wissensmanagements in Krankenhäusern und die Möglichkeiten von E-Learning und Blended Learning.
- Die ökonomischen und strukturellen Aspekte der Implementierung von Blended Learning-Programmen.
- Der Nutzen von Blended Learning für Lernende, Ausbilder und Institutionen im Gesundheitswesen.
- Die Grenzen des Blended Learning-Ansatzes und mögliche Lösungsansätze.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Die Einleitung beleuchtet den hohen Fort- und Weiterbildungsbedarf im Gesundheitssystem, insbesondere im Bereich der Pflege. Der Kostendruck durch die Einführung der DRGs und die damit verbundenen Strukturveränderungen in den Krankenhäusern werden als zentrale Herausforderungen dargestellt.
- Kapitel 2: Allgemeine Analyse der Ausgangslage im Gesundheitssystem, an Krankenhäusern und in der Weiterbildung von Pflegefachkräften Dieses Kapitel beleuchtet den demografischen Wandel und die steigende Anzahl von chronisch Kranken. Die zunehmende Belastung von Pflegekräften, der Mangel an qualifizierten Bewerbern und die Notwendigkeit von Spezialisierung in den Pflegeberufen werden als wichtige Faktoren beschrieben.
- Kapitel 3: Ausgangslage E-Learning in Krankenhäusern Die Dynamik des Gesundheitsmarktes und die Kluft zwischen den im Bildungssystem erworbenen Kenntnissen und den Anforderungen der Arbeitswelt unterstreichen die Notwendigkeit von lebenslangem Lernen. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Wissensmanagement in Krankenhäusern, die Herausforderungen der Wissensgenerierung und -vermittlung, sowie die Chancen von E-Learning- und Blended Learning-Maßnahmen.
- Kapitel 4: Bedarfsanalyse und erwarteter Nutzen des Blended Learning-Angebotes für die Krankenhäuser Dieses Kapitel analysiert die Bedürfnisse von Krankenhausbetriebsleitungen und Praxisanleitern in Bezug auf Fort- und Weiterbildung. Die gesetzliche Verpflichtung zum Qualitätsmanagement und die veränderten Ausbildungsziele in den Pflegeberufen werden als wichtige Treiber für die Einführung von Blended Learning dargestellt.
- Kapitel 5: Ökonomische und strukturelle Dimensionen der Umsetzung des Projektes am Bildungszentrum im Kreis Ahrweiler Das Kapitel beschreibt die konkrete Umsetzung der Blended Learning-Weiterbildung zum Praxisanleiter am Bildungszentrum im Kreis Ahrweiler. Die Auswahl des Blended Learning-Konzeptes, die Entwicklung des Curriculums und die Verwendung der Lernplattform ILIAS werden detailliert dargestellt.
- Kapitel 6: Nutzen der Implementierung des Blended Learning-Angebotes für Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens Dieses Kapitel veranschaulicht den Nutzen von Blended Learning für Lernende, Ausbilder und Institutionen im Gesundheitswesen. Der Beitrag zur fachlichen Kompetenzentwicklung, die Steigerung der Motivation, die Reduzierung der Kosten und die Möglichkeit der zeitnahen Problemlösung werden als wichtige Vorteile hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern E-Learning, Blended Learning, Fort- und Weiterbildung, Wissensmanagement, Pflegeberufe, Praxisanleiter, Krankenhaus, Gesundheitssystem, demografischer Wandel, DRGs und Personalentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist E-Learning in Krankenhäusern wichtig?
Aufgrund des technischen Fortschritts und Kostendrucks (DRGs) benötigen Krankenhäuser effiziente, zeitsparende Wege, um Personal kontinuierlich fortzubilden.
Was ist Blended Learning für Pflegekräfte?
Blended Learning kombiniert Online-Lernphasen (z.B. via ILIAS) mit Präsenzveranstaltungen, was die Vereinbarkeit von Schichtdienst und Weiterbildung verbessert.
Welchen Nutzen bietet E-Learning den Krankenhäusern?
Es reduziert Fortbildungskosten, ermöglicht zeitnahe Problemlösungen im Arbeitsalltag und sichert eine gleichbleibende Qualität der Wissensvermittlung.
Was sind die Grenzen von E-Learning im Gesundheitswesen?
Grenzen liegen oft in der mangelnden IT-Infrastruktur, fehlender Medienkompetenz älterer Mitarbeiter oder der Schwierigkeit, praktische pflegerische Handgriffe rein digital zu vermitteln.
Welche Rolle spielen DRGs bei der Fortbildung?
Das DRG-Vergütungssystem erhöht den Kostendruck, weshalb Weiterbildungen so effizient wie möglich sein müssen, um die Verweildauer der Patienten und die Ausgaben gering zu halten.
- Quote paper
- Karsten Hartdegen (Author), 2011, Chancen und Grenzen der Implementierung von Corporate eLearning in der innerbetrieblichen Fort- und Weiterbildung im Krankenhaus , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205111