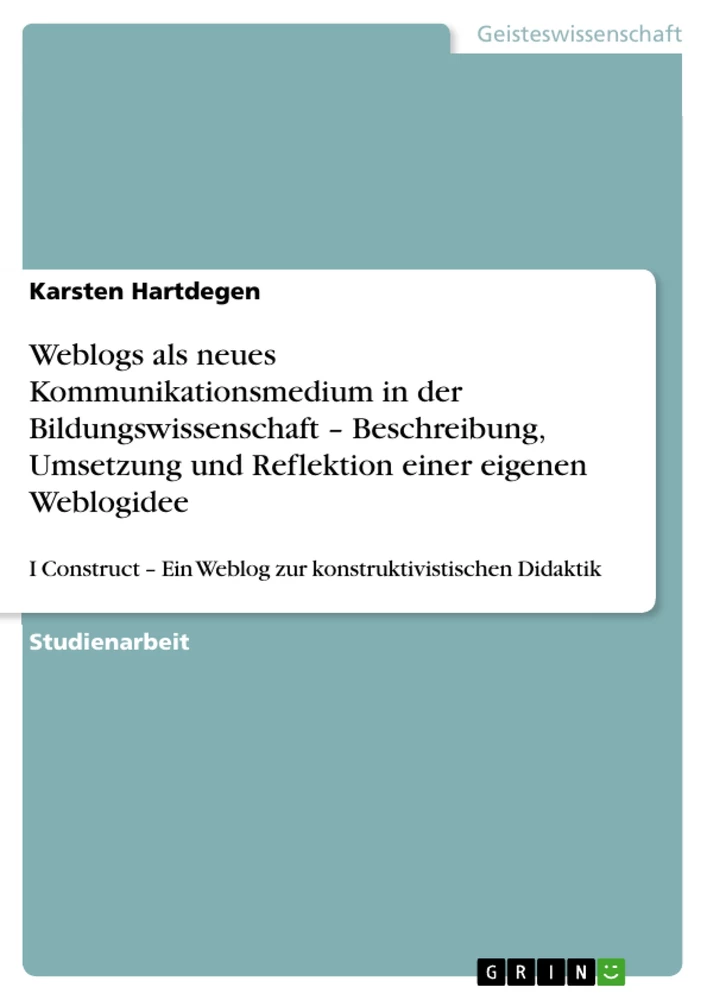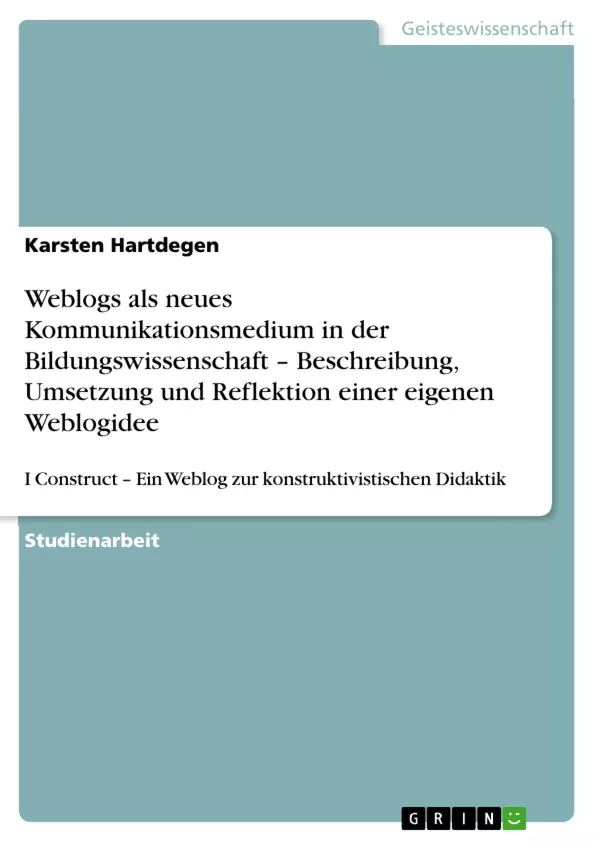In meiner Hausarbeit werde ich die Konzeptidee zu meinem Weblog „I Construct“ vorstellen und im Anschluss die Umsetzung reflektieren. Zu Beginn in dieser Einleitung werde ich kurz Weblogs beschreiben und deren allgemeine Konzeption beleuchten, um dann zu meinem Weblog überzuleiten.
Ich werde mich bei meiner Ausarbeitung an die Struktur des Lehrgebietes halten, welche bereits im Inhaltsverzeichnis deutlich geworden ist. Verwenden werde ich hierzu die (unten in der Abbildung gezeigte) relativ konkreten Verfahrensschritte des Instructional Design, welches als systematisches Vorgehen bei der Entwicklung, dem Einsatz und der Evaluation von (computerunterstützten) Lernangeboten definiert werden kann (vgl. Reinmann 2008, S. 39f.; e-teaching.org).
Zu Beginn eines jeden Kapitels werde ich den jeweiligen Verfahrensschritt kurz erwähnen.
Weblogs (auch Blogs genannt) finden sich zunehmend als feste Bestand-teile von Online-Portalen. Benutzer von Weblogs notieren eigene Gedanken, Berichte und Fundstücke aus dem Internet. Weblogs können von Einzelpersonen oder Gruppen betrieben werden, wobei die Nutzer entweder unter ihrem richtigen Namen schreiben. Weblogs unterscheiden sich von Kommunikationsplattformen wie Foren dadurch, dass der aktuellste Eintrag an den Anfang der Webseite in umgekehrt chronologischer Reihenfolge gestellt wird (vgl. e-teaching 2009; Wienold/Kerres 2003, S. 323 ff.; Gil-mour 2009; Winter 2009; Reichmayr 2006).
Teilweise gibt es die Möglichkeit, die Beiträge zu kommentieren. Die Verlinkung des Weblogs untereinander über Trackballs und Blogrolls als auch über Aktualisierungstools wie Newsticker und RSS-Feedreader fördern die Popularität und Akzeptanz. Charakteristisch für ein Weblog ist ein Archiv, mit dem ältere, nicht mehr auf der Titelseite erscheinende Einträge gefunden werden können (vgl. e-teaching 2009).
Das laufende Update von Weblogs ist ein kennzeichnendes Merkmal des Genres und unterscheidet Weblogs von vielen anderen Webseiten. Der neue Inhalt ist durch das Datum für den Besucher gleich ersichtlich (vgl. Herring et al. 2004). Charakteristisch ist, dass Weblogs aus einzelnen, rückwärts chronologisch sortierten Einträgen bestehen (vgl. Röll 2005, S. 12).
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Weblogs - Definition, Funktionen und Charakte- ristika
3. Konzept und Instruktionsdesign meines Weblogs
3.1 Thema des Weblogs
3.2 Funktionen, Motive und Nützlichkeit des Weblogs
4. Evaluation der Implementation und Bewertung der Idee
Literatur- und Linkverzeichnis
Anhang
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Weblogs „I Construct“?
Das Weblog befasst sich mit bildungswissenschaftlichen Themen und nutzt das Instructional Design als systematisches Vorgehen für die Entwicklung von Lernangeboten.
Wie unterscheiden sich Weblogs von Foren?
Weblogs stellen den aktuellsten Eintrag an den Anfang der Webseite in umgekehrt chronologischer Reihenfolge dar, im Gegensatz zu klassischen Diskussionsforen.
Was sind typische Merkmale eines Weblogs?
Charakteristisch sind rückwärts chronologisch sortierte Einträge, Kommentarfunktionen, Verlinkungen über Blogrolls sowie RSS-Feeds und ein Archiv für ältere Beiträge.
Was versteht man unter Instructional Design?
Instructional Design ist das systematische Vorgehen bei der Entwicklung, dem Einsatz und der Evaluation von (computerunterstützten) Lernangeboten.
Welche Rolle spielen RSS-Feeds für Blogs?
RSS-Feeds fördern die Popularität und Akzeptanz, da sie Nutzer über Aktualisierungen auf dem Laufenden halten.
- Quote paper
- Karsten Hartdegen (Author), 2009, Weblogs als neues Kommunikationsmedium in der Bildungswissenschaft – Beschreibung, Umsetzung und Reflektion einer eigenen Weblogidee, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205116