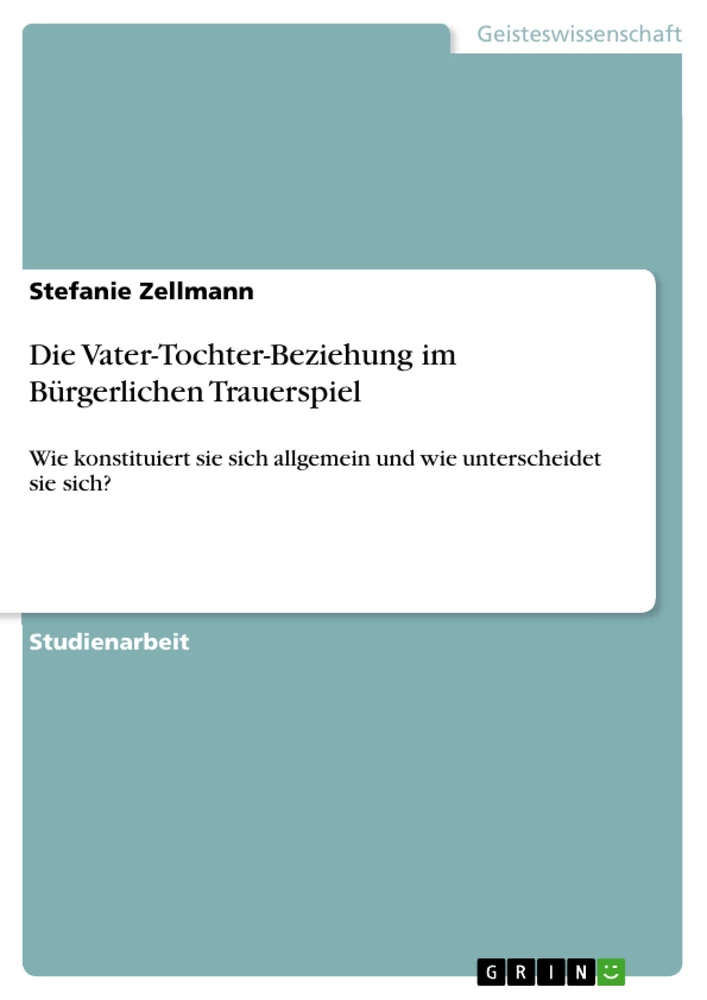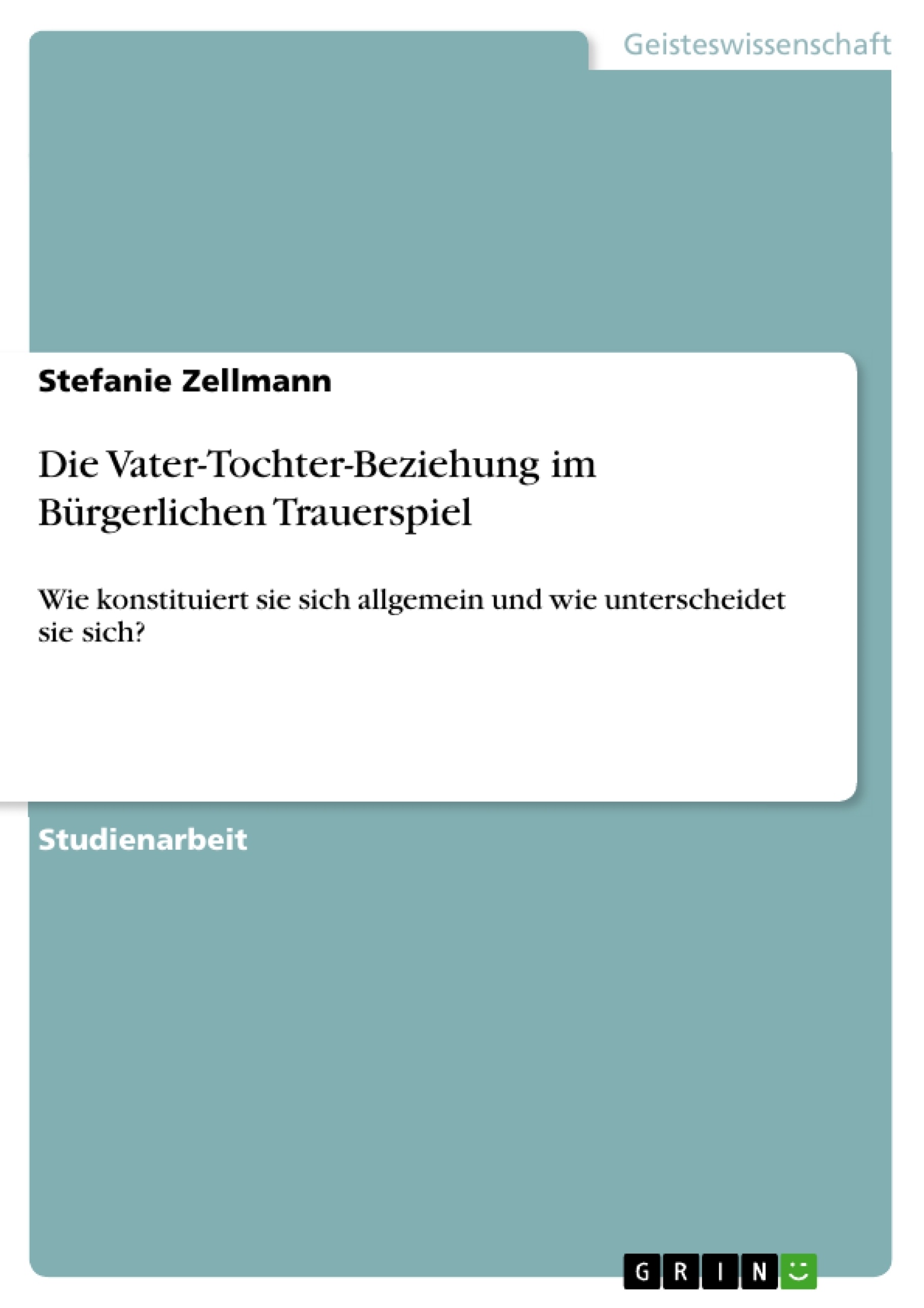In dieser Arbeit wird die Frage geklärt, wie sich die Vater-Tochter-Beziehung im Bürgerlichen Trauerspiel des 18. Jahrhunderts konstituiert und anhand der Dramen "Emilia Galotti" und "Kabale und Liebe" gezeigt, wie sie sich unterscheidet.
Aus der Gegenüberstellung der Beziehungen zwischen Vater und Tochter beider Dramen werden die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Vater-Tochter-Beziehung herausgearbeitet und erörtert, wie unterschiedlich sich diese Rollenkonstellation auswirken kann.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das bürgerliche Trauerspiel und das Vater-Tochter-Verhältnis
2.1 Zeitgeschichtlicher Kontext
2.2 Die Vater-Tochter-Beziehung
3. Zwei Arten der Vater-Tochter-Beziehung
3.1 Odoardo und Emilia Galotti
3.2 Vater und Luise Miller
4. Beide Vater-Tochter-Beziehungen im Vergleich
4.1 Gemeinsamkeiten
4.2 Unterschiede
5. Fazit
Literatur-/Materialverzeichnis
Primärliteratur
Sekundärliteratur
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Vater-Tochter-Verhältnis in 'Emilia Galotti' dargestellt?
Die Beziehung zwischen Odoardo und Emilia ist durch strenge Moralvorstellungen geprägt, die letztlich in der tragischen Tötung der Tochter gipfeln.
Was unterscheidet die Beziehung in 'Kabale und Liebe' davon?
In Schillers Werk zeigt Vater Miller eine emotionalere und teils schützendere Haltung gegenüber Luise, auch wenn er ebenfalls in den Zwängen der Ständegesellschaft gefangen ist.
Welche Gemeinsamkeiten haben die Väter in bürgerlichen Trauerspielen?
Väter fungieren oft als moralische Instanz und Repräsentanten bürgerlicher Werte gegen den korrupten Adel, was zu Konflikten mit dem Glück der Tochter führt.
Was war der zeitgeschichtliche Kontext dieser Dramen?
Das 18. Jahrhundert war geprägt vom Aufstieg des Bürgertums und der Forderung nach moralischer Autonomie gegenüber absolutistischen Herrschaftsstrukturen.
Warum endet das Vater-Tochter-Verhältnis oft tödlich?
Die Unvereinbarkeit von Tugendanspruch und realer Bedrohung durch den Adel lässt den Vätern im literarischen Modell oft nur den Tod der Tochter als "Rettung" der Ehre.
- Quote paper
- Stefanie Zellmann (Author), 2011, Die Vater-Tochter-Beziehung im Bürgerlichen Trauerspiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205168