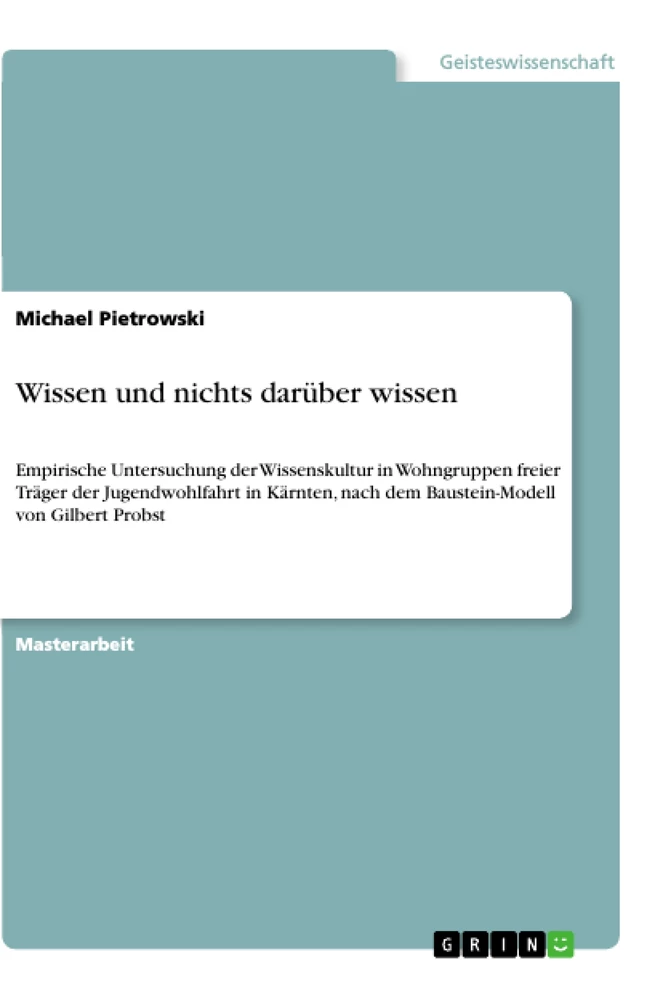In dieser Master-Thesis wird „WISSEN“ als Forschungsgegenstand aufgegriffen.
Drei Wohngemeinschaften freie Träger der Jugendwohlfahrt werden thematisch auf ihren Umgang mit Wissen in den Wohngemeinschaften hin untersucht. Die Wissenskultur der Wohngemeinschaften steht damit im Vordergrund dieser Untersuchung. Dabei nimmt die von Richard Günder 2011 in der Monografie „Praxis und Methode der Heimerzeihung“ veröffentlichte Erkenntnis, dass das Ausbildungswissen der Mitarbeiter der stationären Einrichtungen der Jugendwohlfahrt nicht auszureichen scheint, einen erheblichen Einfluss auf diese Arbeit.
In Bezugnahme des im Wissensmanagements entwickelten „Baustein-Modells“ von Gilbert Probst (2010) wird mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring untersucht, wie Wissen in den Wohneinrichtungen identifiziert, erworben, entwickelt, verteilt, genutzt, bewahrt und bewertet wird und ob die Wohneinrichtungen klare Wissens-ziele definieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Zielstellungen der Arbeit
1.2. Aufbau der Arbeit
2. Theoretische Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand
2.1. Wissensdimensionen
2.2. Daten, Informationen und Wissen
2.3. Implizites Wissen, explizites Wissen
2.4. Organisationswissen, individuelles, kollektives Wissen
2.5. Volatilität des Wissens
2.6. Wissensmanagement
2.6.1. Management
2.7. Entwicklungslinien des Wissensmanagements
2.8. Wissensmanagement und Organisationales Lernen
2.9. Organisationales Lernkonzept von Senge (1996)
2.9.1. Personal Mastery
2.9.2. Die Mentalen Modelle
2.9.3. Gemeinsame Vision
2.9.4. Team-Lernen
2.9.5. Systemdenken
2.10. Wissen und Organisationskultur
2.11. Wissens-Bausteine
2.11.1. Wissensziele definieren
2.11.2. Wissen identifizieren
2.11.3. Wissen erwerben
2.11.4. Wissen entwickeln
2.11.5. Wissen verteilen
2.11.6. Wissen nutzen
2.11.7. Wissen bewahren
2.11.8. Wissen bewerten
2.12. Zusammenfassung der bisherigen Themen
3. Die Jugendwohlfahrt in Kärnten
3.1. Leistungen gemäß den Jugendwohlfahrtsgesetzen
3.2. Koordination der Jugendwohlfahrt
3.3. Die stationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
3.4. Die Leistungen in Wohngruppen und Wohngruppenverbänden
3.5. Das pädagogische Personal
3.5.1. Ausbildungsprobleme der Mitarbeiter in stationären Einrichtungen
3.5.2. Rollenidentifikation der Pädagogen
3.6. Teamarbeit/ Teamsitzung
4. Fazit: Wissensarbeit in stationären Einrichtungen
5. Erarbeitung eines Forschungsrahmens für drei stationäre Einrichtungen
5.1. Methodischer Zugang
5.2. Auswahl und Vorstellung der Wohngruppen
5.3. Auswahl und Vorstellung der Interviewpartner
5.3.1. WG(1)
5.3.2. WG(2)
5.3.3. WG(3)
5.4. Durchführung der Interviews (Entstehungssituation)
5.5. Frageleitfäden
5.6. Auswertung
6. Ergebnisse: Wissenskultur in stationären Einrichtung der Jugendwohlfahrt in Kärnten in der Praxis
6.1. Die Herausforderung der Arbeit
6.2. Wissen erwerben
6.2.1. Wissen über den neuen Mitarbeiter erwerben
6.2.2. Wissenserwerb durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung
6.2.3. Konklusion
6.3. Wissen entwickeln und teilen
6.3.1. In Fortbildungen Wissen entwickeln
6.3.2. Wissen in Supervisionen und Mentoring entwickeln
6.3.3. Teamsitzungen als Zeit der Wissensvermittlung
6.3.4. Mentoring als Möglichkeit der Wissensentwicklung
6.3.5. Wissen im Geschehen entwickeln und im Team teilen
6.3.6. Multiplikation und Speicherung von Wissen über die neuen Medien
6.3.7. Konklusion
6.4. Wissensziele
6.4.1. Konklusion
6.5. Wissen bei den Mitarbeitern identifizieren
6.5.1. Der Schlüsselmitarbeiter
6.5.2. Gruppenwissen bewerten
6.5.3. Konklusion
6.6. Wissen nutzen
6.6.1. Differenzierte Nutzung des Wissens
6.6.2. Konklusion
6.7. Wissen bewahren
6.7.1. Konklusion
7. Schlussteil
7.1. Fazit
7.2. Kritische Auseinandersetzung und Ausblick
8. Literaturverzeichnis
9. Abbildungsverzeichnis
10. Anhang
1. Einleitung
Die professionelle Arbeit in den stationären Einrichtungen der Jugendwohlfahrt umfasst mannigfaltige Aufgaben, die in Kärnten von der Landesregierung in sehr differenzierten Leistungskatalogen beschrieben worden sind. Alle Aufgaben münden in der Absicht, dem Kind, dem Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen ein Milieu zu gestalten, in dem er die bestmögliche Pflege erhält und ihm die bestmöglichen Entwicklungschancen gewährleistet werden. Neben den alltäglichen manuellen Arbeiten, wie der Zubereitung des Essens, dem Putzen und Waschen steht die Wissensvermittlung im Zentrum dieser Arbeit und über allen anderen handwerklichen, bürokratischen und beraterischen Tätigkeiten (vgl. Kärntner Landesregierung, 2008; vgl. Kap. 3.1). In dieser Untersuchung wird grundsätzlich die These vertreten, dass die professionelle Arbeit in den stationären Einrichtungen der Jugendwohlfahrt Wissensarbeit ist. Das Arbeitsvorhaben dieser Arbeit hat sich, ausgehend von der genannten These und in der Auseinandersetzung mit dem Thema „Umgang mit Mitarbeiterwissen“ herauskristallisiert und wie von selber seine Konturen entwickelt.
Trotz der Eigendynamik dieser Arbeit waren Voraussetzungen vonnöten. Die notwendigste Voraussetzung war, so trivial es klingt, meine Neugierde stillen zu wollen, ob sich die Mitarbeiter der stationären Einrichtungen meiner These überhaupt bewusst sind. Die Beantwortung dieser Frage zieht meiner Ansicht nach Fragen in zwei großen Bereiche nach sich: (1) Wenn die Mitarbeiter in den stationären Einrichtungen ihre Arbeit als Wissensarbeit wahrnehmen, wie wird dann mit dem Wissen im Sinne einer Wissenskultur umgegangen? (2) Wenn die Mitarbeiter das Thema Wissen in ihrer Arbeit vernachlässigen bzw. es nicht bewusst aufgreifen, was hat das für Folgen für die Ergebnisse und Erfolge ihrer Arbeit?
Eine weitere Voraussetzung für diese Arbeit waren meine eigenen praktischen Erfahrungen in diesem Bereich. Ich arbeite seit Jahren in stationären Einrichtungen der Jugendwohlfahrt. Bei der Arbeit in diesem Bereich handelt es sich um Teamarbeit. In den Teams sind verschiedene Berufsgruppen vertreten, die Mitarbeiter haben zum Teil zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen besucht und damit sehr unterschiedliche professionelle Kompetenzbereiche aufgebaut (vgl. Günder, 2011; Kap. 3.5) . Ich sehe auf dieser Grundlage eine große Chance für den einzelnen Mitarbeiter, im Pool dieser Kompetenzkräfte seine eigenen Fähigkeiten zu erweitern und zu differenzieren. Gleichzeitig sehe ich in diesem Wissenspool eine große Chance für die Organisation, ihr Angebot profilieren und gleichzeitig Wissensschätze für sich abschöpfen zu können. Meiner Wahrnehmung nach hat Wissen in unserer Gesellschaft einen immer größeren Wert. Jedoch müssen Instrumente zur Verfügung stehen, um diesen Schatz heben zu können. Diese Instrumente werden im Wissensmanagement entwickelt. Für mich war bisher ungewiss, ob und in welcher Form das Wissensmanagement in den stationären Einrichtungen Einzug gehalten hat. Klar ist jedoch, dass die Einstellung zum Wert des Wissens ins Bewusstsein der Organisationen dringen muss, damit den Wissensmanagement-Maßnahmen überhaupt der Eintritt in die Organisation gewährt wird. Die Frage nach der Einstellung der Organisation zum Wert des Wissens war ein weiterer Anlass, diese Arbeit zu verfassen.
Es geht im Folgenden also um die Forschungsfrage.
„Wissen und nichts darüber wissen“ ist die spitz formulierte These als Titel dieser Arbeit. Es wird davon ausgegangen, dass Mitarbeiterwissen in den stationären Einrichtungen und damit auch in den Wohngruppen der Jugendgruppen existiert. Unbekannt ist jedoch, woher dieses Wissen stammt und wie mit diesem Wissen umgegangen wird. Um genau dies zu klären, wurde die Forschungsfrage entwickelt:
Wie wird, ausgehend von den Wissensbausteinen von Probst (2010) (vgl. Kap. 2.11), mit dem Mitarbeiterwissen in den Wohngruppen der freien Träger der Jugendwohlfahrt in Kärnten umgegangen?
1.1. Zielstellungen der Arbeit
Das Forschungsthema wird in das theoretische Kontextwissen bezüglich der Themen Wissen, Kultur und Organisation der Jugendwohlfahrt in Kärnten eingebettet. Dabei werden die folgenden Ziele verfolgt:
1. Das Begriff Wissen wird in verschiedenen Kontexten benutzt und, an den speziellen Kontext angepasst, definiert. Wissen bleibt, losgelöst vom Thema, abstrakt und ungreifbar. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, den Begriff Wissen so einzugrenzen und abzugrenzen, dass mit ihm in dieser Arbeit handtierbar gearbeitet werden kann. Wissen soll im Kontext dieser Arbeit (be-)greifbar werden.
2. Das Wissensmanagement umfasst die Instrumente, die Wissen als Wert- und Nutzgegenstand behandelbar machen. Es gibt unterschiedliche Methoden des Wissensmanagements. Hier wird bewusst auf das Baustein-Modell von Probst (2010) (vgl. Kap. 2.11) zurückgegriffen, um den Begriff Wissen zu behandeln. Das Baustein-Modell lässt sich in der Entwicklung der Wissensmanagement-Instrumente verorten. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, darzustellen, welche Rolle das Baustein-Modell im Wissensmanagement spielt und was das Baustein-Modell von Probst zu leisten imstande ist.
3. Wissen ist das Ergebnis von Lernprozessen. Lernprozesse können beschrieben werden (vgl. Kap. 2.9). Ein Ziel dieser Arbeit ist es, einen Einblick in den Prozess und in die Generierung von Wissen zu vermitteln, indem das Lernkonzept von Senge dargestellt wird.
4. Der Umgang mit Wissen ist in eine kulturelle Gesellschaft eingebunden. Wissenskultur ist ein Aspekt einer Organisationskultur. Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Zusammenhänge zwischen Wissen und Kultur zu verdeutlichen.
5. Die Wohngruppen der freien Träger der Jugendwohlfahrt in Kärnten sind durch Gesetzgebungen und Richtlinien geregelt (vgl. Kap. 3). Damit sind viele Arbeits- und Handlungsabläufe der Wohngruppenarbeit bereits vorgegeben und können nicht frei gestaltet werden. Ziel dieser Arbeit soll es sein, aufzuzeigen, wie viel Gestaltungsraum der Organisation bleibt. Zudem sollen die Wohngruppe und damit der Untersuchungsraum dieser Arbeit in den mannigfaltigen Angeboten der Jugendhilfe verortet werden können.
6. Der Blick in drei Wohngruppen soll die Unterschiedlichkeit der Arbeit mit Wissen trotz der engen strukturellen Vorgaben der Landesregierung aufzeigen. Steht das Wissen in der Arbeit wirklich im Zentrum und gibt es Wissensziele?
7. Ziel der Arbeit mit Blick auf die Mitarbeiter ist es zu eruieren, wie sich die Mitarbeiter als Fachkräfte wahrgenommen fühlen, wo und warum sie ihre Expertisen ausgebildet haben und inwieweit ihre Fähigkeiten mit eventuellen Instrumenten der Organisation weiter fortgebildet werden.
1.2. Aufbau der Arbeit
Der erste Teil dieser Arbeit widmet sich der theoretischen Aufarbeitung des Forschungsgegenstands „Wissen“. Der Wissensbegriff wird im Kontext dieser Arbeit beschrieben und definiert. Das Wissen wird von Daten und Informationen abgegrenzt und in Zusammenhang gebracht.
Das Wissensmanagement wird im weiteren Kapitel als Instrument zur „Handhabung“ von Wissen dargestellt. Das Wissensmanagement entspringt der Wissensforschung und hat eine Entstehungsgeschichte. Diese Entstehungsgeschichte wird kurz nachgezeichnet und mündet in den Wissensbausteinen von Probst. Die Zusammenhänge zwischen Lernen und Wissen werden aufgezeigt, um deutlich zu machen, dass wissende Organisationen immer einem dauerenden Prozess des Lernens folgen. Die Zusammenhänge der Organisationshandlungen, eingebettet in eine Organisationskultur, werden aufgezeigt.
In einem weiteren Kapitel wird ein Blick auf die Organisation der Erziehungshilfe geworfen. Der Forschungskontext ist lokal auf Kärnten begrenzt. Es soll veranschaulicht werden, wie die stationäre Erziehungshilfe in Kärnten organisiert ist und welche Vorgaben und Arbeitsaufträge politisch bzw. gesetzlich festgelegt werden.
Der zweite Teil dieser Arbeit widmet sich der Forschungsfrage. Ausgehend von den theoretischen Erkenntnissen, soll geklärt werden, wie sich die Wissenskultur in drei verschiedenen Wohngruppen für Kinder und Jugendliche ausgeprägt hat. Insbesondere soll die Wahrnehmung der Mitarbeiter zu der Frage nach dem Erleben im organisatorischen Umgang mit ihrem Wissen im Mittelpunkt stehen. Daher wurde die Qualitative Datenerhebung mithilfe von Leitfadeninterviews ausgewählt:
„Mit der Anwendung qualitativer Methoden verfolgt man in der Sozialforschung das Ziel, die Welt der beforschten Personen aus ihrer eigenen Perspektive zu erschließen.“ (Huber, 1992, S.15)
2. Theoretische Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand
2.1. Wissensdimensionen
Unsere Umwelt befindet sich im Wandel. Wir leben heute in einer Wissensgesellschaft und das im Informationszeitalter. Der Umbau vom Industriezeitalter zum Informationszeitalter verlief parallel zu der Entwicklung und dem Aufbau unserer Computer- und Kommunikationstechnologien. Das Informationszeitalter begann zu dem Zeitpunkt, als die Technologien der Kommunikation so weit entwickelt waren, dass die Vernetzungen untereinander praktikabel und kostengünstig wurden. Wirtschaftliche Aspekte und Macht sind historisch eng verknüpft. Unsere heutige Technologie schafft uns den Zugang zu breiten Informationsdiensten und ermöglicht uns zugleich neue Informationsfähigkeiten und –möglichkeiten (Alberts, 2009, S.47) . Das aus der Flut der verfügbaren Daten und Informationen generierbare Wissen erfährt einen ständigen Wertezuwachs. Im Vergleich zwischen der Produktion und der Handhabung der Informationen und der Produktion und der Vervielfältigung der materiellen Güter schneiden die Informationen wirtschaftlich bei Weitem besser ab.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Vergleich von materiellen Wirtschaftsgütern und Informationen (Krcmar, 2004, S.18)
„Führende Managertheoretiker“, so Probst (2010, S.3), „raten zur Investition in Wissen, da dieses wesentlich profitabler zu sein scheint als die Investition in materielle Güter.“ „Was das Informationszeitalter vom Industriezeitalter unterscheidet, sind die wirtschaftlichen Aspekte von Informationen und die Art der Macht der Information“, schreibt Alberts (2009, S.47). Das Wissen ist zudem die einzige Ressource, die sich durch den einfachen Gebrauch vermehrt, stellt Probst (2010, S.1) fest und warnt die Unternehmer: „Wenn die Wissensmanagement-Maßnahmen Ihrer Konkurrenten greifen, kann es für Sie schon zu spät sein“ (Probst, 2010, S.1).
Das Managen von Wissen wird für Organisationen aus Wettbewerbsgründen immer notwendiger. Doch stellt der Versuch, die Ressource Wissen stärker in die Managementarbeit einzubinden, die Verantwortlichen schon hinsichtlich des Verständnisses für die Elemente, die das Wissen ihrer Organisation ausmachen, vor ungeahnte Herausforderungen (Probst 2010, S.15). Die meisten Leute wissen schon bei dem Gebrauch des Wortes „WISSEN“ nicht einmal, ob wirklich ein Wissen vorliegt, so Brülisauer (2008, S.34). Daher scheint es sinnvoll, sich vor dem Thema Wissensmanagement mit der Bedeutung des Wissens auseinanderzusetzen.
Die Suche nach den Antworten auf die Bedeutungsfragen bezüglich des Wissens findet in den unterschiedlichsten wissenschaftstheoretischen, philosophischen und religiösen Richtungen ihre Ausprägung. Die Wissensfrage scheint ähnlich schwer zu wiegen wie die Sinnsuche des Menschen. So schreibt beispielsweise Nonaka (2012): "Die Philosophiegeschichte seit der Antiken lässt sich als Suche nach der Antwort auf eine Frage beschreiben: Was ist Wissen?" Nonaka (2012, S.19).
Wissen ist offensichtlich dadurch charakterisiert, dass es sich dynamisch wandelt. Die Wissensforscher differenzieren die Bedeutung des Wissens auf unterschiedlichste Art. In den folgenden Kapiteln wird ein kurzer theoretischer, jedoch intensiver und umfassender Einblick in die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Begriff Wissen vermittelt. Damit soll sich in erster Linie für diese Arbeit die Klarheit ergeben, die unerlässlich ist, um in der Folge dieser Arbeit sinnvoll weiterarbeiten zu können.
2.2. Daten, Informationen und Wissen
Im Alltag begegnen uns häufig Menschen, die glauben, etwas zu wissen, jedoch bleibt unsicher, ob diese Personen über wirkliches „Wissen“ oder nur über „Informationen“ hinsichtlich einer Sache verfügen. Selbst in der Auseinandersetzung mit der uns umgebenden Kommunikationstechnik begegnen uns die Begriffe der Datenverarbeitung, Informationsverarbeitung und seltener auch der Wissensverarbeitung, als wären sie synonym zu verwenden ( vgl. z.B. Helmut Krcmar 2009 ; Caspers 2004, S.22). Die meisten Wissensmanagementkonzepte unterscheiden Wissen von Informationen und Daten von Zeichen klar voneinander (vgl. Dick 2002, S.7).
Der Autor Heiko Rössel begründet diese konzeptionelle Differenzierung damit, dass die strukturierte Erfassung von Daten zur Erzeugung von Informationen und zur Ableitung von Wissen für eine Organisation notwendig und wichtig ist (Rössel 2011, S.187).
Der Schweizer Ökonom Probst warnt zudem, dass der fehlende Blick auf die Zusammenhänge zwischen Daten, Informationen und Wissen oftmals zu einer fatalen Entkopplung dieser Bereiche in Organisationen führt. Diese Entkopplung zeichnet sich dann dadurch aus, dass die Daten und Informationen nur in einer einseitigen Arbeitsplatzposition gesammelt und archiviert werden und dass dann aus einer anderen Position heraus das Personal geschult wird ohne eine Auswirkung der Informationsergebnisse. Teilweise wird auch noch von dritter Seite Innovationsforschung betrieben, ohne dass Übergänge in Form von gezielter Datenverarbeitung zum Zweck der Mitarbeiterschulung bzw. der Innovationsforschung zu erkennen wären (Probst 2010, S.17).
Auf der Suche nach der Bedeutung des Begriffs „Wissen“ in Abgrenzung und im Verhältnis zu den Begriffen „Daten“ und „Information“ ist festzustellen, dass es statt einer eindeutigen Definition eine Vielfalt von Kontextdefinitionen gibt, die entweder situationsbezogen sind oder mit der theoretischen Haltung bestimmter wissenschaftlicher Disziplinen begründet werden (Brülisauer, 2008, S.24-35). Die am häufigsten gewählte Abgrenzung der Ebenen Daten-Informationen-Wissen aus der Sicht des Wissensmanagements ist wie folgt charakterisiert:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Daten, Informationen, Wissen (Caspers, 2004, S.22)
Bei Daten handelt es sich um Zeichen, die durch spezifische Syntaxregeln miteinander verbunden sind. Sie sind leicht speicherbar und können ebenso leicht übertragen oder auch in Datenmengen gemessen werden. Daten werden erst durch einen situativen Kontext zu Informationen.
Informationen bestehen aus Daten, denen ein subjektiver Bedeutungsinhalt hinzugefügt wird. Sie sind Produkte im Prozess der Datenverarbeitung und, verglichen mit reinen Daten, gehalt- und bedeutungsvoller.
Wissen ist das Ergebnis der Transformation von Information durch bewusste Reflexion (Caspers 2004, S.22–23). Damit deutet der Begriff Wissen auf die vom Menschen kognitive verdaute und veredelte Information durch Speicherung, Integration und Organisation im Gedächtnis. Noch konkreter beschreibt der Autor Solso diese Sichtweise: „Wissen ist organisierte Information, es ist ein Teil eines Systems oder Netzes aus strukturierten Informationen" (Solso 2005, S.242; vgl. Gantner 2010, S.17) Caspers folgt der Logik von Solso und führt zusätzlich den Begriff „Lernen“ in die Wissensdiskussion mit ein, sodass „Wissen“ die Gesamtheit aller Endprodukte von Lernprozessen repräsentiert. Er schreibt: „Lernen ist der Prozess, Wissen ist das Ergebnis“ (Caspers 2004, S.22–23).
Die Ansicht, „Wissen“ als die kognitive Verdauung von Daten und Informationen zu begreifen, weist auf die psychologische Definition von Wissen hin. Aus der informationstheoretischen Sichtweise hingegen werden die Ebenen Daten-Wissen-Informationen häufig als Anreicherungsprozesse dargestellt, zwischen denen ein hierarchisches Verhältnis besteht (Probst 2010, S.16; vgl. Abb.1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Stufenmodell der Wissenserzeugung (Caspers, 2004 , S. 23)
Aus der handlungstheoretischen Sichtweise sind ein wesentlicher Unterschied gegenüber den psychologischen und informationstheoretischen Definitionen von Wissen und damit ein neuer Ideenansatz der Wissensdefinition festzustellen. Handlungstheoretisch sind die Daten, die Informationen und das Wissen gleichberechtigt und ineinander verzahnte Ebenen des Denkens und Handelns. Das bedeutet, dass es keine Einbahnstraßen gibt, die von den Daten ausgehen und zum Wissen führen und sich in Handlungen realisieren. Aus Handlungen und Wissen können umgekehrt ebenso gut Informationen und Daten generiert werden (Dick 2002, S.10).
Dick postuliert mit dieser handlungstheoretischen Darstellung, dass Daten und Informationen überhaupt die explizierten und vermittelbaren Träger kulturell gebundenen Wissens sind, und hebt sie mit dieser Aussage in der Wertigkeit nochmals deutlich auf die Ebene des Wissens (Dick 2002, S.9).
Der folgende Versuch einer verbal expliziten Definition, auf die sich das Wissensmanagement im Wesentlichen stützt, stammt von Probst:
„Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen stützt sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch immer an Personen gebunden. Es wird von Individuen konstruiert und repräsentiert deren Erwartungen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge“ (Probst 2010, S. 23).
Probst (2010) entwickelt aus dieser Definition ein, das eine besonders hohe Anerkennung in seiner Disziplin genießt. Schüppel (1996) (in Lüthy 2002, S.14) versucht, in den beiden nachfolgenden Definitionen zwischen dem individuellen und dem kollektiven Wissen zu differenzieren:
„Individuelles Wissen ist eine „in Oberflächen- und Tiefenwissen“ unterscheidbare „Kategorie menschlicher Kognition“, die „mit allen anderen Bereichen der Psyche“ vernetzt ist, es ist „Basis des individuellen Handlungsvermögens“ und „neues Wissen ist an alten Bestand“ rückgebunden“ (Schüppel 1996 in Lüthy 2002, S.14).
„Kollektives Wissen ist eine „in Oberflächen- und Tiefenwissen“ unterschiedene und in mehreren „Wissensformen“ auftretende „verdichtete Repräsentation der Realität“, die in „kollektiven Speicher- und Transformationsmedien“ institutionalisiert und „Basis des kollektiven Handlungsvermögens“ ist“ (Schüppel 1996 in Lüthy 2002, S.14; vgl. a. Dick 2002, S.9).
Schüppels zusätzlicher Blick auf das „kollektive Wissen“ rückt die Auseinandersetzung mit dem Wissen in Organisationen in den Focus des Interesses. „Der Wissensbegriff bezeichnet das Potenzial, Informationen in das Handeln zu integrieren und ihnen damit Sinn zu geben“ (Dick 2002, S. 9). So wird Schüppels Wissensdefinition vom Autor Dick interpretiert. Mit dieser Interpretation geht Dick sowohl mit Schüppels Aspekt konform, dass das individuelle Handlungsvermögen das Wissen zur Basis hat, folgt aber auch Probsts Aspekt, dass alle individuell eingesetzten Fähigkeiten der Problemlösung Wissen repräsentieren. Die Wissensproduktion ist in Übereinstimmung aller hier genannten Definitionen und Erklärungsansätze an den Menschen gebunden. Zudem ist kollektives Wissen die Basis von Handlungsmöglichkeiten des Kollektivs und zugleich in „kollektiven Speicher- und Transformationsmedien“ institutionalisiert.
2.3. Implizites Wissen, explizites Wissen
Bei dem wirtschaftlichen Vorhaben, das Produkt Wissen in Organisationen als Ressource zu entwickeln, zu nutzen und weiterzugeben, hat es sich als hilfreich erwiesen, auf die Wissensbestandteile Informationen und Daten und dessen „Verdauungsprozess“ zurückgreifen zu können.
Daher wird im Wissensmanagement zwischen dem impliziten und dem expliziten Wissen differenziert. Bei seiner Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen weist Michael Polanyi (1958) erstmals gleichzeitig auf die unterschiedlichen Ausformungen von Wissen hin (vgl. North 2005, S.47; Werde 2007, Polanyi 1985). Mit der bekannten Aussage von Polanyi: „Ich weiß mehr als ich sagen kann“ (Polanyi in Wrede 2007, S.26) werden die beiden Ausformungen implizit und explizit begreifbar deutlich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Modi der Wissensgenerierung in Organisationen (Willke, 2011, S.45).
Der Ursprung des implizierten Wissens liegt in der Erziehung und ist weitergehend in der Sozialisation einer Person verankert. Es handelt sich um eine Form des Übernehmens oder Nachahmens von Handlungen und Wissen und um den Übergang von explizitem zu implizitem Wissen (vgl. Abb. 4). Implizites Wissen stellt das ganz persönliche Wissen einer Person dar, das auf dessen Idealen, Werten und Gefühlen beruht. Es ist ein oft unbewusstes Wissen und kann daher selten artikuliert werden. Mit Intuition und subjektiven Einsichten wird das implizite Wissen erklärt. Es ist tief in den Handlungen und Erfahrungen dieser Person verankert und wird umgangssprachlich zu dessen „Know-how“ gezählt (vgl. North 2005, S.47; Willke 2011 S. 43).
Explizites Wissen hingegen liegt in artikulierter Form vor. Daher kann es ebenso gut aufgenommen, internalisiert gespeichert und übertragen werden (North 2005, S.47). Es kann mit vorhandenem Wissen kombiniert werden (vgl. Abb. 4). Es ist dem Wissenden bewusst und auch beschreibbar (Willke 2011, S. 44).
Den Prozess des Explizierens erklärt Willke (2011) damit, „[…] ein diffuses, unklares, verschwommenes Wissen, das zwar irgendwie implizit vorhanden, aber nicht so richtig greifbar ist, dem heilsamen Zwang der Systematisierung, Einordnung, sprachliche Fassung und Mittelbarkeit zu unterwerfen. […]. Die Explizierung ist gleichbedeutend damit, dass sich jemand über etwas klar wird oder sich etwas klar macht“ (Willke 2011 S. 48). Sie ist ein bestimmter Prozess des Lernens (ebd. S. 48).
Für die Mitarbeiter in Organisationen ist es oftmals eine schwerwiegende Entscheidung, ob und unter welchen Bedingungen sie bereit sind, ihr Wissen zu explizieren und damit Anderen bekannt zu geben. Viele fürchten - und manche zu Recht - wie Willke meint, dass sie sich damit selbst überflüssig machen könnten (ebd. S.44).
2.4. Organisationswissen, individuelles, kollektives Wissen
Der Mitarbeiter einer Organisation besitzt die Fähigkeiten der Sozialisierung, Externalisierung, Internalisierung und Kombination von Wissen (vgl. Abb. 4). Damit macht sich das Individuum zum wichtigsten Werkzeug der Wissensproduktion und zum zentralen Träger der organisationalen Wissensbasis (Probst 2010, S.18). Die organisationale Wissensbasis setzt sich aus allen individuellen und aus den kollektiven Wissensbeständen zusammen. Sie umfasst darüber hinaus auch die Daten und Informationsbestände, auf deren Basis das einzelne und das gemeinschaftliche Wissen generiert werden. Die Problemlösungskompetenz einer Organisation steht im sehr engen Zusammenhang mit deren Wissensbasis (Probst 2010 S.23).
Auch das individuelle Wissen steht im sehr engen Zusammenhang mit der individuellen Problemlösungskompetenz. Die Art und auch die Geschwindigkeit, mit welcher der Mensch Probleme löst, hängen von seiner individuellen Wissensbasis ab. Die Wissensbasis ist ein Bestandteil der Psyche des Menschen und mit allen seinen Bereichen, wie zum Beispiel seiner Handlungsmotivation und seinen Bedürfnissen verknüpft (Bodrow 2003 S.39).
Die organisationale Fähigkeit bedeutet die gemeinschaftliche Aufgabenlösung mit denselben (kollektiven) Wissensbestandteilen, also mit der organisationalen Wissensbasis. Das kollektive Wissen wird dann möglich, wenn es das Unternehmen schafft, das individuelle Wissen seiner einzelnen Mitarbeiter miteinander zu verbinden. Sowohl das individuelle als auch damit das kollektive Wissen müssen explizit vorhanden sein oder kooperierend gestaltet worden sein. „Ähnlich wie beim Mannschaftssport sollten die Einzelspieler in der Lage sein, ihr Können in einem Zusammenspiel zu entfalten. Das bedarf eines ausgeprägten Verständnisses der Individuen füreinander“, schreibt Probst (2010, S.18) und fügt hinzu, dass die kollektiven Fähigkeiten weit mehr sind als die Summe aller Experten einer Organisation (ebd. S.18).
2.5. Volatilität des Wissens
Mit dem Begriff der Volatilität wird der Grad der Daten-, Informations- und Wissensveränderung beschrieben (Greulich 2005 S.143). Mit jedem Mitarbeiterwechsel oder Datenzuwachs verändert sich die Wissensbasis des Unternehmens. Daher verzeichnet das Wissen einen hohen Grad der Volatilität.
Die personale Bindung des organisationalen Wissens wird dann zum Risiko für die Organisation, wenn der Mitarbeiter die Organisation verlässt und eine schwer zu füllende Wissenslücke hinterlässt (Probst 2010, S. 19; vgl. Kap. 2.3). Um dieses Risiko zu vermeiden, entscheiden sich immer mehr Organisationen für die Wissensanalyse und den damit verbundenen selektiven Personalabbau, anstelle des Prinzips „last-in-first-out“ (ebd. S. 20). Die Volatilität des Wissens und die damit verbundenen Risiken einer Organisation verstärken zudem den Wunsch der Unternehmen, das Wissen ihrer Mitarbeiter möglichst intensiv zu externalisieren.
2.6. Wissensmanagement
In den vorherigen Kapiteln wurde der Begriff „Wissen“ im Sinne der Genese dieser Arbeit soweit eingegrenzt und von seinen Elementen Daten und Informationen insoweit abgegrenzt, dass er Personen, Kollektiven und Organisationen zugeordnet werden konnte. Im Kapitel 2.4, das sich mit der organisationalen Fähigkeit beschäftigt, wurde bereits auf die Möglichkeit der Arbeit mit Wissensbestandteilen hingewiesen. Die Volatilität des Wissens zeigte kurz auf, welche möglichen Risiken bei fehlender oder fehlerhafter Wissensarbeit auftreten können. Dieses Kapitel widmet sich nun der Tätigkeit des Wissensmanagements und den Zusammenhängen zwischen „Organisationskultur“ und der „lernenden Organisation“. Vorerst wird jedoch durch die Beantwortung der banalen Frage: „Was ist Management?“ darauf hingearbeitet.
2.6.1. Management
Für den Begriff "Management" finden sich Übersetzungen und Synonyme, wie Unternehmensführung, Betriebspolitik und Führung. Jeder dieser Begriffe hat jedoch seine eigenen Theorieansätze und kann sich damit dem Management-Begriff nur nähern (Schulz 2008 S.34). Mit „Management“ ist im institutionellen Sinne eine Personenbeschreibung und im funktionalen Sinne eine Tätigkeitsbeschreibung gemeint. Im institutionellen Sinne kennzeichnet der Begriff die Personen in der Führung eines Unternehmens, im funktionalem Sinne charakterisiert der Begriff die Leitung, Planung und Führung eines Unternehmens (ebd. S. 36). und damit auch die disziplinierte Steuerung von Ressourcen zur Erreichung bestimmter Ziele. Dabei umfasst das funktionale Management neben der Führung von Personen und dem Intervenieren in soziale Systeme die Optimierung von weiteren Ressourcen, in diesem Fall des Wissens, um die Ziele der Organisation zu erreichen (Willke 2011) „Mit der Einführung der Wissensgesellschaft verlagert sich die Führung stärker darauf, Menschen als "Kompetenzträger", als Personen mit spezifischem Wissen, Können und mit spezifischer Expertise, so zu führen, dass diese Kompetenzen sich innerhalb der Organisation entfalten können“ (Willke S.24–25). Ursprünglich wurde der Begriff „Management“ auch für den Umgang mit Pferden genutzt und wies dort auf den Gebrauch von Kopf und Hand beim Wechselspiel mit einem sich fügenden, aber undurchschaubaren Wesen hin (Schulz 2008 S.36). Diese von Schulz formulierte Metapher beschreibt recht bildhaft die beim Wissensmanagement notwendige, aber nicht selbstverständliche Führungsart im Zusammenhang zwischen Herz, Kopf und Hand:
"Die betriebliche Praxis zeigt allzu häufig, dass verfehlte Führungsmodelle die Nutzung vorhandener Expertise eher behindern als fördern, dass verteiltes Wissen nicht ausgetaucht und kombiniert wird, sondern ängstlich als Herrschaftswissen gehütet und gehortet wird und dass vorhandenes und zugleich externes Wissen abgelehnt wird nach dem Motto: Not invented here“ (Willke 2011, S.25).
Mit dem im Management neuen Blick auf die Ressource Wissen gewinnt auch der einzelne Mitarbeiter wieder an Wertigkeit als leistungsstarker und vielleicht nicht so leicht ersetzbarer Wissensträger, dem eine wichtige Rolle im Arbeitsprozess zufällt (vgl. Dick 2002, S.6).
„Der Mensch ist nicht austauschbar oder ersetzbar wie eine Maschine, er gestaltet die Organisation und ihre Produkte in seiner Tätigkeit schöpferisch mit. Er wendet Wissen nicht nur an, er entwickelt es auch“ (ebd. S.6).
2.7. Entwicklungslinien des Wissensmanagements
„Immer mehr Unternehmen nehmen die Herausforderungen des Wissensmanagements an und versuchen im konkreten Nutzen daraus zu ziehen“ (Probst 2010 S.1). Jedoch reicht die Idee, verbunden mit dem guten Willen, nicht aus, die Fähigkeiten der Mitarbeiter sichtbar zu machen und für die Erreichung der gemeinsamen Unternehmensziele zu nutzen. Die Unternehmer brauchen die Werkzeuge und die Befähigung, diese zu benutzen, um gemeinsames Wissen in Handlungen umzusetzen (ebd. S. 14).
In der Literatur finden sich sehr unterschiedliche Konzeptionen bezüglich des Wissensmanagements (WM). Heiko Roehl (2000) hat aus ihnen drei Entwicklungslinien des Wissensmanagements konzipiert (vgl. Abb. 5).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Entwicklungslinien des WM nach Roehl (2000, S.90).
Roehl differenziert zwischen der soziologischen, der wirtschaftswissenschaftlichen und der ingenieurswissenschaftlichen Entwicklungslinie.
Die soziologische Entwicklung des WM geht in Richtung der Lernfähigkeit von Organisationen, verbunden mit speziellen Kompetenzen, zur Wissensorganisation. Im Zentrum steht dabei die Frage nach den Möglichkeiten, die sich durch den Nutzen von Wissen ergeben. Die soziologischen Konzepte streifen die Forschungsfelder der Wissenssoziologie, der systemischen Organisationsberater und der neuen soziologischen Systemtheorien.
Die wirtschaftswissenschaftliche Entwicklung des WM beschreitet den Weg einer ökonomischen Nutzungsorientierung des Wissens. Mithilfe dieser Nutzungsorientierung können organisatorische Veränderungsprozesse beschrieben und Interventionsangebote erstellt werden. Die wirtschaftswissenschaftlichen Konzepte streifen die Forschungsfelder des Organisationalen Lernens, der Organisationentwicklung, des Informationsmanagements, der Organisationskulturforschung und des Human Ressource Managements.
Die ingenieurswissenschaftliche Entwicklungslinie beginnt bei der Datenverarbeitung und geht über die Informationsverarbeitung bis hin zum WM im Sinne der Rationalisierung und Effektivitätssteigerung von Wissensressourcen. Die ingenieurswissenschaftliche Entwicklung ist eng mit der Entwicklung der Computertechnologie verbunden und streift interdisziplinäre Forschungsfelder, wie z.B. die Bereiche der künstlichen Intelligenz oder das Design infrastruktureller Netzwerke (Schulz 2008, S.36; Roehl 2000, S.90).
Über die Entwicklungslinien des WM hinweg formuliert Ursula Schneider (2001, S.7) die Funktionen, die das Wissensmanagement im Unternehmen idealerweise Weise erfüllen sollte:
- Das Wissen in Organisationen koordinieren - die Mitglieder untereinander über sich und ihr Tun informieren. Einblick in die und Überblick über die verschiedenen Kompetenzbereiche gewähren.
- Aufgaben- und Problemlösungen verallgemeinern, Fähig- und Fertigkeiten sichtbar machen und verteilen. Die verallgemeinerten Problemlösungen (die richtigen Unternehmensprozesse) zugänglich machen.
- Neuerungen fördern, da die Fähigkeit, Innovationspotential zu nutzen, den wirtschaftlichen Erfolg der Organisation bestimmen kann.
Das WM stellt dabei das Methodenrepertoire zur Verfügung, mit dem die Wissensbasis einer Organisation sowohl gefestigt als auch entwickelt werden kann. „Organisationales Lernen beschreibt die Veränderungsprozesse der organisationalen Wissensbasis. Deren Gestaltung und Lenkung ist Gegenstand des Wissensmanagements“, schreibt Probst (2010, S.32).
2.8. Wissensmanagement und Organisationales Lernen
Systemisches Wissensmanagement hat im Sinne der Kompetenzerweiterung den Zweck, die Organisation und die in ihrem System agierenden Personen zu befähigen, zwei Kernkompetenzen zu entwickeln:
- Lernfähigkeit und
- Innovationskompetenz
Diese Kompetenzen werden als die Kernkompetenzen unserer Wissensgesellschaft bezeichnet. Beide Kernkompetenzen verlangen höherstufiges Lernen. Denn erst das reflektierte Lernen generiert das Wissen, das als strategisch gezielte Kompetenz einer Organisation oder Person bezeichnet werden kann (Willke 2011, S.62).
Lernen wird grundsätzlich als Anpassung eines komplexen Systems an seine Umweltbedingungen verstanden (ebd. S.59) . Organisationales Lernen ist damit die Verbesserung der Problemlösungs- und Handhabungskompetenz und gleichzeitig die Veränderung der organisationalen Werte- und Wissensbasis, verbunden mit der Veränderung des gemeinsamen Bezugsrahmens der Mitglieder innerhalb einer Organisation. Denn durch das organisationale Lernen wird nicht nur der Umfang, sondern auch die Struktur der organisationalen Wissensbasis verändert. Die Individuen werden dabei als Hauptakteure des Veränderungsprozesses betrachtet (Probst 1994, S. 17-24).
2.9. Organisationales Lernkonzept von Senge (1996)
In der Literatur lassen sich einige organisationale Lernkonzepte und Lernebenen eruieren, aus denen das Konzept von Senge (1996) hervorsticht, da es besonders praxisnahe und innovative Methoden des organisationalen Lernens offeriert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Die fünf Disziplinen von Senge (Senge 2011, S.11)
Senge beschreibt grundsätzlich fünf Disziplinen, die in seinem Buch „Die fünfte Disziplin“ veranschaulicht wurden. Anschließend entwickelte Senge in dem Buch „Das Fieldbook zur Fünften Disziplin“ einen Lernzyklus und eine Architektur. Die lernende Organisation kann nur durch einen dauerhaften Prozess verwirklicht werden und genau dieser Prozess startet mit den fünf Disziplinen (vgl. Wieselhuber 1997).
2.9.1. Personal Mastery
Die erste Disziplin, die Personal Mastery, basiert auf der geistigen Entfaltung und der kreativen Lebensauffassung jedes Organisationmitglieds. Der Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass die Organisation nur dann lernen kann, wenn ihre Mitglieder lernen. Senge geht davon aus, dass sich durch die Entwicklung einer persönlichen Vision und durch die kontinuierliche deutliche Wahrnehmung der Realität eine kreative Spannung aufbaut. Die Spannung entsteht durch die Kraft, mit der sich Vision und Realität verbinden wollen. Die erste Disziplin baut auf der Schaffung und lebenslangen Erhaltung dieser kreativen Spannung auf. Die Aufgabe der Organisation ist es, eine anregende Unternehmensumwelt und eine Kultur zu schaffen, in der die Persönlichkeitsentfaltung ein selbstverständlicher Wert ist (Senge 2011, S.17).
2.9.2. Die Mentalen Modelle
Die Mentalen Modelle sind gleichbedeutend mit der Begrifflichkeit "innere Bilder", die jeder Mensch in sich trägt. Diese werden entweder langfristig gespeichert oder bestehen aus kurzen Wahrnehmungsmomenten. Die inneren Bilder geben den Rahmen für das Verhalten und die Denkprozesse vor. Die Disziplin der Mentalen Modelle zielt auf die reflektierte Auseinandersetzung mit den eigenen und den fremden Annahmen. Die Erkundung der eigenen und der fremden inneren Bilder erfolgt über das Gespräch, das dem offenen Meinungsaustausch dient. Die Gespräche dienen der Überprüfung dieser Mentalen Modelle, die einen großen Einfluss auf das Denken und auf die Handlungen ausüben (ebd. S.273).
2.9.3. Gemeinsame Vision
Die gemeinsame Vision der Mitarbeiter ist die Vision hinsichtlich der Zukunft ihrer Organisation, die sich die Mitglieder teilen. Die gemeinschaftliche Vision spiegelt die eigenen Visionen wider. Daher beginnt diese Disziplin mit der Entwicklung eigener Visionen. Nur auf diesem Weg kann eine gemeinsame Vision entstehen. Mit der gemeinsamen Vision wird eine Kraft erzeugt, welche die einzelnen Mitglieder einer Organisation durch ein Gemeinschaftsgefühl bündelt. Gleichzeitig dient es dem menschlichen Bedürfnis, kollektiv an Aufgaben zu arbeiten.
Die Aufgabe der Organisation besteht auch hier in der Gestaltung von Zeit und Raum, um die Kommunikation über die Ebenen hinweg zu fördern. Sind die Mitglieder einer Organisation von der Bedeutung ihrer gemeinsamen Kommunikation überzeugt, dann werden sie diese mit Zustimmung und hohem innerem Engagement praktizieren (ebd. S.252).
2.9.4. Team-Lernen
Das Team-Lernen ist ein Prozess. In diesem Prozess werden die Fähigkeiten der Mitglieder kontinuierlich erweitert. Die Energie dieser Mitglieder soll jedoch, ähnlich einem Laserstrahl, in eine Richtung ausgerichtet werden. Die Voraussetzung für eine gelingende Teamarbeit ist der produktive Dialog in Form einer Diskussion. In der Diskussion sollen die eigenen Ansichten verteidigt werden können, ohne die positive Zusammenarbeit zu gefährden. Es soll sich ein Synergie-Effekt ergeben, der die Summe der einzelnen Fähigkeiten überschreitet. Gut funktionierende Teams sollten für ihre Zusammenarbeit belohnt werden (ebd. S.285-287).
2.9.5. Systemdenken
Die letzte Disziplin dient der Zusammenführung aller Disziplinen, damit die fünf Disziplinen mehr ergeben als die Summe ihrer einzelnen Teile. Senge beschreibt diese Disziplin als eine Art Rückkopplungsprozess und gibt zu bedenken, dass Ursache-Wirkungs-Ketten und lineares Denken in der komplexer werdenden Umwelt für Unternehmen nicht mehr angebracht sind. Das Systemdenken ist konkret die Fähigkeit, Abhängigkeiten und Interdependenzen und ganzheitliche Strukturen zu erforschen, zu erkennen und zu beschreiben und in der Folge sinnvoll intervenieren zu können (ebd. S.102).
2.10. Wissen und Organisationskultur
Constanze Schulz (2008) ging der Frage nach, ob die Organisationskultur einen wesentlichen Einfluss auf die Möglichkeit eines effizienten WM in Unternehmen nimmt. Sie folgt der Kultur-Definition von Kroeber und Kluckholm (1952):
„Kultur besteht aus expliziten und impliziten Mustern von und für Verhaltensweisen, die durch Symbole erworben und vermittelt werden; sie stellen eine unverwechselbare Leistung von menschlichen Gruppen dar, einschließlich ihrer Verkörperung in Schöpfung von Menschenhand; der wesentliche Kern von Kultur besteht aus traditionellen (d.h. historisch abgeleiteten und ausgewählten) Ideen und insbesondere aus den zugeordneten Werten; ein Kultursystem kann einerseits als Ergebnis von Handlungen, andererseits als bedingende Elemente von zukünftigen Handlungen aufgefasst werden“ (Kroeber/Kluckholm, 1952, S.37 in Schulz 2008).
[...]
- Quote paper
- Michael Pietrowski (Author), 2012, Wissen und nichts darüber wissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205338