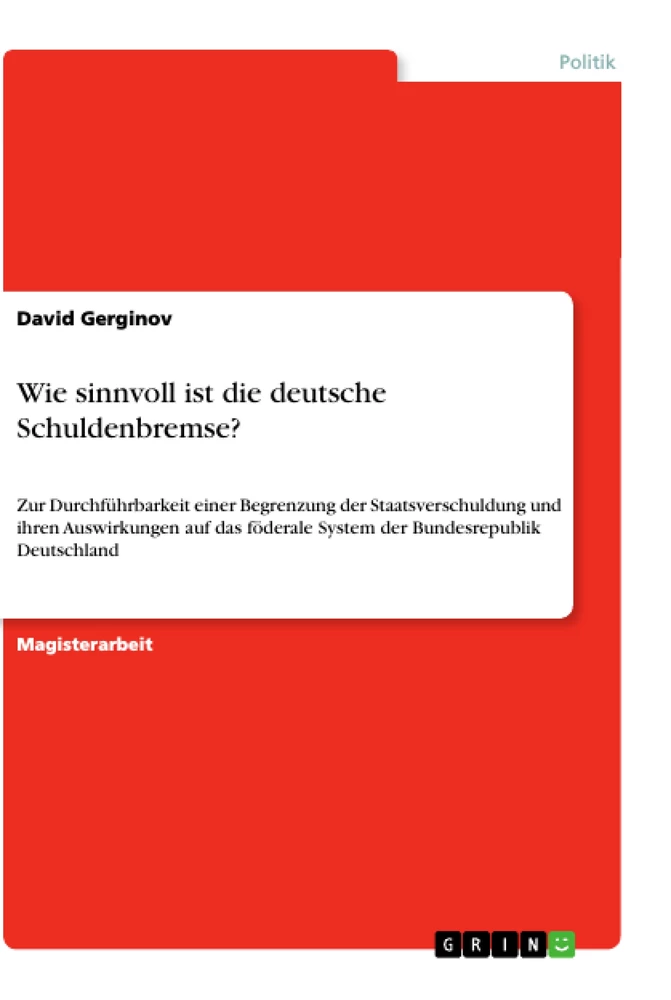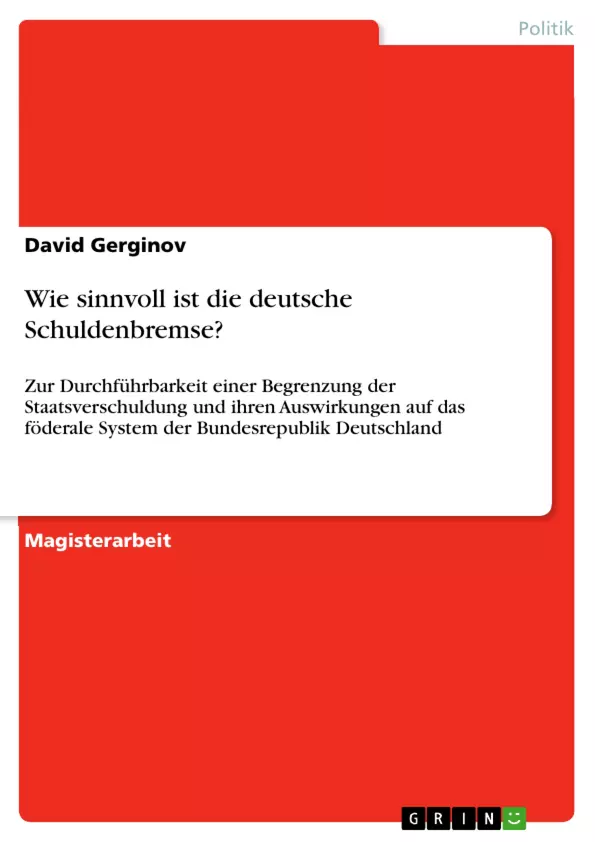Eingeführt 2009, auf dem Höhepunkt der Finanz- und Eurokrise, stellt die Schuldenbremse die Bemühungen Deutschlands dar, konsequente Regeln für die staatliche Verschuldung aufzustellen, um dem „Opium des Staatshaushalts“ zu entkommen, dem Bund und Länder zu lange gefolgt sind.
Auch weil sie ein kooperatives Element für Bund und Bundesländer darstellt, ist sie maßgeblich im Rahmen der Föderalismusreform II entstanden;, die Pläne lagen aber bereits längst in der Schublade des damaligen Bundesfinanzministers Peer Steinbrück.
Auffällig war und ist an der Schuldenbremse, dass sie – zumindest unter Politikern und Sachverständigen – ein noch immer heiß umkämpftes Pflaster ist. Von den Befürwortern als „Sternstunde des kooperativen Bundesstaates“ , „fundamentale Weichenstellung“ oder „verfassungspolitischer Meilenstein“ gelobt, wurde sie von den Gegnern als „schwarzer Tag für die Handlungsfähigkeit des Staates“ , „dramatischer Blödsinn“ oder „fremdbestimmter Eingriff“ gebrandmarkt.
Auch in der Wissenschaft bleibt sie umstritten: Laut einer Umfrage der Financial Times Deutschland und des Vereins für Socialpolitik (VfS) hält eine Mehrheit (55,9 Prozent) von befragten Wissenschaftlern die Schuldenbremse nur für eine bedingt geeignete Maßnahme. Jeder vierte Vierte findet sie sogar uneingeschränkt ungeeignet.
Doch wie steht es wirklich mit ihrer Durchführbarkeit und ihrem Einfluss auf das deutsche Schuldensystem? Die Detailanalyse dieser Arbeit geht diesen Fragen nach und versucht zu einer Antwort zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Funktion und Umsetzbarkeit der deutschen Schuldenbremse auf Bundesebene
- 2.1 Deutsche Schuldenpolitik der Bundesrepublik
- 2.2 Die Arbeit der Föderalismuskommission II
- 2.3 Zur Beurteilung der Schuldenbremse auf Bundesebene
- 2.4 Zwischenfazit
- 3 Funktion und Wirkung der Schuldenbremse auf das föderale System der Bundesrepublik
- 3.1 Zum Stand der Schuldenbremse in den Bundesländern
- 3.2 Zur Beurteilung der Schuldenbremse im Bund-Länder-Kontext
- 4 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Sinnhaftigkeit der deutschen Schuldenbremse, ihre Durchführbarkeit und ihre Auswirkungen auf das föderale System Deutschlands. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der deutschen Schuldenpolitik, die Entstehung und die Funktionsweise der Schuldenbremse sowie die kontroversen politischen und wissenschaftlichen Positionen dazu.
- Entwicklung der deutschen Schuldenpolitik
- Entstehung und Funktionsweise der Schuldenbremse
- Auswirkungen auf das föderale System
- Politische und wissenschaftliche Kontroversen
- Bewertung der Wirksamkeit der Schuldenbremse
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der deutschen Schuldenbremse ein und stellt sie in den Kontext der europäischen Schuldenkrise und des Fiskalpakts. Sie beschreibt die unterschiedlichen politischen und wissenschaftlichen Positionen zur Schuldenbremse und hebt deren kontroverse Natur hervor. Die Arbeit positioniert sich als Analyse der nationalen Implementierung eines Mechanismus, der europäische Vorbilder hat, im Gegensatz zu den komplexeren europäischen Mechanismen selbst.
2 Funktion und Umsetzbarkeit der deutschen Schuldenbremse auf Bundesebene: Dieses Kapitel analysiert die Funktionsweise und Umsetzbarkeit der Schuldenbremse auf Bundesebene. Es untersucht die deutsche Schuldenpolitik historisch, von den frühen Jahren der Bundesrepublik bis zu den Reformplänen der Großen Koalition ab 2005. Ein besonderer Fokus liegt auf der Arbeit der Föderalismuskommission II und der Diskussion um verschiedene Modelle, inklusive dem „Schweizer Modell“, sowie auf der politischen Debatte um die Schuldenbremse. Die Bewertung der Beschlussfassung im Grundgesetz und der Analyse der Wirksamkeit der Schuldenbremse runden das Kapitel ab.
3 Funktion und Wirkung der Schuldenbremse auf das föderale System der Bundesrepublik: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der Schuldenbremse auf das föderale System Deutschlands. Es analysiert den Umsetzungsstand in den Bundesländern, den Widerstand gegen die Bundesbeschlüsse und die mögliche Störung des Föderalprinzips. Die Kapitel untersucht die Vereinbarkeit der Schuldenbremse mit dem Grundgesetz aus Sicht der Forschung und diskutiert mögliche Folgen für die Bundesländer.
Schlüsselwörter
Schuldenbremse, Staatsverschuldung, Föderalismus, Finanzpolitik, Deutschland, Grundgesetz, Föderalismuskommission II, Wirksamkeit, Kontroversen, Bundeshaushalt, Bund-Länder-Finanzen.
FAQ: Analyse der deutschen Schuldenbremse
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert die deutsche Schuldenbremse: ihre Sinnhaftigkeit, Umsetzbarkeit und Auswirkungen auf das föderale System Deutschlands. Sie untersucht die Entwicklung der deutschen Schuldenpolitik, die Entstehung und Funktionsweise der Schuldenbremse sowie die damit verbundenen politischen und wissenschaftlichen Kontroversen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Entwicklung der deutschen Schuldenpolitik, die Entstehung und Funktionsweise der Schuldenbremse, ihre Auswirkungen auf das föderale System, die politischen und wissenschaftlichen Kontroversen um die Schuldenbremse und eine abschließende Bewertung ihrer Wirksamkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt die unterschiedlichen Positionen zur Schuldenbremse. Kapitel 2 analysiert die Funktionsweise und Umsetzbarkeit der Schuldenbremse auf Bundesebene, inklusive der historischen Entwicklung der deutschen Schuldenpolitik und der Rolle der Föderalismuskommission II. Kapitel 3 befasst sich mit den Auswirkungen der Schuldenbremse auf das föderale System, den Umsetzungsstand in den Bundesländern und mögliche Konflikte mit dem Föderalismusprinzip. Kapitel 4 (Schlussbetrachtung) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Schuldenbremse, Staatsverschuldung, Föderalismus, Finanzpolitik, Deutschland, Grundgesetz, Föderalismuskommission II, Wirksamkeit, Kontroversen, Bundeshaushalt, Bund-Länder-Finanzen.
Wie wird die Schuldenbremse in der Arbeit bewertet?
Die Arbeit bewertet die Wirksamkeit der Schuldenbremse, indem sie die historische Entwicklung der deutschen Schuldenpolitik untersucht, die Funktionsweise der Schuldenbremse analysiert und ihre Auswirkungen auf das föderale System bewertet. Sie berücksichtigt dabei auch die politischen und wissenschaftlichen Kontroversen um die Schuldenbremse.
Welche Rolle spielt der Föderalismus in der Analyse?
Der Föderalismus spielt eine zentrale Rolle, da die Arbeit die Auswirkungen der Schuldenbremse auf das föderale System Deutschlands untersucht. Es wird analysiert, wie die Schuldenbremse auf Bundes- und Länderebene umgesetzt wird und ob sie zu Konflikten zwischen Bund und Ländern führt.
Wie positioniert sich die Arbeit im Kontext der europäischen Schuldenkrise?
Die Arbeit positioniert sich als Analyse der nationalen Implementierung der Schuldenbremse, die europäische Vorbilder hat, im Gegensatz zu den komplexeren europäischen Mechanismen selbst. Die Einleitung stellt die Schuldenbremse in den Kontext der europäischen Schuldenkrise und des Fiskalpakts.
- Citar trabajo
- David Gerginov (Autor), 2012, Wie sinnvoll ist die deutsche Schuldenbremse?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206271