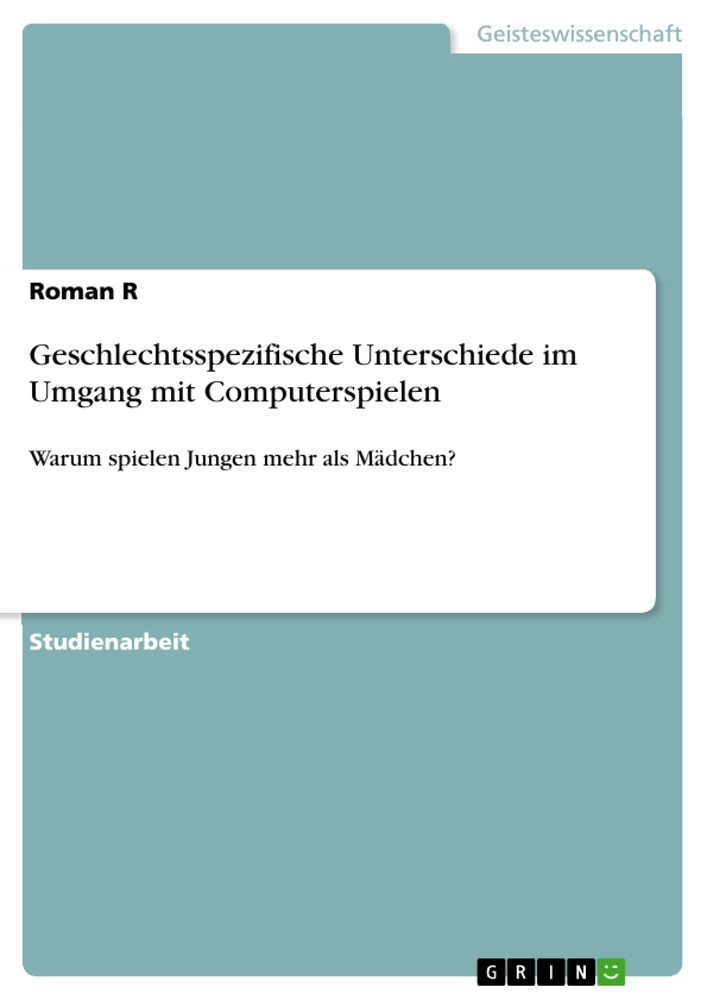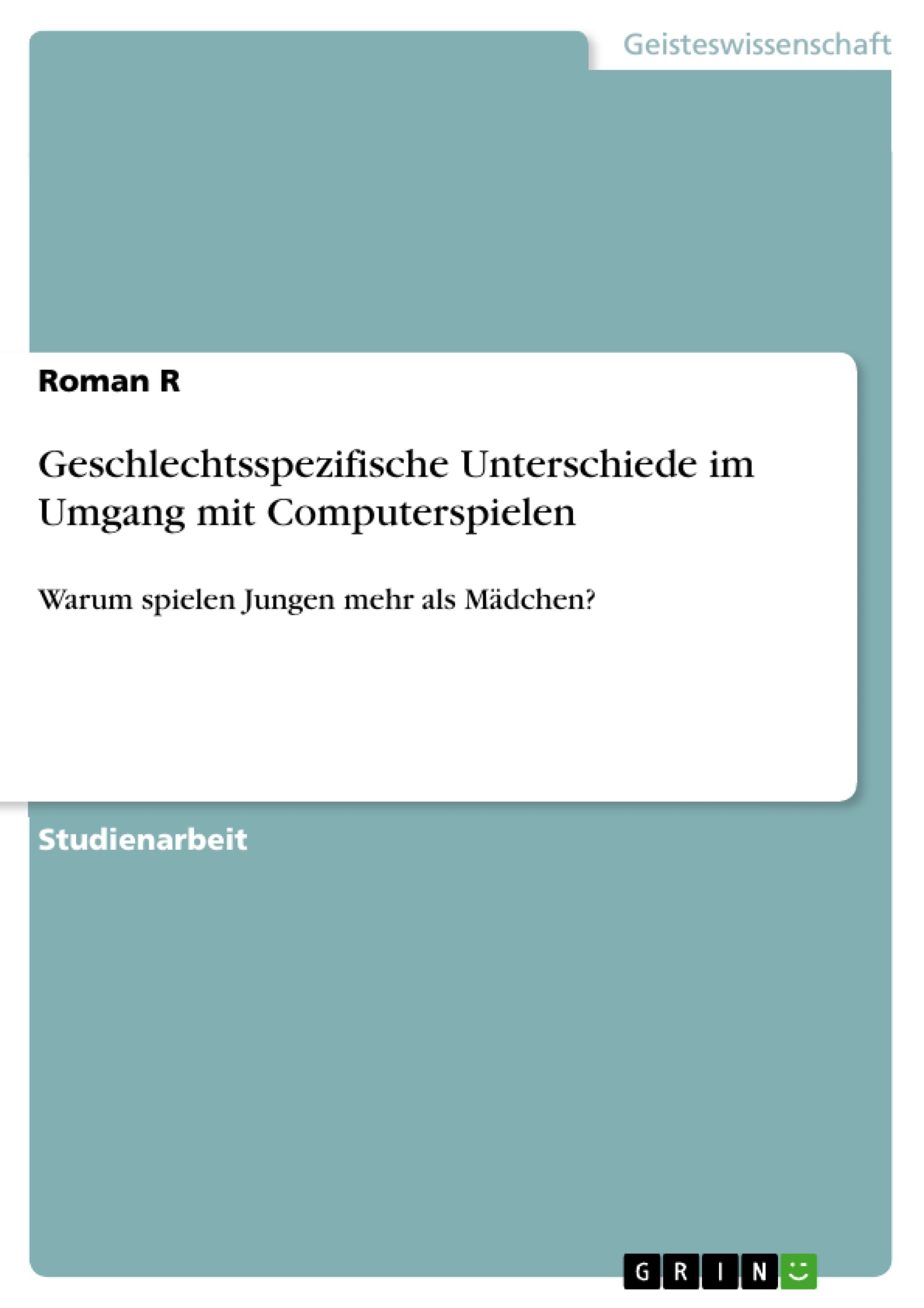Der intensive Fortschritt der Computertechnologie und insbesondere die Verbreitung der Computerspiele im letzten Jahrzehnt führten dazu, dass sich die Begriffe Generation @, Net-Generation oder Gamer-Generation immer weiter ausbreiten. „Gemeint sind damit Kinder und Jugendliche, die nach 1985 geboren worden sind und mit Internet, Multimedia und Mobilkommunikation aufgewachsen sind bzw. aufwachsen“. (Berger 2007)
Wenn wir heutige und frühere Kinder und Jugendliche im Bezug auf den Zugang zu Medien vergleichen, dann sehen wir einen wesentlichen Unterschied. Noch im Jahr 1976 z.B. zählten zu den allerliebsten Freizeitbeschäftigungen von 8- bis 16-Jährigen Bücher, Radio, Comics, Zeitschriften und Plattenspieler. Heute sind das Handy, MP3-Player, Fernseher, Video- und DVD-Player und natürlich Spielkonsolen bzw. Computerspiele.
Heutzutage weisen laut aktuellen Studienergebnissen 78% der 6- bis 13-Jährigen Erfahrungen im Umgang mit Computer auf. Unter den 12- bis 19-Jährigen beschäftigen sich aktuell 97% mindestens einmal im Monat mit einem Computer. Dabei wurde schon oft festgestellt, dass Jungen „besonders oft und lange am Computer spielen, als Mädchen“ (Maaß 1993, S. 53). Genau mit diesem Phänomen bzw. mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden, die zwischen Jungen und Mädchen im Umgang mit Computerspielen bestehen und deren Ursachen möchte ich mich in dieser Hausarbeit auseinandersetzen.
Zuerst stelle ich statistische Angaben aus den KIM- und JIM-Studien vor. Anhand dieser Studien verdeutliche ich, dass Jungen wesentlich mehr als Mädchen am Computer spielen. Weiterhin möchte ich einige mögliche Erklärungen geben, die für dieses Phänomen verantwortlich sind. Das sind in der ersten Linie geschlechtsspezifische Unterschiede. Beispielsweise handelt es sich um eine ungleichmäßige psychomotorische Entwicklung bei Jungen und Mädchen und deren Ursachen, die in der Kindheit liegen. Außerdem werden auch geschlechtsspezifische Sozialisationen und Denkstile betrachtet. Und vor allem werde ich die Darstellung von weiblichen Figuren in Computerspielen beschreiben, denn auch das ist ein wichtiger Aspekt, warum Jungen und Mädchen nicht gleichmäßig häufig am Computer spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ergebnisse aus den KIM- und JIM-Studien
- Warum spielen Jungen mehr am Computer als Mädchen?
- Gründe, die in der Kindheit liegen
- Geschlechtsspezifische Sozialisation
- Geschlechtsspezifische Denkstile
- Computerspiele setzen männliches Denkvermögen voraus
- Darstellung von weiblichen Figuren in Computerspielen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Unterschiede im Umgang mit Computerspielen zwischen Jungen und Mädchen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Gründe für das beobachtete Phänomen zu erforschen, dass Jungen deutlich häufiger und länger Computer spielen als Mädchen.
- Statistische Daten aus den KIM- und JIM-Studien
- Geschlechtsspezifische Unterschiede in der psychomotorischen Entwicklung
- Einfluss der geschlechtsspezifischen Sozialisation
- Rolle von geschlechtsspezifischen Denkstilen
- Darstellung von weiblichen Figuren in Computerspielen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Umgang mit Computerspielen ein und stellt die Bedeutung des Themas im Kontext der digitalen Entwicklung dar. Kapitel 2 präsentiert statistische Ergebnisse aus den KIM- und JIM-Studien, welche deutlich zeigen, dass Jungen im Vergleich zu Mädchen häufiger und länger Computer spielen. In Kapitel 3 werden verschiedene Erklärungen für dieses Phänomen beleuchtet, darunter geschlechtsspezifische Unterschiede in der Entwicklung, Sozialisation und Denkweise. Dabei wird auch die Darstellung von weiblichen Figuren in Computerspielen als ein relevanter Faktor betrachtet.
Schlüsselwörter
Computerspiele, geschlechtsspezifische Unterschiede, KIM-Studie, JIM-Studie, Sozialisation, Denkstile, Darstellung von Frauen, digitale Medien, Gamer-Generation.
Häufig gestellte Fragen
Spielen Jungen tatsächlich häufiger Computerspiele als Mädchen?
Ja, laut den KIM- und JIM-Studien beschäftigen sich Jungen wesentlich häufiger und über längere Zeiträume mit Computerspielen als Mädchen.
Welche Rolle spielt die psychomotorische Entwicklung bei diesem Unterschied?
Die Arbeit untersucht, wie eine ungleichmäßige psychomotorische Entwicklung in der Kindheit dazu führen kann, dass Jungen einen anderen Zugang zu digitalen Spielen finden als Mädchen.
Wie beeinflusst die Sozialisation das Spielverhalten?
Geschlechtsspezifische Sozialisationsprozesse prägen die Interessen und Freizeitbeschäftigungen von Kindern, was oft dazu führt, dass Jungen stärker in Richtung Technik und Gaming gefördert werden.
Gibt es Unterschiede in den Denkstilen von Jungen und Mädchen?
Die Arbeit diskutiert, ob bestimmte Computerspiele ein „männliches“ Denkvermögen voraussetzen oder fördern, was Mädchen den Zugang erschweren könnte.
Warum ist die Darstellung weiblicher Figuren in Spielen ein Problem?
Die oft klischeehafte oder sexualisierte Darstellung weiblicher Charaktere kann dazu führen, dass sich Mädchen weniger mit den Inhalten identifizieren und das Medium Computerspiel ablehnen.
- Citar trabajo
- Roman R (Autor), 2010, Geschlechtsspezifische Unterschiede im Umgang mit Computerspielen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206541