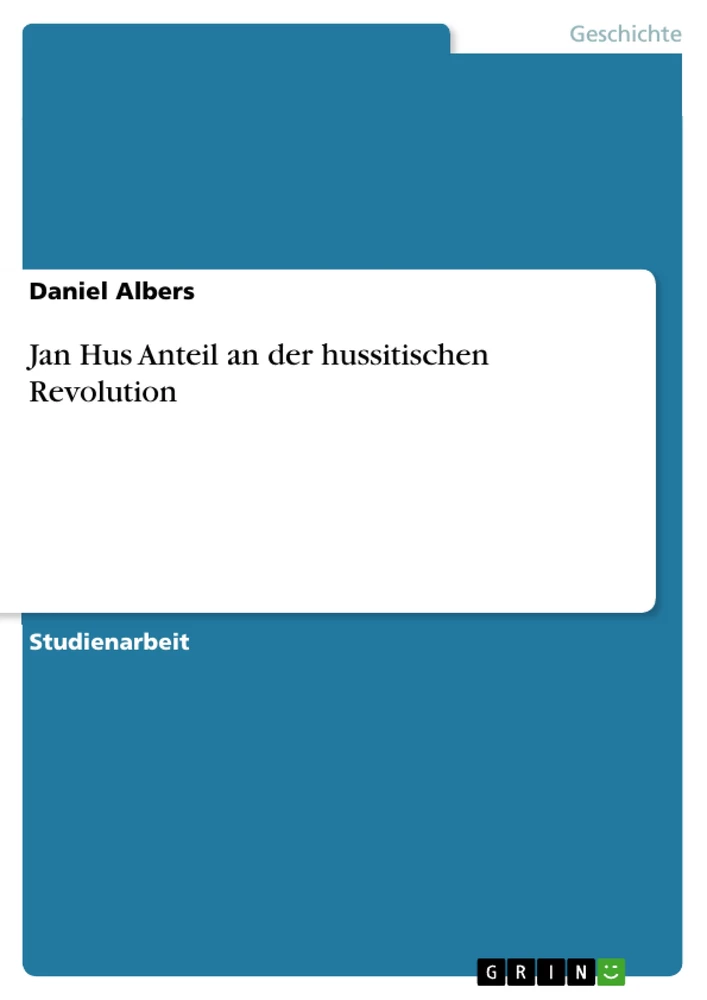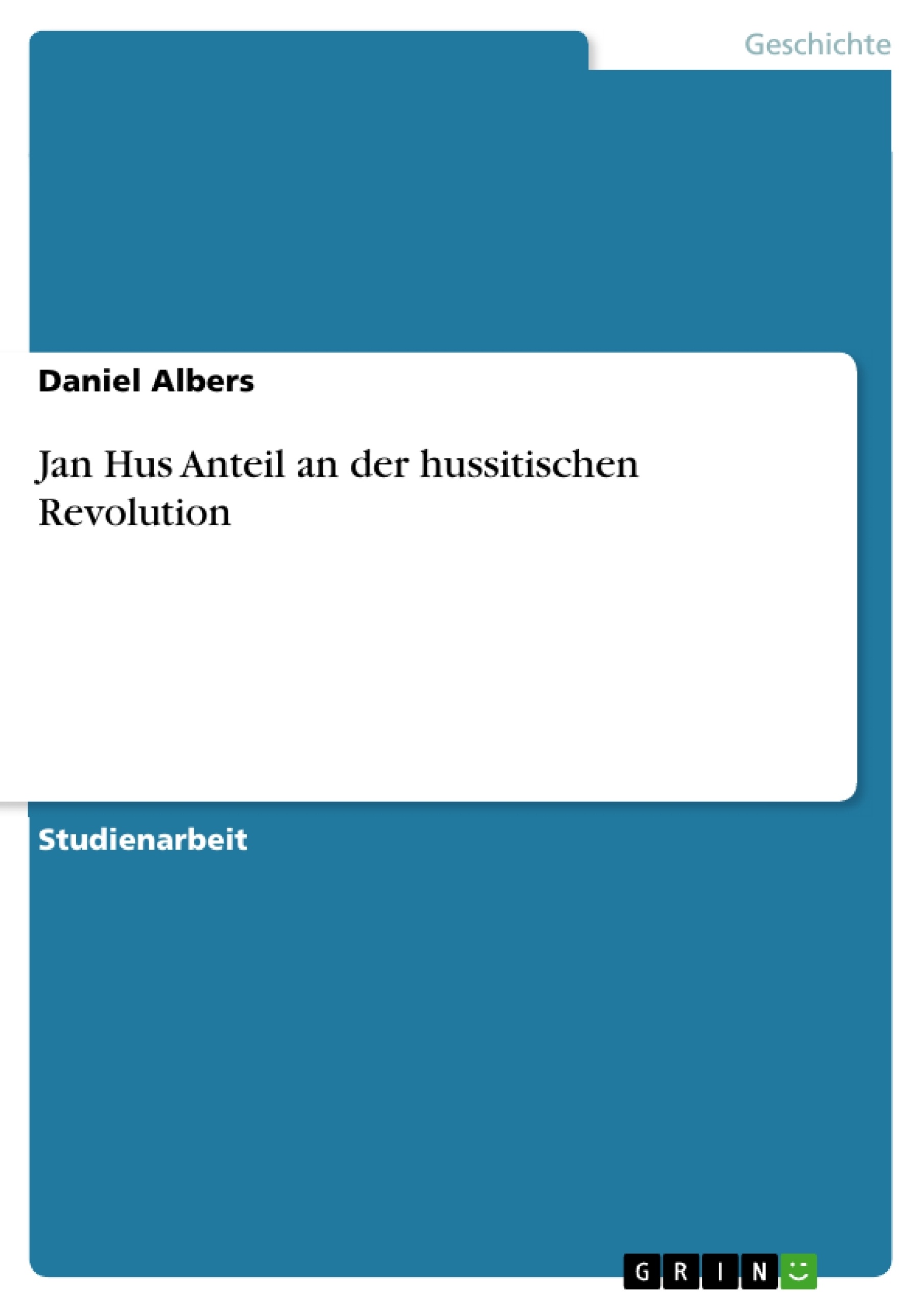Inhaltsverzeichnis
Einleitung 1
1 Böhmen Mitte des 14.Jahrhunderts 2
2 Lebensumstände von Jan Hus 3
3 Die theologischen Standpunkte des Jan Hus 4
3. 1 Hus gegen die Kurie 6
3. 2 Die Kelchkommunion 7
4 Das Kuttenberger Dekret von 1409 8
5 Vom freien Geleit, der freien Rede vor dem Konzil und der freien Auslegung von Predigten und Schriften – Jan Hus in Konstanz 9
6 Fazit 11
7 Quellen- und Literaturverzeichnis 14
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Böhmen Mitte des 14.Jahrhunderts
2 Lebensumstände von Jan Hus
3 Die theologischen Standpunkte des Jan Hus
3. 1 Hus gegen die Kurie
3. 2 Die Kelchkommunion
4 Das Kuttenberger Dekret von
5 Vom freien Geleit, der freien Rede vor dem Konzil und der freien Auslegung von Predigten und Schriften – Jan Hus in Konstanz
6 Fazit
7 Quellen- und Literaturverzeichnis
Einleitung
Die hussitistische Revolution ist für das Nationalbewusstsein der Tschechen seit jeher von immenser Bedeutung. Die Beschäftigung damit brachte gerade auf wissenschaftlicher Ebene schon viele kontroverse Ansichten zutage. Konsens herrscht jedoch heute darüber, dass der Revolution drei Strömungen zugrunde liegen: Eine religiöse, eine nationale und eine demokratische (letztere wurde später eher als „soziale“ Strömung definiert).[1]
Die Bezeichnung der Revolution als „hussitische“ – oftmals wird auch verkürzt von Hussitismus gesprochen – geht auf die Person Jan Hus zurück. Ihm wird von vielen die "Initiatorrolle" dieser Bewegung zugedacht und er wird dementsprechend verehrt. Hier wirft sich die Frage auf, warum er als Anstifter der Aufstände in Böhmen gesehen wird, dessen extremste Ausmaße er selber nicht mehr erleben durfte. So will ich im Folgenden Jan Hus Rolle hierbei untersuchen und dabei prüfen, inwieweit die oben genannten drei Beweggründe der Revolution bei Jan Hus eine Rolle spielten.
Zunächst werde ich einen Blick auf Böhmen vor der Wirkungszeit von Jan Hus werfen, da es da bereits, bedingt durch das große Schisma, Predigten gegen den Status Quo der Kirche gab. Dann werde ich kurz die sozialen Lebensumstände skizzieren, in denen Jan Hus seine Kindheit und Jugend verbracht hat, um dort schon nach Anhaltspunkten für seine späteren Ansichten zu suchen. Das Hauptaugenmerk soll dann auf dem Theologen Jan Hus liegen, wobei seine Standpunkte von der „richtigen“ Kirche, seine Aktivitäten diese durchzusetzen und sein Umgang mit der Kurie untersucht werden. Danach wird ein Ereignis aus dem Jahr 1409, das Dekret von Kuttenberg, im Fokus stehen, welches aus nationaler[2] Perspektive bedeutsam ist. Das alles mündet in seiner Verurteilung und Verbrennung als Ketzer auf dem Konstanzer Konzil. Die Wirkung des Urteils gilt als Auslöser für den Protestbrief des böhmischen Adels und feuerte die Revolution in Böhmen an. Diese Wirkung soll als finaler Punkt in die Untersuchung mit einbezogen werden.
Die Beschäftigung mit Jan Hus und dem Hussitismus in der Forschung begann Mitte des 19.Jahrhunderts und wurde zunächst nur von tschechischen Historikern betrieben, die primär eine nationale Identität in der hussitischen Revolution suchten. Später schalteten sich dann ausländische Historiker, zunächst gehäuft deutsche, in die Thematik ein und stritten um die Träger der Revolution, den Revolutionsbegriff an sich und seine Einordnung in Europa. Dazu wurde versucht, marxistische oder eben nicht-marxistische Tendenzen in der Bewegung zu finden.[3]
Als Quellen in deutscher Sprache kommen lediglich zwei Werke in Frage: Zum einen der Bericht des Peter von Mladoniowitz, einem Schüler von Hus, der ihn in Konstanz begleitet hat.[4] Zum anderen die Schilderungen des Chronisten am Hofe König Wenzels IV. Laurentius von Beszova.[5] Letztere sind jedoch für diese Hausarbeit nur wenig zweckmäßig, da dort die Darstellungen erst nach Hus Tod ansetzen.
1 Böhmen Mitte des 14.Jahrhunderts
Bevor der Blick auf Jan Hus gerichtet wird, soll vorab ein kurzer Abriss von Böhmen in der Zeit vor Hus Wirken angestellt werden. In der Forschung wurde viel über eine allgemein krisenhafte Phase spekuliert. Vornehmlich die Anhänger der marxistischen Interpretation des Hussitismus erkannten schwere Zeiten für die Bauern, die mit hohen Steuern, häufigen Feudalfehden, stagnierender Wirtschaft und vor allem großer Verarmung zu kämpfen hatten. Klassenkämpfe gegen den Adel fanden jedoch nicht statt. Vermutlich kann man daher eher von Schwierigkeiten besonders im landwirtschaftlichen Bereich sprechen, jedoch scheint eine Heraufsetzung zu einer Gesamtkrise zweifelhaft.[6]
Es gab aber eine Institution in dieser Zeit, in der ohne Zweifel krisenhafte Zeiten herrschten, nämlich in der Kirche. Diese hatte neben übermäßigem Einfluss auf Staat und Gesellschaft auch noch übermäßig viel Reichtum in ihrem Besitz, sodass die Unruhen in der Bevölkerung, zumal viele Priester ihrem Amt zum Trotz einen unmoralischen Lebensstil pflegten, stetig stiegen. So traten schon vor Jan Hus, und bevor die Schriften Wiklifs, die Hus später als Vorlage dienten, in Böhmen in Umlauf kamen, Priester und Laien hervor, um offen gegen diese Missstände in der Kirche zu sprechen. Ich möchte hier drei Personen aufführen, die sich besonders hervortaten: Konrad Waldhauser setzte sich für eine Sittenreform ein. Milic von Kremsier verzichtete auf seine Kanonikatspfründe, lebte freiwillig in Armut und dessen Schüler Matthias von Janov predigte von dem Nutzen einer armen Kirche.[7]
2 Lebensumstände von Jan Hus
Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass Jan Hus in einem Böhmen zur Welt kam, dass bereits von kirchenkritischen Strömungen durchtränkt gewesen war. Vermutlich im Jahr 1370 soll Hus das Licht der Welt in dem südböhmischen Husinec erblickt haben.[8] Eindeutig belegt ist diese Angabe jedoch nicht; für Werner könnte auch schon 1369 als Geburtsjahr in Betracht kommen.[9] Ebenso ist der Beruf des Vaters nicht handfest gesichert. Seibt charakterisiert ihn als Fuhrmann.[10] In einem Punkt, und dieser ist der entscheidende für uns, sind sich jedoch sowohl Seibt und Werner, als auch alle anderen Historiker vermutlich einig, nämlich dass Jan Hus in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. So ist überliefert, dass er während seiner Studienzeit Vigilien sang, in der Hoffnung auf Entgelt, um davon leben zu können. Nach eigenen Äußerungen war es sein sehnlichster Wunsch schnell Priester zu werden, um sich eine gute Wohnung und schicke Kleidung leisten zu können. Die intensive Beschäftigung mit der „heiligen Schrift“ führte ihm jedoch das Sündhafte dieses Begehrens vor Augen.[11] Die ärmlichen Verhältnisse, in denen Jan Hus aufwuchs, sind neben seinen Folgerungen aus der Lektüre der Bibel, wohl entscheidend für seinen späteren energischen Einsatz gegen den übermäßigen Reichtum in der Kirche. Um seine weiteren theologischen Ansichten soll es nun im Folgenden gehen.
3 Die theologischen Standpunkte des Jan Hus
Ich habe zu Beginn meiner Arbeit bereits auf die Missstände in der Kirche hingewiesen, die schon im 14.Jahrhundert böhmische Gelehrte dazu veranlassten Kritik an der Kirche zu üben. Neben dem Schisma, also der Kirchenspaltung in sich selbst, waren es vor allem der Verkauf von Pfründen und Ablässen, das sündige Leben vieler Geistlicher und das Eindringen der Kirche in die weltliche Kirche, die viele Menschen von der Kirche abstießen.[12] Jan Hus predigte seine Vorstellungen von der richtigen Kirche in der Bethlehemskapelle in Prag. Seine Vorstellungen gewann er, wie angesprochen, durch seine ärmliche Herkunft, sein Studium, dort speziell der intensiven Beschäftigung mit der Bibel, sowie durch die Schriften des Theologen John Wyclif.[13] Jan Hus wurde zwar später als „Wyclifit“, also Anhänger von John Wyclif, bezeichnet, jedoch sympathisierte er anfangs nur mit dessen philosophischen Ansichten, aus Angst als Ketzer denunziert zu werden.[14] Auch später, sowie auch zuletzt vor dem Konstanzer Konzil, war Hus bei 32 Artikeln von den 45, die Wyclif proklamiert hatte, anderer Meinung als Wyclif. Punkte, die Wyclif ablehnte, aber die aber für Hus weiterhin Gültigkeit haben sollten, waren z.B. das sakramentale Priestertum, die Hierarchie in der Kirche, der Gedanke des Fegefeuers sowie die eucharistische Transsubstantiation.[15] Neben diesen sichtbaren Elementen der Kirche, war es Hus Hauptanliegen, eine unsichtbare Kirche zu verwirklichen. Nach seiner Ansicht gehörte man nicht dadurch zur kirchlichen Gemeinschaft, dass man einer kirchlichen Gemeinde beigetreten war oder ein kirchliches Amt bekleidete, sondern dadurch, dass man moralisch nach der vorgegebenen Lebensweise der Bibel lebte. Laut Hus war auch ein Mensch ohne Priesteramtsausbildung befähigt zu predigen. Hus war Realist, das heißt er wollte das Ideal der Kirche nach seinen Vorstellungen verändern. Auf der anderen Seite, z.B. Hus „Gegner“ in Konstanz, gab es die Nominalisten: Sie wollten die Kirche nur innerhalb der bereits bestehenden Strukturen reformieren.[16] Laut Köpf war diese Grundidee der katholischen Kirche von Hus nicht mit der biblischen Auffassung von Kirche verbunden, sodass er annimmt, Hus habe sie von Platons Ideenlehrer abgeleitet.[17] Ein weiterer Kernpunkt von Hus religiösen Ansichten war die Stellung des Papstes. Für ihn war nicht der Papst das Oberhaupt der Kirche, sondern Christus. Demnach konnte auch kein Papst oder Priester jemanden die Sünden erlassen, wenn nicht vorher Gott oder Christus[18] das getan hatte. Hus stellte die Stellvertreter-Funktion des Papstes vollends in Frage. Der Papst durfte laut Hus nur insoweit als Stellvertreter Gottes bezeichnet werden, inwieweit er nach dem Gesetz Christi lebte. Hier findet sich wieder Hus wichtiger Punkt der moralischen Lebensweise wieder. Hus ging bei der Machtfrage in der Hierarchie noch weiter und postulierte, dass die Priesterschaft diese innehaben sollte und nicht der Papst und der Klerus.[19]
[...]
[1] z.B. bei SEIBT, Ferdinand: Hussitica. Zur Struktur einer Revolution, Köln 1965, S. 5.
[2] Begriffe wie „national“ und „Nation“ sind für das Spätmittelalter eher prekär. Da eine treffende Umschreibung schwierig ist, sollen sie hier dennoch im Sinne von „das tschechische Volk betreffend“ verstanden werden.
[3] Eine ausführliche Darlegung des Forschungsstandes bietet ŠMAHEL, František: Die hussitische Revolution I. (Monumenta Germaniae Historica, Band 43), Hannover 2002, S. 1- 64.
[4] Petrus de Mladenowicz: Hus in Konstanz. Der Bericht des Peter von Mladoniowitz (Slawische Geschichtsschreiber Bd.III), übersetzt, eingeleitet und erklärt von Josef Bujnoch, Graz 1963.
[5] Die Hussiten. Die Chronik des Laurentius von Beszova 1414-1421 (Slavische Geschichtsschreiber, Band XI), übersetzt, eingeleitet und erklärt Josef Bujnoch, Graz 1988.
[6] WERNER, Ernst: Jan Hus. Welt und Umwelt eines Prager Frühreformators ( Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte Bd.34), Weimar 1991, S.21 – 29.
[7] Ebd. S.31- 41.
[8] Vgl. SEIBT, Ferdinand: Hussitenstudien. Personen, Ereignisse, Ideen einer frühen Revolution (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum Bd.60), 2.Aufl., München 1991, S. 167.
[9] Vgl. WERNER, S. 66.
[10] Vgl. SEIBT, 1991, S. 167.
[11] Da ich die direkten Quellen zu Hus Äußerungen nicht auftreiben konnte, verweise ich auf die Angaben bei WERNER, S.66.
[12] Vgl. FUNDA, Otakar A.: Jan Hus. Märtyrer des moralischen Anspruchs, in: Theologen des Mittalters, hrsg. von Ulrich Köpf, Darmstadt 2002, S.228.
[13] John Wyclif (ca.1330- 1384) war ein englischer Philosoph, Theologe und Kirchenreformer. Er setzte sich in seinem Land für eine grundlegende Reform der Kirche ein, z.B. lehnte er die Transsubstantiation ab. An seinen Ansichten orientierten sich später die Lollarden in England. Für eine genauere Betrachtung der Person John Wyclif verweise ich auf BENRATH, Gustaf Adolf: John Wyclif. Doctor evangelicus, in: Theologen des Mittelalters, hrsg. v. Ulrich Köpf, Darmstadt 2002, S. 197-212.
[14] Vgl. WERNER, S.74.
[15] Vgl. SEIBT, 1991, S. 169.
[16] Vgl. FUNDA, S.231ff.
[17] Vgl. Ebd. S. 231.
[18] Trinität: Gott (der Vater), Jesus Christus (der Sohn) und der Heilige Geist bilden eine Wesenseinheit in der christlichen Theologie.
[19] Vgl. ebd. S. 23 ff.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte Jan Hus in der hussitischen Revolution?
Jan Hus gilt als Initiator der Bewegung. Seine theologischen Lehren und sein Tod als Märtyrer dienten als Auslöser für die Aufstände in Böhmen.
Was waren die zentralen theologischen Forderungen von Jan Hus?
Hus forderte eine Rückkehr zur armen Kirche, lehnte den Ablasshandel ab und betonte, dass Christus das wahre Oberhaupt der Kirche sei, nicht der Papst.
Was ist das Kuttenberger Dekret von 1409?
Es war eine nationale Neuregelung der Stimmenverhältnisse an der Prager Universität, die den Tschechen mehr Einfluss gegenüber den anderen „Nationen“ einräumte.
Wie beeinflusste die Herkunft von Jan Hus seine Ansichten?
Hus wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, was maßgeblich zu seinem späteren Einsatz gegen den übermäßigen Reichtum und die Sittenlosigkeit des Klerus beitrug.
Warum wurde Jan Hus in Konstanz verurteilt?
Er wurde auf dem Konstanzer Konzil als Ketzer verurteilt, da er sich weigerte, seine kirchenkritischen Thesen, die teilweise auf John Wyclif basierten, zu widerrufen.
- Citar trabajo
- Daniel Albers (Autor), 2012, Jan Hus Anteil an der hussitischen Revolution, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/206904