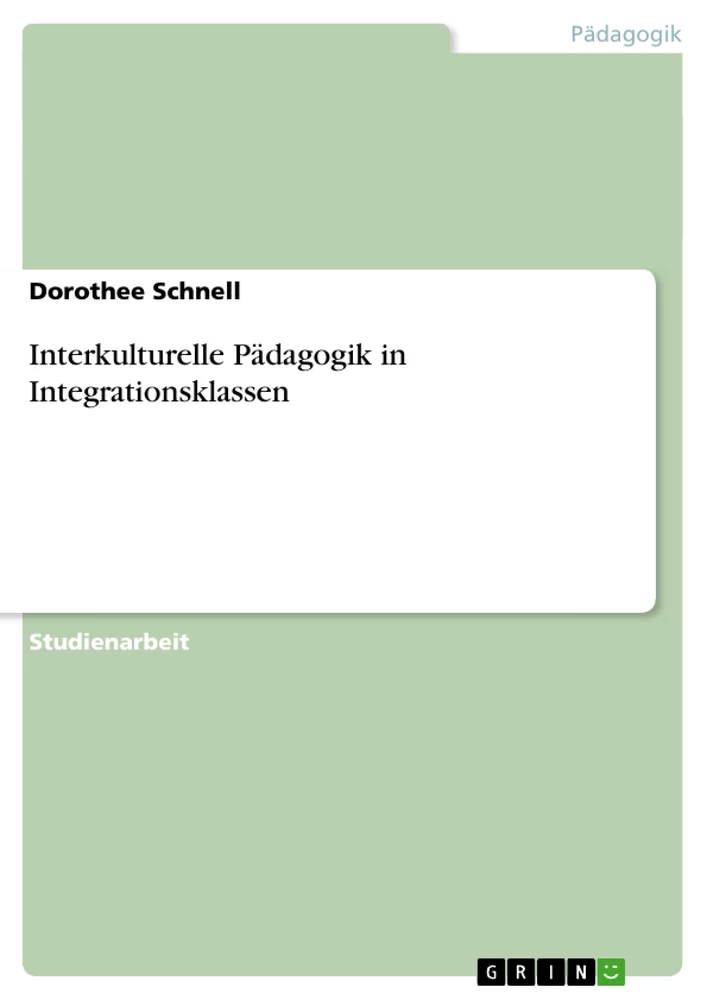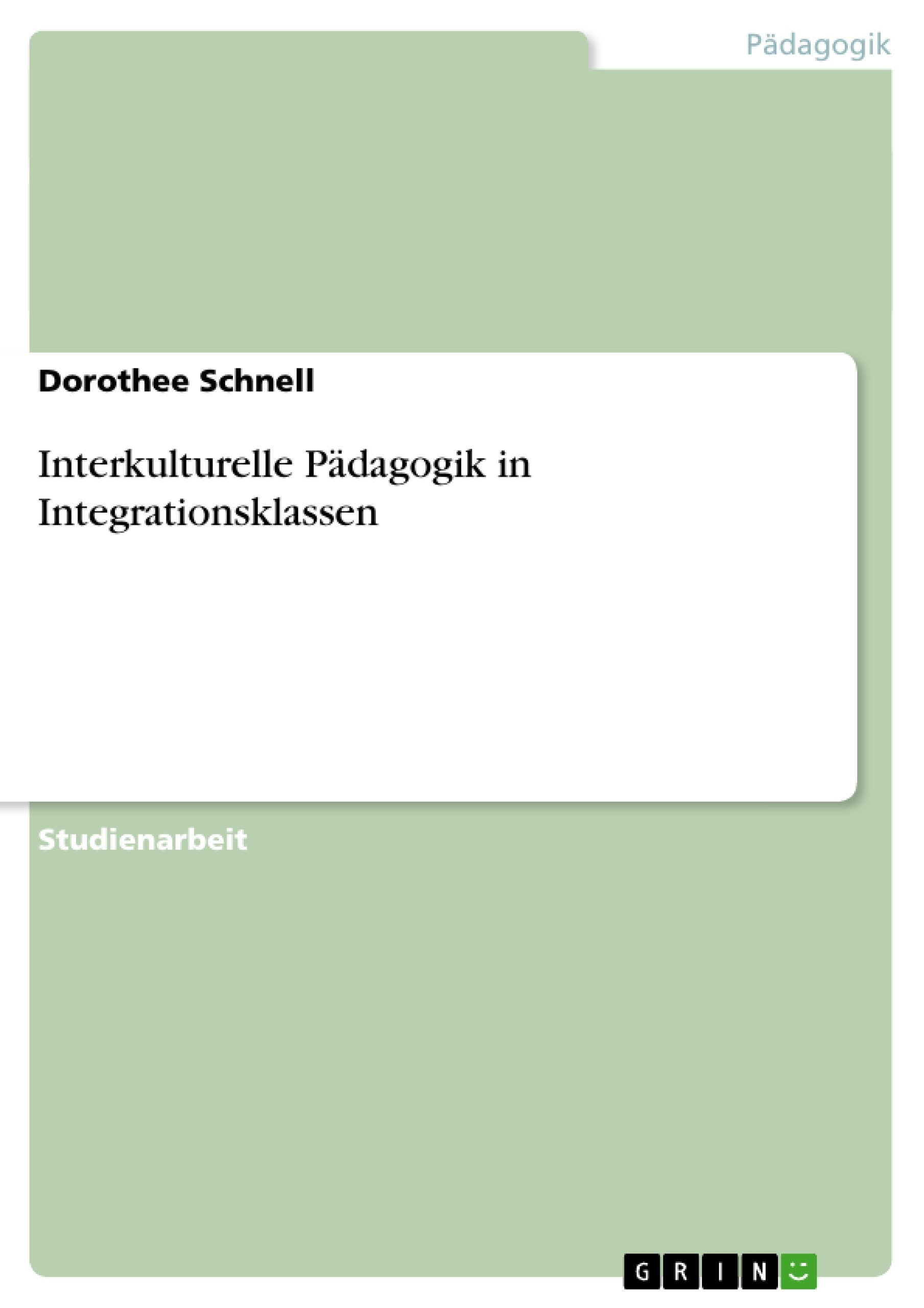Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Situation von Migrantenkindern in Integrationsklassen.
Nach einer grundsätzlichen Definition von "Interkulturell", wird die Situation von Migranten an Förderschulen beleuchtet.
Verschiedene Auffassungen interkultureller Pädagogik werden diskutiert und auf die Realisierung eingegangen.
Schulversagen, Rassismus und die Geschlechterfrage werden ebenfalls angesprochen.
Das Resumée bezieht sich insbesondere auf die Gestaltung der Lehramststudiengänge, ohne das Theorie-Praxis-Problem dabei zu vergessen.
Am Ende wird das Beispiel einer Berliner Schule angeführt, die auf dem Weg zur "Schule für alle Kinder" ist.
Diese Arbeit zeigt wesentliche Gedanken der aktuellen Diskussion auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1 DEFINITION: INTERKULTURELL
- 2 DIE MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT
- 2.1 Pädagogische Maßnahmen zur Migrantenpolitik
- 3 DIE SITUATION DER MIGRANTEN AN SONDERSCHULEN
- 4 ANSÄTZE UND KONZEPTE ZUR INTERKULTURELLEN PÄDAGOGIK
- 4.1 Interkulturelle Erziehung als Erziehung zur internationalen Verständigung vor der eigenen Haustür (J. Zimmer, freie Uni Berlin 1988)
- 4.2 Interkulturelle Bildung als Allgemeinbildungsauftrag (Hans H. Reich, Uni Landau 1993)
- 4.3 Fremdes verfremden durch interkulturellen Unterricht (J. Schröder, Uni Tübingen 1994)
- 4.4 Thesen für eine antirassistisch geprägte Schule (D. Pagel, 2.Oberschule Berlin-Kreuzberg 1993)
- 4.5 Interkulturelle Erziehung als Friedenserziehung und als antirassistische Erziehung (H. Essinger, freie Uni Berlin 1986/1993)
- 5 KONZEPTIONEN UND MATERIALIEN FÜR DEN INTERKULTURELLEN UNTERRICHT – REALISATION UND WIRKUNG IN DER SCHULE (M. HOHMANN U. W. NIEKE)
- 6 DIE EINSEITIGE BEARBEITUNG DER „GESCHLECHTERFRAGE“ IN DER INTERKULTURELLEN PÄDAGOGIK
- 7 URSACHEN UND ERKLÄRUNGSMODELLE FÜR DAS SCHULVERSAGEN
- 7 DIE PROFESSIONALISIERUNGSDEBATTEN DER INTERKULTURELLEN ERZIEHUNG
- 8 RESUMÉE: DIE QUALIFIKATION FÜR DEN ARBEITSPLATZ MULTIKULTURELLE SCHULE BLEIBT EINE ZENTRALE AUFGABE DER LEHRAMTSSTUDIENGÄNGE
- 8 EMPFEHLUNG FÜR DIE GESTALTUNG DES LEHRAMTSSTUDIUMS
- 8.1 Die Studienbausteine
- 8.2 Voraussetzung für die Abstimmung pädagogischer Profilentwicklung auf die multikulturelle und mehrsprachige Zusammensetzung in Klassen ist:
- 8.3 ANFORDERUNGEN AN DIE LEHRER
- 10 DAS THEORIE-PRAXIS-PROBLEM DER INTERKULTURELLEN PÄDAGOGIK
- 11 BERLIN AUF DEM WEG ZU EINER SCHULE FÜR ALLE KINDER – EIN BEISPIEL DES GEMEINSAMEN UNTERRICHTS VON SCHÜLERN MIT UND OHNE BEHINDERUNGEN
- 11.1 INTEGRATION VON KINDERN MIT NICHTDEUTSCHER MUTTERSPRACHE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Konzepte der interkulturellen Pädagogik in Integrationsklassen in Deutschland. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der multikulturellen Gesellschaft Deutschlands und analysiert verschiedene Ansätze und Theorien der interkulturellen Erziehung. Die Arbeit befasst sich auch mit der Rolle der Lehrkräfte und den notwendigen Qualifikationen für den Umgang mit der Vielfalt in Schulen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Interkulturell“
- Entwicklung der multikulturellen Gesellschaft in Deutschland
- Ansätze und Konzepte interkultureller Pädagogik
- Herausforderungen und Probleme im interkulturellen Unterricht
- Qualifikationsbedarf von Lehrkräften im interkulturellen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1 DEFINITION: INTERKULTURELL: Dieses Kapitel analysiert den Begriff "Interkulturell" und differenziert ihn vom Begriff "Multikulturell". Es werden verschiedene Definitionen diskutiert, die den Fokus auf Interaktion, Austausch und die Überwindung kultureller Grenzen legen. Die Uneindeutigkeit des Begriffs "Inter" wird hervorgehoben, wobei verschiedene Interpretationen bezüglich der Rolle der Erziehung im interkulturellen Kontext beleuchtet werden. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der zentralen Thematik der Arbeit.
2 DIE MULTIKULTURELLE GESELLSCHAFT: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung Deutschlands zu einer multikulturellen Gesellschaft seit den 1950er Jahren. Es werden die drei Hauptformen der Einwanderung – arbeitsmarktbezogen, durch Aussiedler und durch Flucht und Vertreibung – detailliert dargestellt. Der Fokus liegt auf den Folgen der Arbeitskräfteanwerbung für das deutsche Schulsystem, insbesondere auf den Anstieg der Schülerzahlen mit Migrationshintergrund und die ungleiche Verteilung dieser Schüler über die verschiedenen Regionen Deutschlands. Der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland in Bezug auf die Migrationsgeschichte und deren Auswirkungen auf die Schulen wird deutlich gemacht.
4 ANSÄTZE UND KONZEPTE ZUR INTERKULTURELLEN PÄDAGOGIK: Das Kapitel präsentiert verschiedene Ansätze und Konzepte der interkulturellen Pädagogik, die unterschiedliche Schwerpunkte und Perspektiven aufzeigen. Die Beiträge von Zimmer, Reich, Schröder, Pagel und Essinger werden vorgestellt. Sie repräsentieren eine Bandbreite an Sichtweisen, von der internationalen Verständigung bis hin zur antirassistischen Erziehung. Das Kapitel veranschaulicht die Vielschichtigkeit des Feldes und die Notwendigkeit eines differenzierten Verständnisses.
5 KONZEPTIONEN UND MATERIALIEN FÜR DEN INTERKULTURELLEN UNTERRICHT – REALISATION UND WIRKUNG IN DER SCHULE (M. HOHMANN U. W. NIEKE): Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung interkultureller Konzepte im Unterricht. Es analysiert Konzeptionen und Materialien, die im Schulkontext Anwendung finden, und untersucht deren Wirkung. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der Evaluation von didaktischen Ansätzen und deren Einfluss auf den Lernerfolg und die Integration von Schülern mit Migrationshintergrund.
6 DIE EINSEITIGE BEARBEITUNG DER „GESCHLECHTERFRAGE“ IN DER INTERKULTURELLEN PÄDAGOGIK: Dieses Kapitel kritisiert die einseitige Behandlung der Geschlechterfrage innerhalb der interkulturellen Pädagogik. Es beleuchtet vermutlich mögliche Vernachlässigungen oder verkürzte Perspektiven in Bezug auf Geschlechterrollen und -verhältnisse in unterschiedlichen Kulturen. Die Kritik fokussiert wahrscheinlich auf Lücken und Ungleichgewichte in der bisherigen Forschung und Praxis des Faches.
7 URSACHEN UND ERKLÄRUNGSMODELLE FÜR DAS SCHULVERSAGEN: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen und Erklärungsmodelle für das Schulversagen von Schülern mit Migrationshintergrund. Es analysiert möglicherweise soziale, kulturelle und sprachliche Faktoren, die zum Schulversagen beitragen können, und bewertet verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung dieses Problems. Der Schwerpunkt dürfte auf der Identifizierung von Risikofaktoren und der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Schulversagen liegen.
8 RESUMÉE: DIE QUALIFIKATION FÜR DEN ARBEITSPLATZ MULTIKULTURELLE SCHULE BLEIBT EINE ZENTRALE AUFGABE DER LEHRAMTSSTUDIENGÄNGE: Dieses Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und betont die Bedeutung einer angemessenen Ausbildung von Lehrkräften für den Umgang mit multikulturellen und mehrsprachigen Lerngruppen. Es werden Empfehlungen für die Gestaltung des Lehramtsstudiums formuliert, um die zukünftigen Lehrkräfte optimal auf die Herausforderungen der interkulturellen Pädagogik vorzubereiten.
11 BERLIN AUF DEM WEG ZU EINER SCHULE FÜR ALLE KINDER – EIN BEISPIEL DES GEMEINSAMEN UNTERRICHTS VON SCHÜLERN MIT UND OHNE BEHINDERUNGEN: Dieses Kapitel präsentiert ein Beispiel für gelungene Inklusion in Berlin, vermutlich am Beispiel des gemeinsamen Unterrichts von Schülern mit und ohne Behinderungen. Es wird die Integration von Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache im Kontext der Inklusion beleuchtet und wahrscheinlich erfolgreiche Strategien und positive Praxiserfahrungen beschrieben.
Häufig gestellte Fragen zu: Interkulturelle Pädagogik in Integrationsklassen
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Konzepte der interkulturellen Pädagogik in Integrationsklassen in Deutschland. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der multikulturellen Gesellschaft, analysiert verschiedene Ansätze und Theorien der interkulturellen Erziehung und befasst sich mit der Rolle der Lehrkräfte und deren notwendigen Qualifikationen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Definition und Abgrenzung des Begriffs "Interkulturell", die Entwicklung der multikulturellen Gesellschaft in Deutschland, verschiedene Ansätze und Konzepte interkultureller Pädagogik, Herausforderungen und Probleme im interkulturellen Unterricht sowie der Qualifikationsbedarf von Lehrkräften im interkulturellen Kontext. Zusätzlich werden die Ursachen und Erklärungsmodelle für Schulversagen bei Schülern mit Migrationshintergrund untersucht und die einseitige Behandlung der Geschlechterfrage in der interkulturellen Pädagogik kritisiert. Ein Beispiel für gelungene Inklusion in Berlin wird ebenfalls vorgestellt.
Welche Ansätze und Konzepte der interkulturellen Pädagogik werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Ansätze und Konzepte, unter anderem von Zimmer (internationale Verständigung), Reich (interkulturelle Bildung als Allgemeinbildungsauftrag), Schröder (Fremdes verfremden durch interkulturellen Unterricht), Pagel (antirassistische Schule) und Essinger (interkulturelle Erziehung als Friedens- und antirassistische Erziehung). Diese repräsentieren eine Bandbreite an Sichtweisen auf das Thema.
Wie wird die multikulturelle Gesellschaft Deutschlands dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung Deutschlands zu einer multikulturellen Gesellschaft seit den 1950er Jahren, detailliert die drei Hauptformen der Einwanderung (arbeitsmarktbezogen, Aussiedler, Flucht und Vertreibung) und deren Folgen für das deutsche Schulsystem, insbesondere den Anstieg von Schülern mit Migrationshintergrund und deren ungleiche Verteilung.
Welche Rolle spielen die Lehrkräfte und deren Qualifikation?
Die Arbeit betont die zentrale Bedeutung einer angemessenen Ausbildung von Lehrkräften für den Umgang mit multikulturellen und mehrsprachigen Lerngruppen. Sie formuliert Empfehlungen für die Gestaltung des Lehramtsstudiums, um zukünftige Lehrkräfte optimal auf die Herausforderungen der interkulturellen Pädagogik vorzubereiten. Die notwendigen Anforderungen an Lehrkräfte im interkulturellen Kontext werden ebenfalls beleuchtet.
Wie wird das Thema Schulversagen von Schülern mit Migrationshintergrund behandelt?
Die Arbeit untersucht die Ursachen und Erklärungsmodelle für das Schulversagen von Schülern mit Migrationshintergrund, analysiert soziale, kulturelle und sprachliche Faktoren und bewertet verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung dieses Problems. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung von Risikofaktoren und der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Schulversagen.
Wie wird das Beispiel Berlin behandelt?
Die Arbeit präsentiert ein Beispiel für gelungene Inklusion in Berlin, am Beispiel des gemeinsamen Unterrichts von Schülern mit und ohne Behinderungen. Die Integration von Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache im Kontext der Inklusion wird beleuchtet und erfolgreiche Strategien und Praxiserfahrungen beschrieben.
Welche Kritikpunkte werden in der Arbeit angesprochen?
Ein Kapitel kritisiert die einseitige Behandlung der Geschlechterfrage innerhalb der interkulturellen Pädagogik, beleuchtet mögliche Vernachlässigungen oder verkürzte Perspektiven in Bezug auf Geschlechterrollen und -verhältnisse in unterschiedlichen Kulturen und weist auf Lücken und Ungleichgewichte in der bisherigen Forschung und Praxis hin.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Kapitelzusammenfassungen, die die Kernaussagen und den Fokus jedes Kapitels kurz und prägnant beschreiben. Diese Zusammenfassungen bieten einen guten Überblick über den Inhalt der gesamten Arbeit.
- Quote paper
- Dorothee Schnell (Author), 2003, Interkulturelle Pädagogik in Integrationsklassen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20738