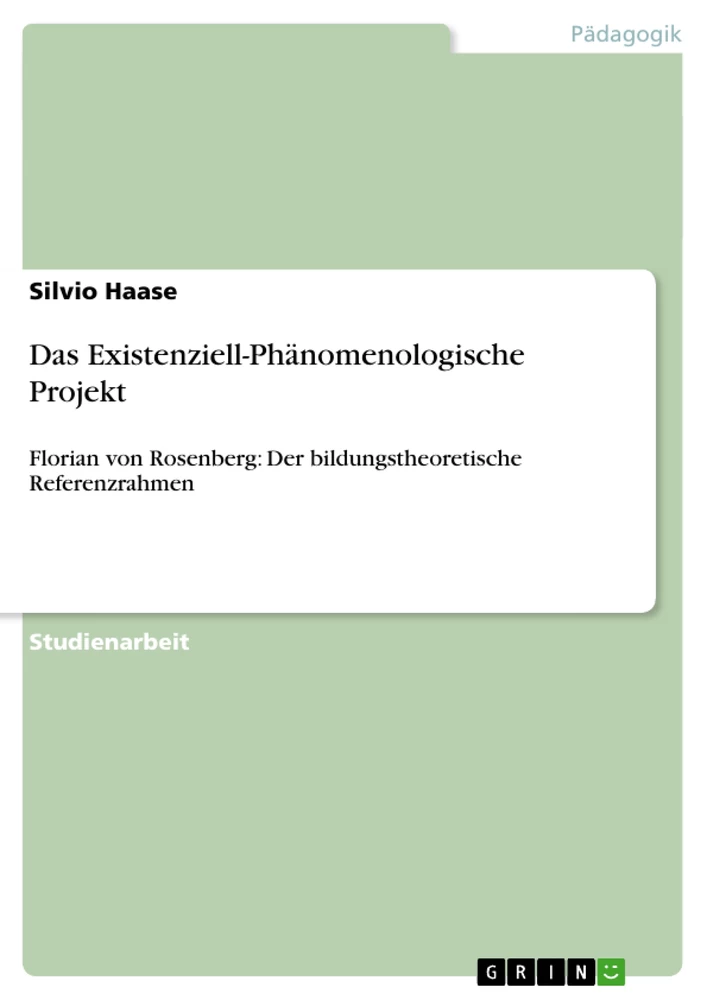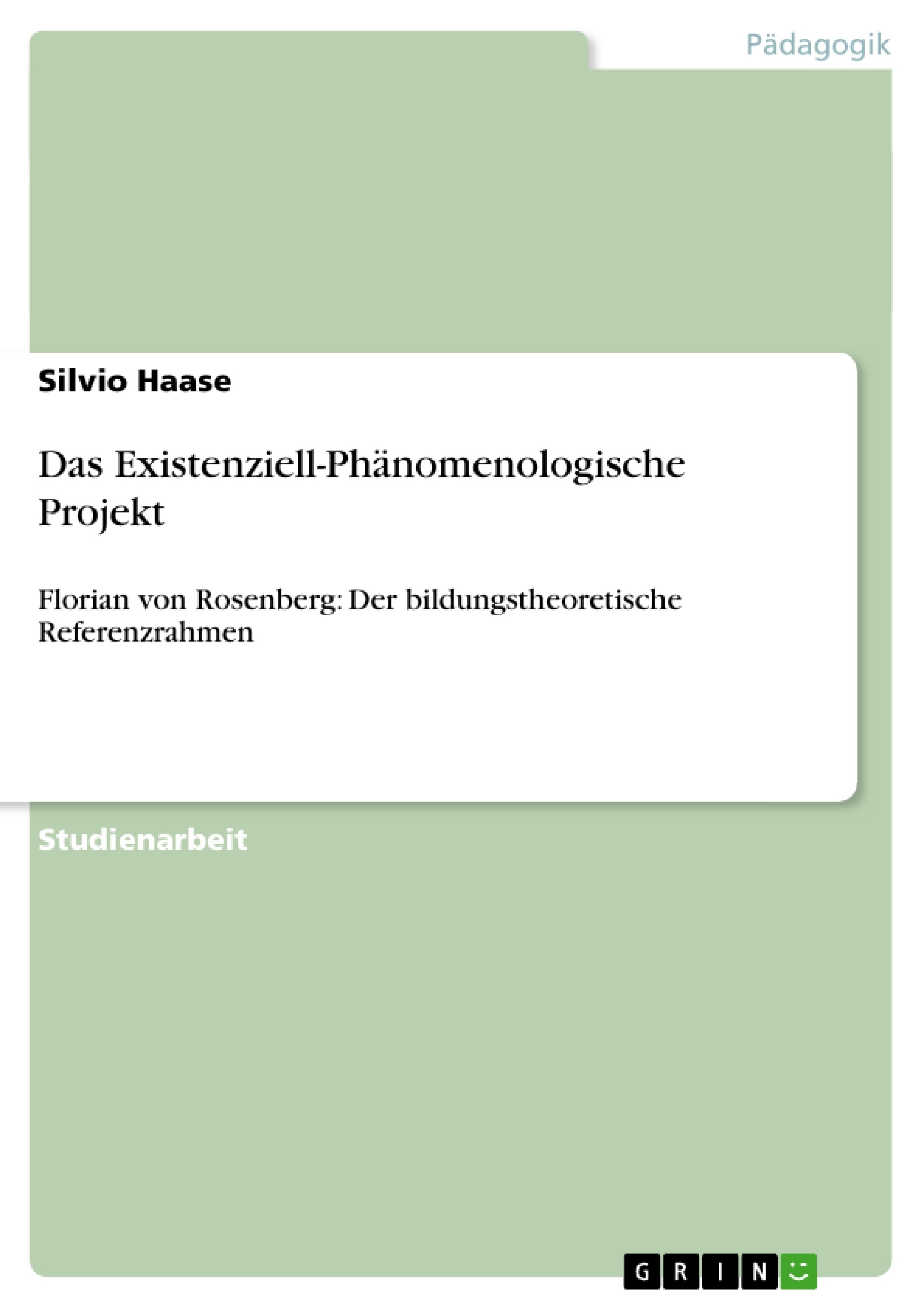Dr. Florian von Rosenberg, Mitarbeiter der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, beschreibt in seiner Monographie „Bildung und Habitustransformation“ einen Bildungsbegriff angelehnt an das existenziell-phänomenologische Konzept von Winfried Marotzki. Ziel dieser Theorie ist eine „empirisch gehaltvolle Bildungstheorie“ . In Bezug auf die postmoderne Gesellschaft wird versucht Theorie und Forschung „in ein fruchtbares Wechselverhältnis zu bringen.“ Um hier ein Verständnis dieser Arbeit aufbauen zu können, ist es nötig, die Postmoderne näher zu betrachten.
Die postmoderne Gesellschaft kann treffend wie folgt verstanden werden. Den Boden der Postmoderne bildet die Erosion der Sozialstruktur, man könnte es auch als eine „radikale Enttraditionalisierung der Lebensformen“ bezeichnen, welche neue Möglichkeiten zur Individuellen Entfaltung eines Jeden hervorbringt, Dann kommt es durch eben diese Erosion zu einem Verlust der Orientierungsverbindlichkeiten.
Marotzki folgend, setzt von Rosenberg die Bildungstheorie also in den Rahmen der Postmoderne und zeigt somit die Bedingungen auf, eben diese Theorie in einen Zusammenhang mit Fremdheit zu bringen. Zum Verständnis dieser Bedingungen ist es wichtig, sich mit der Sinnklammer zu beschäftigen und den Prozess der Negation zu klären. Dies kann einen Hinweis darauf geben, ob Bildung ohne Fremdheit überhaupt möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sinnklammer
- Neuer Zugang zu Mustern der Erfahrungsverarbeitung
- Negation
- Negation und der Bildungsbegriff
- Negation und Fremdheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der bildungstheoretischen Perspektive von Florian von Rosenberg, der auf Basis des existenziell-phänomenologischen Konzepts von Winfried Marotzki eine „empirisch gehaltvolle Bildungstheorie“ entwickelt. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Sinnklammer und des Prozesses der Negation im Rahmen der Postmoderne und untersucht, wie diese Konzepte für ein Verständnis von Bildung und Fremdheit relevant sind.
- Die Relevanz der Sinnklammer für die Bildungstheorie
- Der Einfluss von Negation auf die Erfahrungsverarbeitung
- Die Verbindung von Bildung und Fremdheit in der Postmoderne
- Die Rolle der individuellen Erfahrung in der Bildung
- Die Herausforderungen der Bildung in einer enttraditionalisierten Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Buch von Florian von Rosenberg „Bildung und Habitustransformation“ vor, das sich an der existenziell-phänomenologischen Bildungstheorie von Winfried Marotzki orientiert. Die Einleitung erklärt die Bedeutung der Postmoderne für die Bildungstheorie und die Notwendigkeit, die Konzepte der Sinnklammer und der Negation zu verstehen.
Die Sinnklammer
Dieses Kapitel erklärt den Begriff der Sinnklammer, den Winfried Marotzki eingeführt hat. Die Sinnklammer beschreibt den Rahmen, durch den ein Individuum die Welt wahrnimmt und Erfahrungen verarbeitet. Sie gibt dem Subjekt einen „Ort im Sein“ und beeinflusst die subjektive Interpretation der Welt.
Neuer Zugang zu Mustern der Erfahrungsverarbeitung
Dieses Kapitel analysiert, wie durch die Distanzierung von der Sinnklammer, die als Negation bezeichnet wird, neue Muster der Erfahrungsverarbeitung entstehen. Die Negation ist die Grundlage für einen Bildungsprozess, der durch die Herstellung von Bestimmtheit aus Unbestimmtheitspotenzialen gekennzeichnet ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der existenziell-phänomenologischen Bildungstheorie, der Sinnklammer, der Negation, der Erfahrungsverarbeitung, der Bildung in der Postmoderne und der Beziehung von Bildung und Fremdheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Sinnklammer" nach Marotzki?
Die Sinnklammer ist der Rahmen, durch den ein Individuum die Welt interpretiert und seine Erfahrungen strukturiert.
Welche Rolle spielt die Negation im Bildungsprozess?
Negation bezeichnet die Distanzierung von gewohnten Mustern, was notwendig ist, um neue Lernerfahrungen und Bildung zu ermöglichen.
Wie definiert von Rosenberg Bildung in der Postmoderne?
Er sieht Bildung als einen Prozess der Habitustransformation, der auf individueller Erfahrung und der Auseinandersetzung mit Fremdheit basiert.
Ist Bildung ohne Fremdheit möglich?
Die Arbeit deutet darauf hin, dass erst die Begegnung mit dem Fremden (Negation des Eigenen) echte Bildungsprozesse auslöst.
Was kennzeichnet die postmoderne Gesellschaft hierbei?
Sie ist durch den Verlust von Orientierungsverbindlichkeiten und eine radikale Enttraditionalisierung der Lebensformen geprägt.
- Citation du texte
- Silvio Haase (Auteur), 2012, Das Existenziell-Phänomenologische Projekt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207399