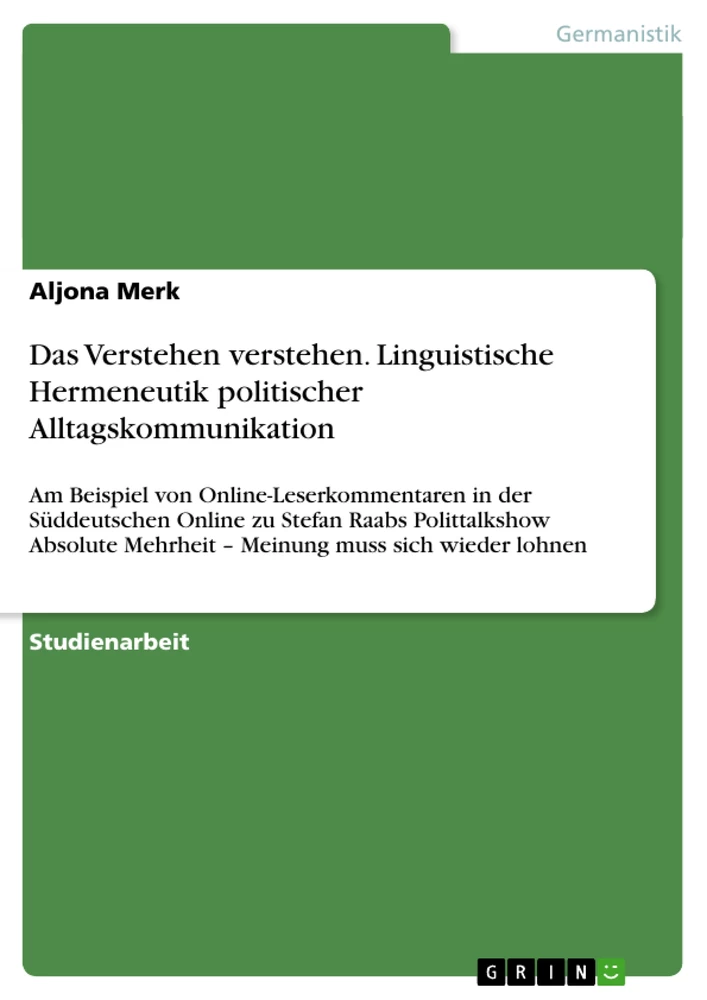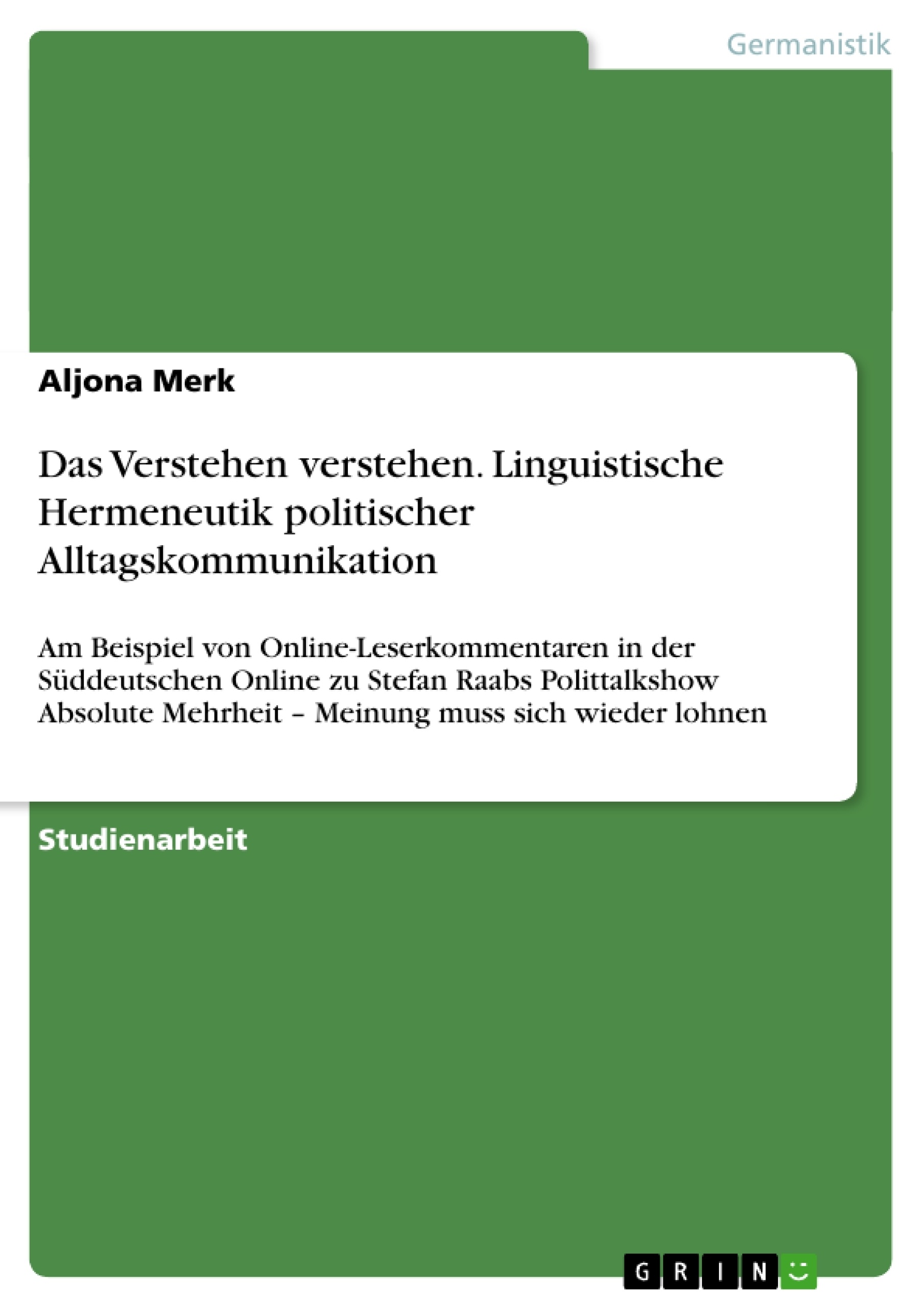Wie können Rezipienten und ihr Sprechen über Politik und folglich ihr Verstehen politischer Texte in linguistischen Arbeiten untersucht werden? Wie kann man sich aus linguistischer Sicht an das Verstehen, welches zwangsläufig immer nur approximativ geschehen kann, annähern, wie es schaffen, „die ‚unendliche Aufgabe‘, nicht nur Sprache zu verstehen, sondern auch noch ‚Verstehen‘ zu verstehen, zu bewältigen?“ (Biere 2007: 264) Um diese Frage soll es in der vorliegenden Arbeit gehen. Hierfür muss zunächst ein theoretischer Rahmen mit einem Sprachbegriff erarbeitet werden, mit welchem politische Texte als ein „Angebotsspektrum für das Verstehen“ (Klein 2006: 23) gedacht werden können [Kapitel 1]. Anschließend werden Überlegungen im Hinblick auf methodische Anforderungen angestellt, um einen Vorschlag zu machen, wie das Verstehen politischer Texte des Normalbürgers linguistisch-empirisch untersucht werden könnte [Kapitel 2]. Diesen Vorschlag gilt es schließlich, an einer (notwendigerweise skizzenhaften) Bei-spielanalyse zu erproben [Kapitel 3].
Inhaltsverzeichnis
- 0. Hinführung
- 1. Theoretische Überlegungen
- 2. Korpus und Methode
- 3. Eine Beispielanalyse: Die Polittalkshow Absolute Mehrheit
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Verstehen von politischen Texten aus der Perspektive des Rezipienten und untersucht die Rolle des Rezipienten in der politischen Kommunikation. Dabei werden theoretische Grundlagen für eine empirische Hermeneutik in der Politolinguistik erarbeitet, um methodische Ansätze für die linguistische Analyse des Rezipientenverstehens zu entwickeln.
- Die Konstituierung von Wirklichkeit durch Sprache
- Die Bedeutung des Sprachspiels im Kontext von Textverstehen
- Die Rolle der Linguistischen Hermeneutik für die Analyse des Verstehens von politischen Texten
- Methodische Ansätze für die empirische Untersuchung des Rezipientenverstehens
- Die Relevanz der Rezipientenperspektive in der politischen Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Theoretische Überlegungen Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Rezipientenverstehens. Es werden die Konzepte des pragmatischen Sprachbegriffs und der konstruktivistischen Erkenntnistheorie erläutert, um zu verstehen, wie Sprache Wirklichkeit konstituiert und wie das Verstehen von Texten von Faktoren wie Vorwissen, Interessen und dem Kontext abhängt. Darüber hinaus wird die Bedeutung der linguistischen Hermeneutik als Grundlage für das Verstehen des Verstehens von politischen Texten hervorgehoben.
Kapitel 2: Korpus und Methode In diesem Kapitel werden Überlegungen im Hinblick auf methodische Anforderungen angestellt, um einen Vorschlag für die linguistisch-empirische Untersuchung des Verstehens von politischen Texten des Normalbürgers zu machen. Es werden verschiedene methodische Ansätze und ihre Eignung für die Analyse des Rezipientenverstehens diskutiert.
Kapitel 3: Eine Beispielanalyse: Die Polittalkshow Absolute Mehrheit Dieses Kapitel stellt eine Beispielanalyse vor, die den vorgeschlagenen methodischen Ansatz zur Untersuchung des Rezipientenverstehens in der Praxis erprobt. Die Analyse befasst sich mit der Polittalkshow „Absolute Mehrheit“ und analysiert die Rezeption des Programms durch eine ausgewählte Gruppe von Rezipienten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der politischen Kommunikation, der Linguistischen Hermeneutik, dem Rezipientenverstehen, der pragmatischen Sprachtheorie, dem konstruktivistischen Erkenntnistheorie und der empirischen Forschung in der Politolinguistik. Zentrale Konzepte sind dabei Sprachspiel, Textverstehen, Wirklichkeitskonstituierung und die Bedeutung der Rezipientenperspektive in der politischen Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Linguistische Hermeneutik in der Politik?
Sie untersucht, wie Rezipienten politische Texte verstehen und wie sie über Politik sprechen, um sich dem Prozess des Verstehens wissenschaftlich anzunähern.
Wie konstituiert Sprache Wirklichkeit?
Nach konstruktivistischer Auffassung ist Sprache kein bloßes Abbild, sondern ein Werkzeug, durch das Menschen ihre soziale und politische Wirklichkeit aktiv mitgestalten.
Was ist ein "Sprachspiel" im Kontext von Textverstehen?
Es bezeichnet die Einbettung von Sprache in menschliche Handlungszusammenhänge, wobei das Verstehen stark vom Kontext und Vorwissen abhängt.
Welches Fallbeispiel wird in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit erprobt ihre Methode an einer Beispielanalyse der Polittalkshow "Absolute Mehrheit".
Warum ist die Rezipientenperspektive für die Politolinguistik wichtig?
Weil politische Kommunikation nur dann vollständig verstanden werden kann, wenn man einbezieht, wie die Botschaften beim "Normalbürger" ankommen und verarbeitet werden.
- Quote paper
- Aljona Merk (Author), 2012, Das Verstehen verstehen. Linguistische Hermeneutik politischer Alltagskommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207902