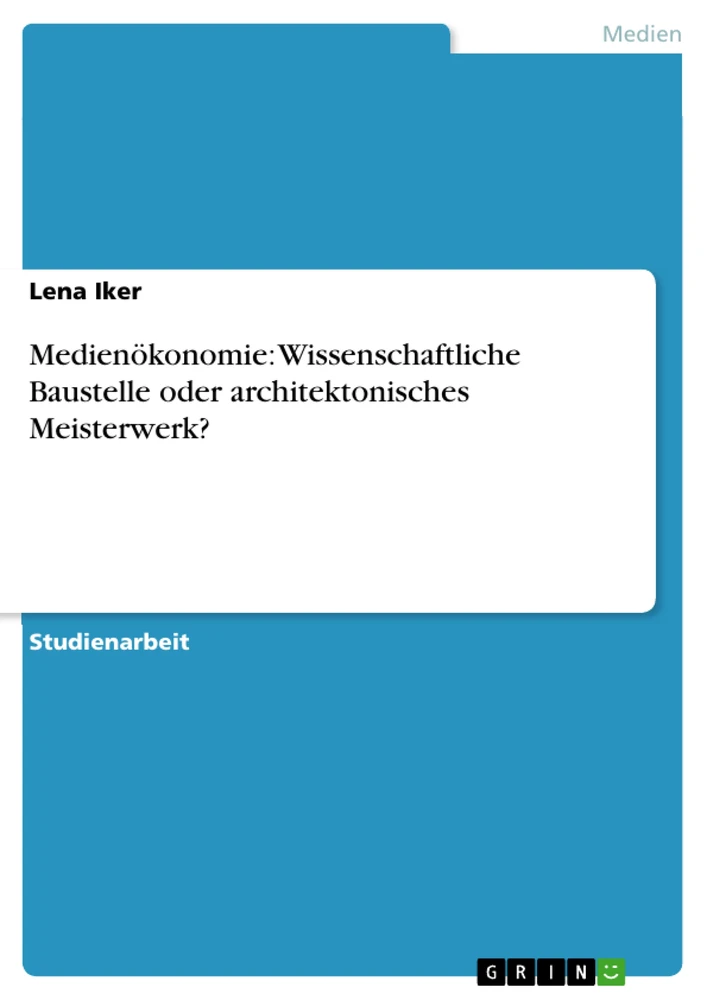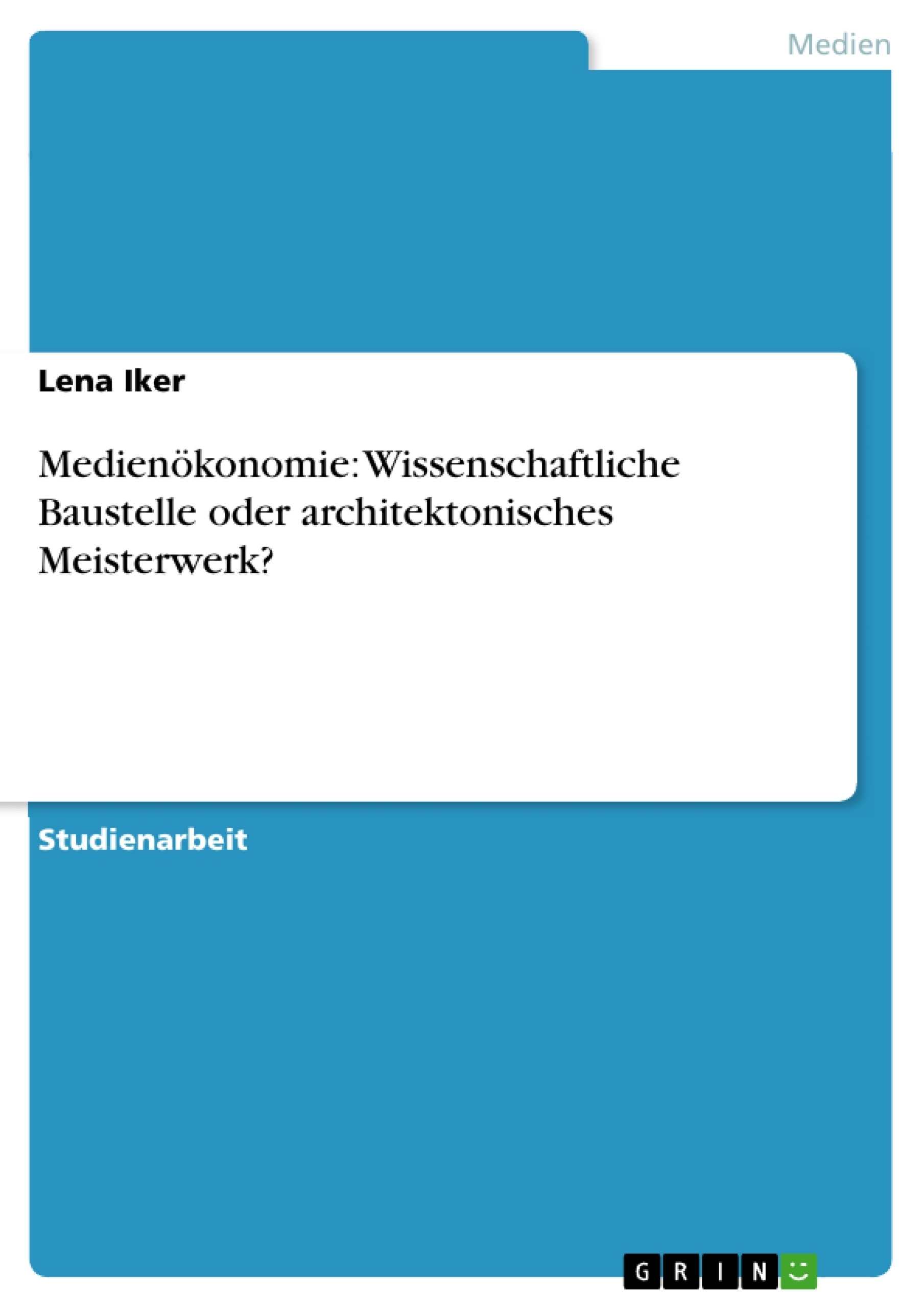10.12.2009. Schweden. Stockholm. Konzerthaus. Vergabe der Nobelpreise. Unter den Preisträgern der Amerikaner Oliver Williamson, Professor an der University of California in Berkeley. Er erhält in diesem Jahr den Wirtschaftsnobelpreis, für die Erarbeitung von Modellen zur Konfliktlösung mit Hilfe von Unternehmensstrukturen, mit der er, laut des Nobelkomitees, das „Verständnis von außermarktlichen Institutionen wesentlich vergrößert“. Williamson geht dabei davon aus, dass in den Wirtschaftswissenschaften nicht nur Märkte und Preise dominieren, sondern eben auch Institutionen und Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind. Vereinfacht man seine These, geht er davon aus, dass Verhandlungen und Verträge bei komplexen Transaktionskosten besser unternehmensintern abgeschlossen werden können, wohingegen Verhandlungen und Verträge mit geringen Transaktionskosten besser über den Markt abgewickelt werden können. Sein Ansatz ist damit Bestandteil der sogenannten amerikanischen Institutionenökonomik und baut auf den Erkenntnissen des Wirtschaftsnobelpreisträgers von 1991, Ronald Harry Coase auf, der geehrt wurde für „seine Entdeckung und Klärung der Bedeutung der sogenannten Transaktionskosten und der Verfügungsrechte für die institutionelle Struktur und das Funktionieren der Wirtschaft“. Die von den beiden Nobelpreisträgern entwickelten Thesen und Ansätze sind Bestandteil der Institutionenökonomik, die wiederum einen Rahmen für die Medienökonomie bilden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Medienökonomie, Medienökonomik oder Ökonomie der Medien?
- 3. Ökonomische Grundgedanken
- 3.1 Begriffe und Definitionen
- 3.2 Basiskonzepte der Ökonomik
- 4. Politische Ökonomie und die Neue Institutionenökonomik als Fundus einer Medienökonomie
- 4.1 Der Transaktionskostenansatz
- 4.2 Der Property-Rights-Ansatz
- 4.3 Der Principal-Agent-Ansatz
- 5. Normative Grundlagen von Ökonomie und Publizistik
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Grundlagen der Medienökonomik und beleuchtet die Frage, ob sie eher als wissenschaftliche Baustelle oder als abgeschlossenes architektonisches Meisterwerk betrachtet werden kann. Die Arbeit definiert den Begriff der Medienökonomik und skizziert deren Entwicklung. Sie beleuchtet außerdem die Einbettung der Medienökonomik in die Neue Institutionenökonomie.
- Definition und Entwicklung der Medienökonomik
- Basiskonzepte der Ökonomik im Kontext der Medien
- Neue Institutionenökonomie und ihre Relevanz für die Medienökonomie
- Normative Grundlagen von Ökonomie und Publizistik
- Der Stellenwert der Medienökonomie innerhalb der Wirtschaftswissenschaften
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Medienökonomie ein und setzt dies in den Kontext der Arbeit von Oliver Williamson und Ronald Coase, zwei Wirtschaftsnobelpreisträgern, deren Theorien zur Institutionenökonomie einen Rahmen für die Medienökonomie bilden. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die zu behandelnden Themen, wobei die Relevanz der einzelnen Punkte herausgestellt wird. Sie positioniert die Arbeit innerhalb des Forschungsfeldes und benennt den Fokus der Untersuchung.
2. Medienökonomie, Medienökonomik oder Ökonomie der Medien?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Medienökonomie und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der interdisziplinären Natur des Forschungsgebietes ergeben. Es verdeutlicht den Doppelcharakter medialer Güter als Wirtschafts- und Kulturgüter und diskutiert die Forschungsgeschichte der Medienökonomie, beginnend mit frühen Arbeiten in den 1950er und 1960er Jahren bis hin zur Entwicklung des Forschungsfeldes in den 1980er Jahren mit der Privatisierung des Rundfunks. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung und dem Zusammenspiel von wirtschafts- und kommunikationswissenschaftlichen Perspektiven.
Schlüsselwörter
Medienökonomie, Medienökonomik, Ökonomie der Medien, Neue Institutionenökonomie, Transaktionskosten, Property Rights, Principal-Agent-Ansatz, Politische Ökonomie, Medienmärkte, Medienunternehmen, Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationswissenschaft, Publizistik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Grundlagen der Medienökonomik"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Grundlagen der Medienökonomik und beleuchtet die Frage, ob sie eher als wissenschaftliche Baustelle oder als abgeschlossenes architektonisches Meisterwerk betrachtet werden kann. Sie definiert den Begriff der Medienökonomik, skizziert deren Entwicklung und beleuchtet die Einbettung in die Neue Institutionenökonomie. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zur Definition von Medienökonomie, ökonomischen Grundgedanken, der Neuen Institutionenökonomie und ihren Ansätzen (Transaktionskosten, Property Rights, Principal-Agent), normative Grundlagen von Ökonomie und Publizistik und ein Fazit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Entwicklung der Medienökonomik; Basiskonzepte der Ökonomik im Kontext der Medien; Neue Institutionenökonomie und ihre Relevanz für die Medienökonomie; Normative Grundlagen von Ökonomie und Publizistik; Der Stellenwert der Medienökonomie innerhalb der Wirtschaftswissenschaften.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel. Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und setzt diese in den Kontext der Theorien von Williamson und Coase. Kapitel 2 befasst sich mit der Definition von Medienökonomie und den Herausforderungen der interdisziplinären Natur des Forschungsgebietes. Es diskutiert die Forschungsgeschichte und das Zusammenspiel von wirtschafts- und kommunikationswissenschaftlichen Perspektiven. Weitere Kapitel befassen sich mit ökonomischen Grundgedanken, der Neuen Institutionenökonomie mit ihren verschiedenen Ansätzen und den normativen Grundlagen von Ökonomie und Publizistik. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Medienökonomie, Medienökonomik, Ökonomie der Medien, Neue Institutionenökonomie, Transaktionskosten, Property Rights, Principal-Agent-Ansatz, Politische Ökonomie, Medienmärkte, Medienunternehmen, Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationswissenschaft, Publizistik.
Wie wird die Medienökonomie in dieser Arbeit definiert und eingeordnet?
Die Arbeit untersucht verschiedene Definitionen von Medienökonomie und diskutiert die Herausforderungen, die sich aus ihrem interdisziplinären Charakter ergeben. Sie ordnet die Medienökonomie in den Kontext der Neuen Institutionenökonomie ein und analysiert deren Relevanz für das Verständnis medialer Märkte und Unternehmen.
Welche Rolle spielt die Neue Institutionenökonomie in der Arbeit?
Die Neue Institutionenökonomie, insbesondere die Ansätze von Transaktionskosten, Property Rights und Principal-Agent, bildet einen zentralen Rahmen für die Analyse der Medienökonomie in dieser Arbeit. Sie hilft, die Strukturen und Prozesse auf Medienmärkten zu verstehen.
Wie werden normative Aspekte berücksichtigt?
Die Arbeit beleuchtet die normative Schnittstelle zwischen ökonomischen Prinzipien und publizistischen Werten. Es wird der Spannungsbogen zwischen ökonomischen Zielen und den normativen Anforderungen an Medien untersucht.
- Quote paper
- Lena Iker (Author), 2010, Medienökonomie: Wissenschaftliche Baustelle oder architektonisches Meisterwerk?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208103