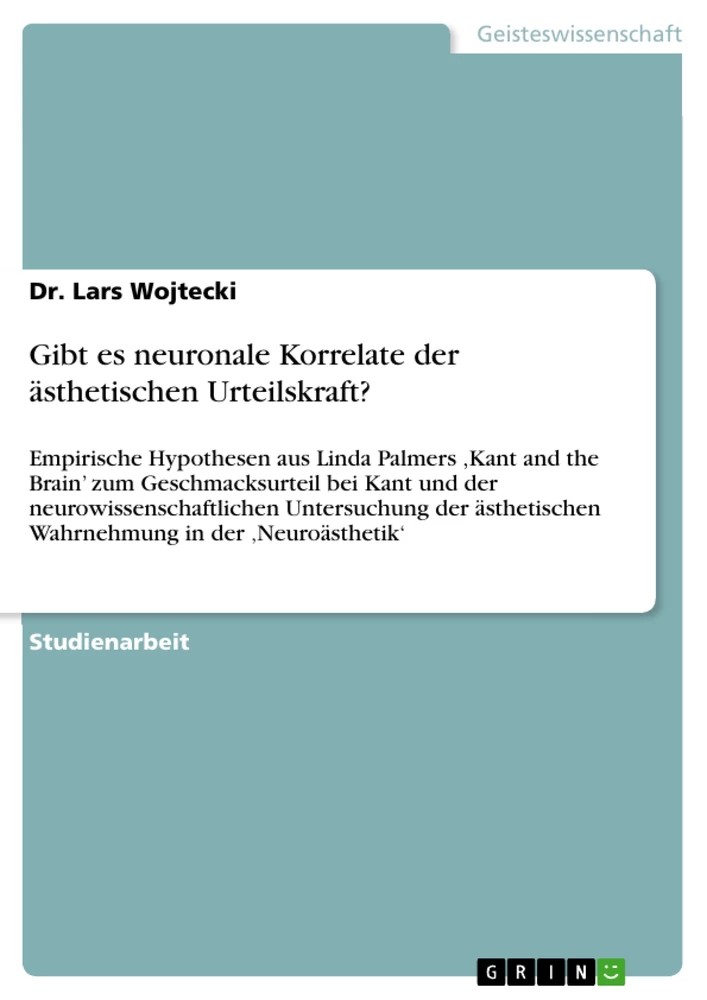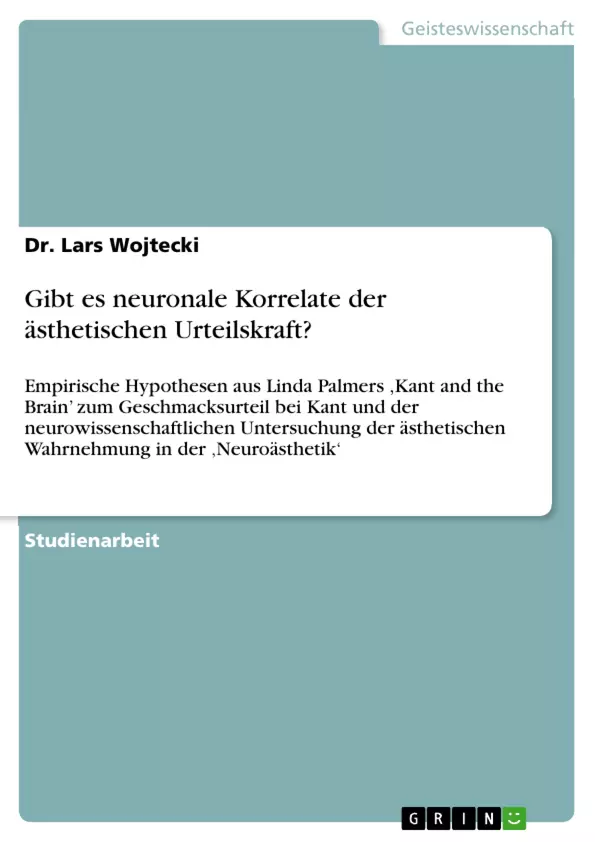Linder Palmers Text ,Kant and the Brain – A new empirical hypothesis’ nimmt unter anderem die Theorie eines menschlichen Urteils der Wahrnehmung des Schönen und Erhabenen von Immanuel Kant auf. Der Kant´sche Ansatz stellt im Rahmen der ,Philosophie der Kunst’ eine zunächst Subjekt- und nicht Werk-bezogene Fragestellung nach den formalen Möglichkeiten der Wahrnehmung des Schönen überhaupt dar. Der empirische Ansatz Palmers sucht nach neurobiologischen Korrelaten des Kant´schen ,Geschmacksurteils’ und kann im Rahmen der Disziplin der ,Neuroästhetik’ gesehen werden. Palmer schlägt als neurobiologisches Korrelat des ästhetischen Urteilsvermögens die anatomische Struktur der basolateralen Amygdala vor. Es wird der bei Kant zentrale Aspekt des freien, nicht kognitiv-erkennenden kontemplativen Akts des vorsprachlichen Erfassens des Geschmacksurteils neuroanatomisch aufgriffen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Disziplin der ,Neuroästhetik’
3 Überblick über die Empirische Hypothesen aus Linda Palmers ,Kant and the Brain´
3.1 Palmers Zusammenfassung der Kritiken Kants
3.2 Palmers Empirische Hypothesen
4 Kritische Erörterung der Hypothesen Palmers
4.1 Auseinandersetzung mit Kant
4.2 Auseinandersetzung mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen
4.3 Auseinandersetzung mit dem neuro-philosophischen Kontext
5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
6 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Gibt es neuronale Korrelate für ästhetische Urteile?
Die Arbeit untersucht die Hypothese von Linda Palmer, die die basolaterale Amygdala als neurobiologisches Korrelat für das Kant’sche Geschmacksurteil vorschlägt.
Was ist die Disziplin der Neuroästhetik?
Die Neuroästhetik ist ein Forschungsfeld, das nach biologischen und neurologischen Grundlagen für ästhetische Wahrnehmungen und Urteile sucht.
Welchen Bezug hat Immanuel Kant zu dieser Forschung?
Kants Theorie über das Schöne und Erhabene sowie der freie, kontemplative Akt des Geschmacksurteils bilden die philosophische Grundlage, für die Palmer empirische Belege sucht.
Was ist das Besondere am Kant’schen Geschmacksurteil?
Es handelt sich um einen vorsprachlichen, nicht kognitiv-erkennenden Akt, der subjektiv ist und nicht primär auf den Eigenschaften des Kunstwerks basiert.
Welche Struktur im Gehirn steht im Fokus der Untersuchung?
Im Zentrum steht die basolaterale Amygdala als potenzielle anatomische Entsprechung für das ästhetische Urteilsvermögen.
- Citation du texte
- Dr. Lars Wojtecki (Auteur), 2012, Gibt es neuronale Korrelate der ästhetischen Urteilskraft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208702