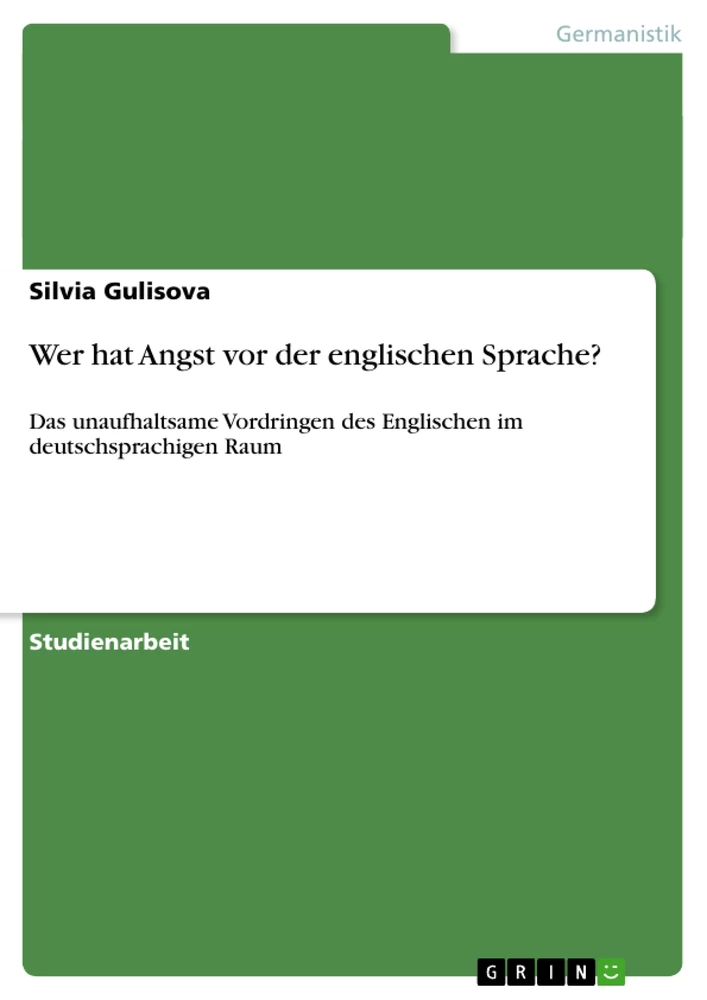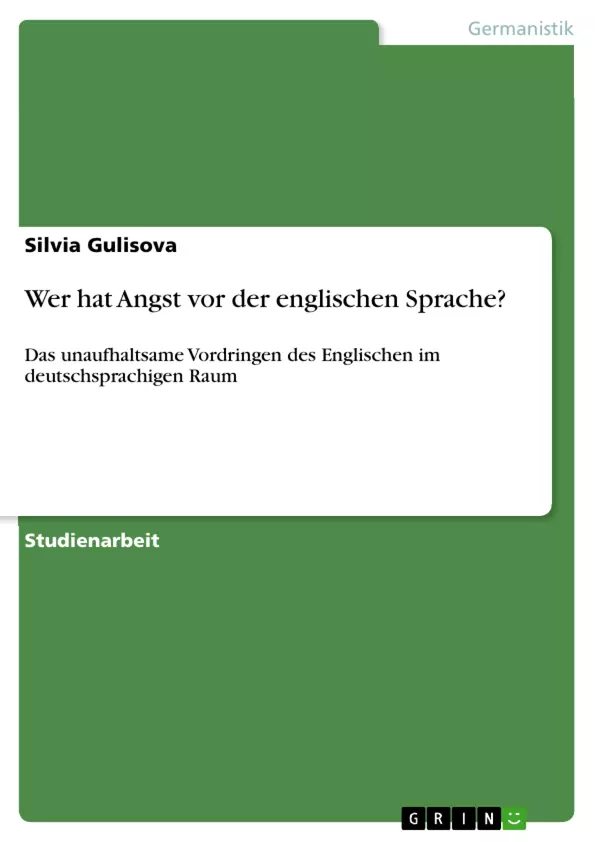Wenn man sich heutzutage nur so bloß herumschaut, könnte sich diesmal nicht die Feststellung über die Amerikanisierung der Gesellschaft verzeihen. Die Welt wird immer mehr „mcdonaldisiert und kokakolisiert“. Es sind Versuche, die amerikanischen Traditionen und Sitten zu kopieren und in den anderen Landkulturen zu übernehmen. Amerikanisierung vollzieht sich nach Auffassung von Philipp Gassert unabhängig von den Epochen der politischen und politisch-ideologischen Entwicklungen in den Staatenbeziehungen. Sie ist eng an den faktisch gegebenen Status der USA als Weltmacht und an die damit zusammenhängende Dynamik der Gesellschaft gebunden. Eine solche Nachbildung ist auch im Bereich der Sprache wahrzunehmen. Überall wo man hingeht, stoß man an Englisch. Im Geschäft, im Beruf, im Internet oder gleich bei der zwischenmenschlichen Kommunikation. Die deutsche Sprache, ganz genau wie alle anderen lebenden Sprachen, ist einem ständigen Wandel unterzogen. Wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Kontakten zwischen den Menschen, Völkern und verschiedenen Gruppen von Nationen führen zu einer Berührung einer Sprache zu der anderen. Das nennen wir Sprachkontakt. Der Kontakt von unterschiedlichen Sprachen und Sprachgemeinschaften ermöglicht den Einfluss einer Sprache auf die andere. Veränderungen in der deutschen Sprache (z. B.: der Gebrauch der Fremdwörter) waren in der Vergangenheit (das dauert auch bis heute) ein Anlass heftiger Auseinandersetzungen. So ist es in heutiger Zeit der Gebrauch von Anglizismen in der deutschen Sprache immer noch ein zentrales Thema. Wir stählen unseren Körper mit „body shaping“, streichen ihn mit „Shea butter“. Wir schicken ein SMS, schreiben ein E-mail. Die Jungen möchten „cool“ und „in“ sein. Wir kleiden uns in „outdoor jackets, tops“ oder“ beach wear“. Wir schmieren uns „anti-ageing-Creme“ ins Gesicht oder sprühen „styling“ ins Haar. Bei der Bahn kaufen wir „tickets“ und in Fast Food essen wir Hamburgers oder Hot- dogs usw. Das ist nur eine kleine Auswahl aus der Menge von Anglizismen die deutsche Sprache überflutet haben und heutzutage schon automatisch ohne nachzudenken, als ein gleichwertiger Bestandteil der menschlichen Kommunikation verwendet werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was sind Anglizismen?
- 2.1 Unterschied zwischen Anglizismus und denglischer Sprache
- 3 Einwanderung der Anglizismen in der deutschen Sprache
- 3.1 Anglizismen in einzelnen Bereichen des Lebens
- 3.2 Deutsch vs. Englisch Unterschiede
- 4 Pseudoanglizismen und „false friends“
- 5 Englisch als „lingua franca“ und Europäische Union
- 6 Probleme die Englisch bereiten kann
- 7 Wer hat Angst von der Englischen?
- 7.1 Was wird gegen Amerikanisierung der Wortschatz unternommen?
- 8 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Vordringen des Englischen in den deutschsprachigen Raum und die damit verbundenen Auswirkungen auf die deutsche Sprache. Sie beleuchtet die verschiedenen Arten von Anglizismen, ihre Einwanderung in die deutsche Sprache und die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen. Darüber hinaus werden die kritischen Aspekte der Anglizismen und die Diskussionen um "Denglisch" behandelt.
- Die Definition und Klassifizierung von Anglizismen
- Der Einfluss des Englischen auf verschiedene Bereiche des deutschen Lebens
- Die historische Entwicklung der Anglizismen im Deutschen
- Der Unterschied zwischen Anglizismen und Denglisch
- Die gesellschaftliche und sprachliche Debatte um den Einfluss des Englischen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zunehmende Amerikanisierung der Gesellschaft und ihren Einfluss auf die Sprache fest. Sie hebt die ständige Veränderung der deutschen Sprache durch Sprachkontakt hervor und benennt den Gebrauch von Anglizismen als zentrales Thema. Die allgegenwärtige Präsenz von Anglizismen in verschiedenen Lebensbereichen wird mit Beispielen illustriert, und der Begriff "Denglisch" als kritische Bezeichnung für den starken englischen Einfluss auf die deutsche Sprache wird eingeführt. Der Zusammenhang zwischen der globalen Ausbreitung des amerikanischen Lebensstils und der Anglisierung der deutschen Sprache wird hervorgehoben, sowie die aktuelle gesellschaftliche Situation, die zur Übernahme englischer Begriffe führt, besonders in den Medien.
2. Was sind eigentlich Anglizismen?: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Definitionen des Begriffs "Anglizismus". Es werden Definitionen aus der Literatur vorgestellt, die den Anglizismus als Übertragung englischer sprachlicher Erscheinungen auf nicht-englische Sprachen beschreiben. Es wird erklärt, dass Anglizismen Entlehnungen aus verschiedenen englischen Varietäten sind, und der Unterschied zwischen Anglizismen und Amerikanismen wird diskutiert. Die Verbindung zwischen der Entlehnung von Wörtern und gesellschaftlichen Veränderungen wird angesprochen. Schließlich werden die verschiedenen Kategorien von Anglizismen nach Wenliang Yang vorgestellt, unterteilt in konventionalisierte Anglizismen, Anglizismen im Konventionalisierungsprozess und Eigennamen, Titel und Slogans.
2.1 Unterschied zwischen Anglizismus und denglischer Sprache: Dieses Kapitel verdeutlicht den Unterschied zwischen den Begriffen "Anglizismus" und "Denglisch". Anglizismen werden als wertneutrale Entlehnungen von Wörtern, Phrasen oder Formen aus dem Englischen definiert. Im Gegensatz dazu wird "Denglisch" als wertender Begriff der Sprachkritik beschrieben, der die Übernahme von englischen Verben und Adjektiven neben Substantiven umfasst. Die Unterscheidung liegt darin, dass Anglizismen durch objektiv feststellbare Kriterien definiert werden können, während "Denglisch" eine subjektive Einschätzung darstellt. Es wird ein Beispiel für Denglisch gegeben.
3. Einwanderung der Anglizismen in der deutschen Sprache: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Anglizismen im Deutschen. Es wird der Einfluss der englischen Revolution von 1649 und die zunehmende Bedeutung Englands als Handels- und Industrienation auf die sprachliche Entwicklung hervorgehoben. Es wird erklärt, dass die deutsch-englischen Sprachkontakte seit den 1680er Jahren zunahmen und mit Übersetzungen aus dem Englischen sowie dem Aufkommen des Englischunterrichts an Universitäten einhergingen. Der Kapitel beschreibt, wie die Übernahme englischen Vokabulars mit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland verbunden ist. Die anfänglich begrenzten Englischkenntnisse in Deutschland bis Mitte des 18. Jahrhunderts werden ebenfalls erwähnt. Die Bedeutung der englischen Sprache für den wirtschaftlichen und technologischen Austausch wird angesprochen.
Schlüsselwörter
Anglizismen, Denglisch, Amerikanisierung, Sprachwandel, Sprachkontakt, deutsche Sprache, Englische Sprache, Sprachkritik, Wortentlehnung, Lexik, Gesellschaftlicher Wandel, Sprachgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einwanderung von Anglizismen in die deutsche Sprache
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Vordringen des Englischen in den deutschsprachigen Raum und die damit verbundenen Auswirkungen auf die deutsche Sprache. Sie beleuchtet verschiedene Arten von Anglizismen, deren Einwanderung und die gesellschaftlichen Veränderungen. Kritische Aspekte der Anglizismen und die Diskussionen um "Denglisch" werden ebenfalls behandelt.
Was sind Anglizismen und wie unterscheiden sie sich von Denglisch?
Anglizismen sind wertneutrale Entlehnungen von Wörtern, Phrasen oder Formen aus dem Englischen. Denglisch hingegen ist ein wertender Begriff der Sprachkritik, der die Übernahme englischer Verben und Adjektive neben Substantiven umfasst. Anglizismen lassen sich objektiv definieren, während Denglisch eine subjektive Einschätzung darstellt.
Welche Arten von Anglizismen werden in der Arbeit unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Kategorien von Anglizismen nach Wenliang Yang: konventionalisierte Anglizismen, Anglizismen im Konventionalisierungsprozess und Eigennamen, Titel und Slogans.
Wie wird die historische Entwicklung der Anglizismen im Deutschen dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss der englischen Revolution von 1649 und die zunehmende Bedeutung Englands als Handels- und Industrienation auf die sprachliche Entwicklung. Der zunehmende deutsch-englische Sprachkontakt seit den 1680er Jahren, Übersetzungen aus dem Englischen und der Englischunterricht an Universitäten werden als Faktoren genannt. Die Verbindung zwischen der Übernahme englischen Vokabulars und der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Deutschlands wird hervorgehoben.
Welche Bereiche des Lebens werden durch Anglizismen beeinflusst?
Die Arbeit zeigt den Einfluss von Anglizismen auf verschiedene Bereiche des deutschen Lebens auf, jedoch werden konkrete Beispiele nicht im FAQ aufgeführt, sondern im Text selbst beschrieben.
Welche gesellschaftlichen und sprachlichen Debatten werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit behandelt die gesellschaftliche und sprachliche Debatte um den Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache, insbesondere die Diskussion um die "Amerikanisierung" und die kritische Auseinandersetzung mit "Denglisch".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen im Wesentlichen?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Kapitel zu Definition und Klassifizierung von Anglizismen (inkl. Unterschied zu Denglisch), Einwanderung der Anglizismen in die deutsche Sprache, Pseudoanglizismen und "false friends", Englisch als "lingua franca" und Europäische Union, Probleme, die Englisch bereiten kann, Angst vor der Englischen Sprache und Gegenmaßnahmen zur Amerikanisierung des Wortschatzes sowie eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Anglizismen, Denglisch, Amerikanisierung, Sprachwandel, Sprachkontakt, deutsche Sprache, Englische Sprache, Sprachkritik, Wortentlehnung, Lexik, Gesellschaftlicher Wandel, Sprachgeschichte.
- Quote paper
- Silvia Gulisova (Author), 2013, Wer hat Angst vor der englischen Sprache?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208925