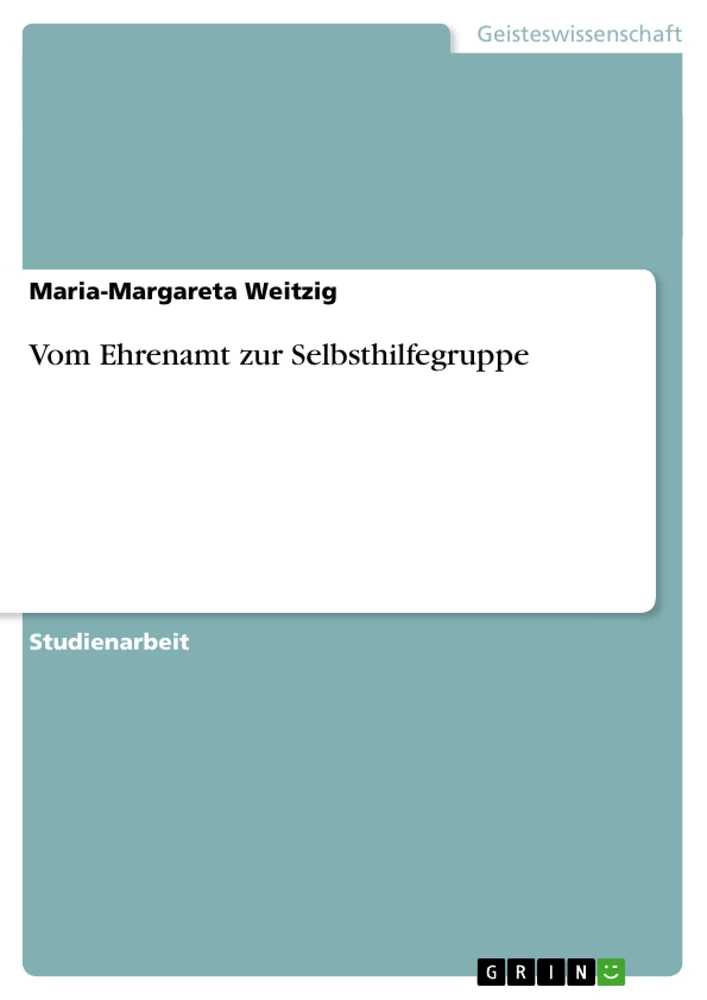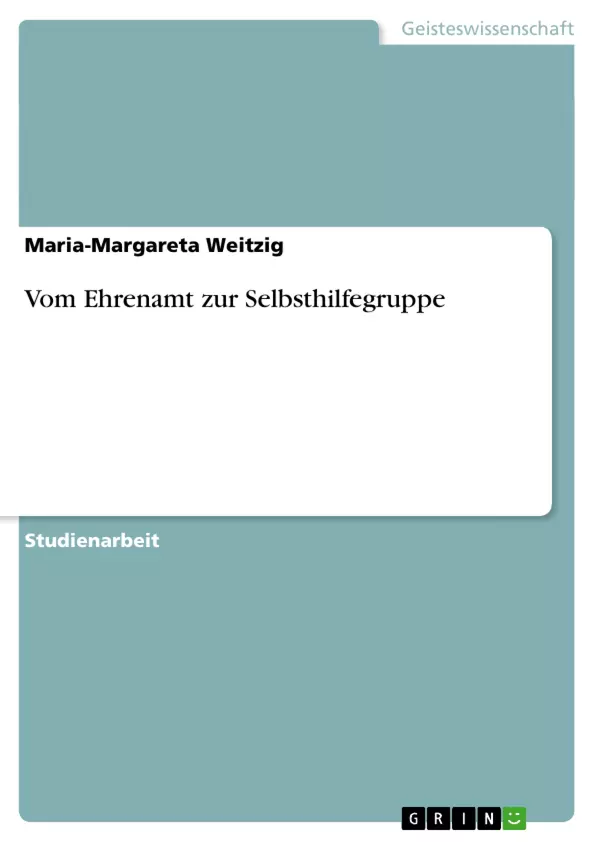Das Vorhandensein einer grundsätzlichen Bereitschaft zum sozialen Engagement wird überwiegend an der Resonanz auf die traditionellen Angebote gemessen, wie zum Beispiel dem freiwilligen sozialen Engagement. Kommt durch die Individualisierung der Bürger die nachlassende Bereitschaft dazu ersatzlos zum Erliegen?
Neben den hier nicht berücksichtigten Formen der herkömmlichen individuellen und familialen Selbsthilfe haben sich neue Muster wechselseitiger Hilfe herausgebildet, wie sie sich u. a. in sozialen Selbsthilfegruppen finden. Traditionelle Werte von sozialem Engagement sind auf Anhieb in einer Selbsthilfegruppe nur schwer erkennbar. Aufopferung, zeitliche Unbegrenztheit, Zurückstellen der eigenen Person und Interessen bis hin zum Altruismus, wie sie sich in der ehrenamtlichen sozialen Tätigkeit zeigen haben hier keine Anwendung.
Der Rückgang traditioneller Normen als Triebfeder sozialen Engagements, der in den ersten beiden Teilen der vorliegenden Broschüre nachgezeichnet werden soll, muss allerdings nicht bedeuten, dass das Engagement in einer Selbsthilfegruppe nichts mehr mit freiwilligem sozialem Ehrenamt zu tun hat. Es soll vielmehr nachgewiesen werden, dass durch die Selbsthilfegruppe neue Formen freiwilligen sozialen Engagements entstanden sind, die sich vom traditionellen Ehrenamt in Motivation und Strukturen grundlegend unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Merkmale und historische Entwicklung des sozialen Ehrenamtes
- Rückgang traditioneller sozialer Hilfeleistung und ehrenamtlicher Tätigkeit
- Zunehmender Bedarf an Lebenshilfen
- "Neues" soziales Engagement
- Soziale Selbsthilfegruppen
- Bestimmungselemente
- Arbeitsweise
- Motivation am Beispiel der Gruppenselbstbehandlung
- Vom freiwilligen Ehrenamt zum solidarischen Handeln. Neue Begriffe für neue Formen freiwilligen sozialen Engagements
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Wandel vom traditionellen sozialen Ehrenamt hin zu neuen Formen des Engagements, insbesondere in Selbsthilfegruppen. Sie stellt die Frage, ob der Rückgang des traditionellen Ehrenamtes zu einem vollständigen Verlust der Bereitschaft zu sozialem Engagement führt. Darüber hinaus werden die Veränderungen in der Gesellschaft, wie Individualisierung, Pluralisierung und der Rückgang traditioneller sozialer Netzwerke, als wesentliche Einflussfaktoren auf das Engagement in Selbsthilfegruppen untersucht.
- Entwicklung des sozialen Ehrenamtes
- Rückgang des traditionellen Ehrenamtes
- Zunehmender Bedarf an Lebenshilfe
- Soziale Selbsthilfegruppen als neue Form des Engagements
- Motivation und Strukturen von Selbsthilfegruppen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen dem Rückgang des traditionellen sozialen Ehrenamtes und dem Aufkommen von Selbsthilfegruppen dar. Sie argumentiert, dass trotz des Rückgangs traditioneller Normen neue Formen freiwilligen sozialen Engagements entstanden sind.
- Merkmale und historische Entwicklung des sozialen Ehrenamtes: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Ehrenamtes, beginnend mit dem "Elberfelder Modell" und der Entstehung der freien Wohlfahrtspflege. Es werden die traditionellen Motive für ehrenamtliches Engagement und dessen strukturelle Einbindung in Organisationen dargelegt.
- Rückgang traditioneller sozialer Hilfeleistung und ehrenamtlicher Tätigkeit: Das Kapitel untersucht den Rückgang des traditionellen Ehrenamtes, der aus Sicht der Wohlfahrtsverbände in den letzten Jahrzehnten zu beobachten ist. Es werden verschiedene Ursachen für diesen Rückgang diskutiert, darunter die Individualisierung der Gesellschaft, der Wandel in den Familienstrukturen und die zunehmende Bereitschaft des Staates, für die soziale Versorgung zu sorgen.
- Zunehmender Bedarf an Lebenshilfen: Dieses Kapitel beschreibt die zunehmenden Herausforderungen im Bereich der sozialen und gesundheitlichen Problemlagen, die durch den demografischen Wandel, chronische Krankheiten und den Wandel sozialer Netzwerke entstehen. Es wird gezeigt, dass der Bedarf an Unterstützung in diesen Bereichen wächst, während gleichzeitig die traditionellen Formen der Hilfe nachlassen.
- "Neues" soziales Engagement: Dieses Kapitel stellt die Entstehung von neuen Formen des sozialen Engagements vor, die sich von der traditionellen Form des Ehrenamtes unterscheiden.
- Soziale Selbsthilfegruppen: Dieses Kapitel beleuchtet die Besonderheiten von sozialen Selbsthilfegruppen. Es werden die Bestimmungselemente, die Arbeitsweise und die Motivation der Mitglieder anhand des Beispiels der Gruppenselbstbehandlung beschrieben.
Schlüsselwörter
Soziales Ehrenamt, Selbsthilfegruppe, Individualisierung, Pluralisierung, demografischer Wandel, Lebenshilfe, Gruppenselbstbehandlung, Tradition, Wandel, Motivation, Strukturen, freiwilliges Engagement.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich das traditionelle Ehrenamt von der Selbsthilfe?
Das traditionelle Ehrenamt basiert oft auf Altruismus und Aufopferung in festen Organisationen, während die Selbsthilfe stärker auf solidarischem Handeln und der Bewältigung eigener Betroffenheit beruht.
Warum geht die Bereitschaft zum klassischen sozialen Engagement zurück?
Ursachen sind die zunehmende Individualisierung, der Wandel von Familienstrukturen und die Erwartungshaltung, dass der Staat für die soziale Versorgung zuständig ist.
Was sind die Merkmale einer sozialen Selbsthilfegruppe?
Selbsthilfegruppen zeichnen sich durch wechselseitige Hilfe, eine informelle Arbeitsweise und die Motivation zur gemeinschaftlichen Problembewältigung (Gruppenselbstbehandlung) aus.
Was war das „Elberfelder Modell“?
Es handelt sich um ein historisches Modell der Armenpflege, das die Grundlage für die spätere Entwicklung der freien Wohlfahrtspflege und des organisierten Ehrenamtes legte.
Führt der Rückgang des Ehrenamtes zum Ende des sozialen Engagements?
Nein, der Text argumentiert, dass lediglich die Formen des Engagements sich wandeln und neue Muster wie die solidarische Selbsthilfe entstehen.
- Citar trabajo
- Maria-Margareta Weitzig (Autor), 1997, Vom Ehrenamt zur Selbsthilfegruppe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20899