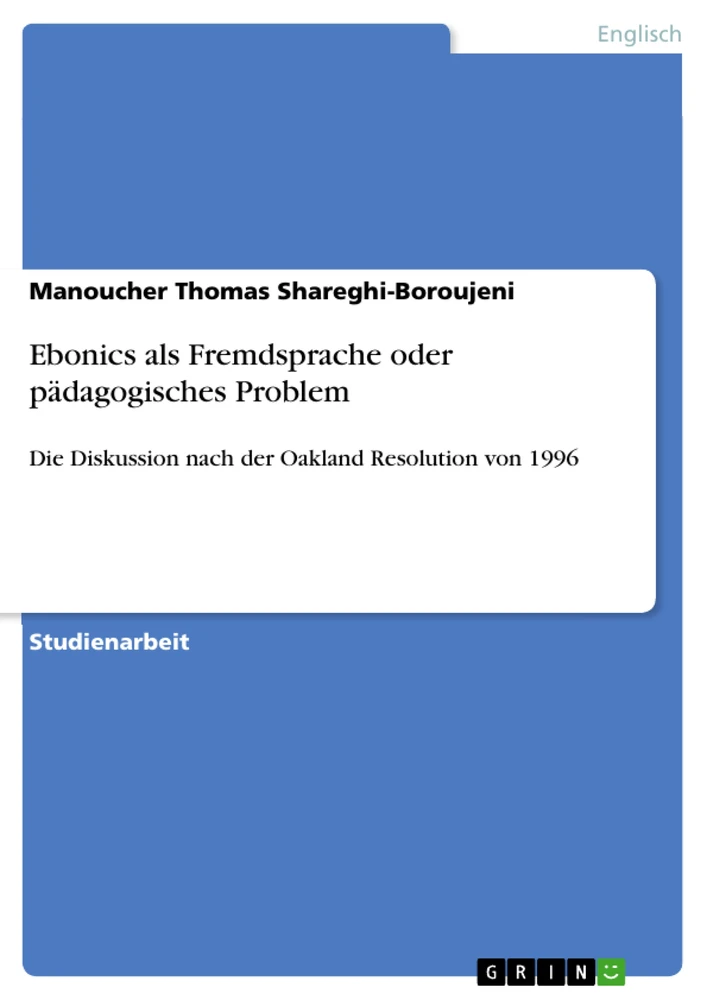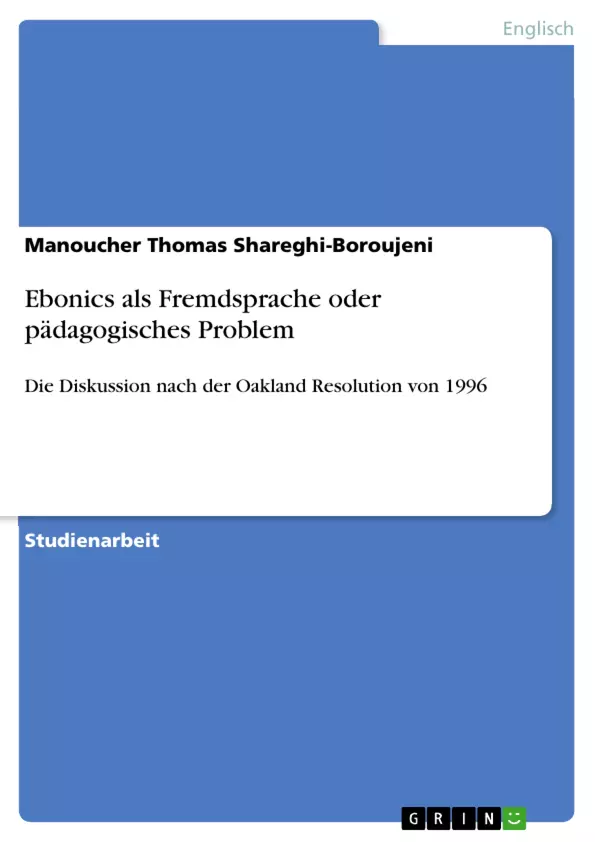Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit ausgewählten Reaktionen von Linguisten und Pädagogen, die auf die Oakland Ebonics Resolution von 1996 folgten. Sie möchte Ansätze zu Ebonics vorstellen und klären, ob es sich bei den in der Resolution thematisierten Phänomenen im Bezug auf Ebonics um Probleme mit primär linguistischen oder pädagogischen Problemstellungen handelt, wenn es um schlechte Schulleistungen afro-amerikanischer Schüler geht. Die Entstehungsgeschichte von Ebonics als sprachliches System will die Hausarbeit nicht thematisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Ebonics
- Das SEP
- Die Oakland Ebonics Resolution
- Die überarbeitete Fassung vom 12. Januar 1997
- Stellungnahmen zum praktischen Einsatz von AAVE in amerikanischen Schulen
- Hafeezah Adama Davia Dalji
- Carrie Secret
- Arthur Palacas
- William J. Drummond
- John Russel Rickford
- John McWhorter
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Reaktionen von Linguisten und Pädagogen auf die Oakland Ebonics Resolution von 1996. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze zum Thema Ebonics und erörtert, ob die in der Resolution angesprochenen Phänomene im Zusammenhang mit Ebonics eher linguistische oder pädagogische Probleme darstellen, wenn es um schlechte Schulleistungen afro-amerikanischer Schüler geht.
- Definition und Entstehung von Ebonics
- Der Standard English Proficiency Program (SEP)
- Die Oakland Ebonics Resolution und ihre Auswirkungen
- Die Rolle der Linguistik in der Ebonics-Debatte
- Pädagogische Ansätze und ihre Implikationen für afro-amerikanische Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Ebonics und die Oakland Resolution ein und stellt die zentralen Begriffe Ebonics, SEP und die Resolution selbst vor. Sie erläutert die methodische Vorgehensweise der Hausarbeit und betont die Fokussierung auf linguistische und pädagogische Ansätze. Das Kapitel "Der Begriff Ebonics" beleuchtet die verschiedenen Bezeichnungen für Ebonics und die Debatte um dessen sprachliche Eigenständigkeit. Es werden verschiedene Theorien über die Entstehung von Ebonics präsentiert, darunter die afrozentrische Sichtweise und die These von William Labov, der AAVE als eigenständiges sprachliches System definiert. Das Kapitel "Das SEP" beschreibt die Bedeutung von Standard English und die Rolle des SEP in der afro-amerikanischen Bildung. Im Fokus steht die Frage, ob und inwieweit AAVE als Hindernis für den Erwerb von Standard English gesehen werden kann. Das Kapitel "Die Oakland Ebonics Resolution" befasst sich mit dem Inhalt der Resolution und der Debatte um deren Bedeutung und Folgen.
Das Kapitel "Stellungnahmen zum praktischen Einsatz von AAVE in amerikanischen Schulen" stellt die verschiedenen Perspektiven von Linguisten und Pädagogen zu Ebonics vor, darunter die Ansätze von Hafeezah Adama Davia Dalji, Carrie Secret, Arthur Palacas, William J. Drummond, John Russel Rickford und John McWhorter. Jeder Abschnitt beleuchtet die jeweiligen Positionen und Argumente dieser Experten.
Schlüsselwörter
Ebonics, African American Vernacular English (AAVE), Standard American English (SAE), Oakland Ebonics Resolution, Standard English Proficiency Program (SEP), Linguistik, Pädagogik, afro-amerikanische Bildung, sprachliche Kompetenz, sprachliche Diversität.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass für die Debatte um Ebonics im Jahr 1996?
Der Anlass war die "Oakland Ebonics Resolution" von 1996, die Reaktionen von Linguisten und Pädagogen weltweit auslöste.
Was ist Ebonics (AAVE)?
Ebonics, auch bekannt als African American Vernacular English (AAVE), wird in der Linguistik oft als eigenständiges sprachliches System mit spezifischen Regeln betrachtet.
Handelt es sich bei Ebonics um ein linguistisches oder pädagogisches Problem?
Die Hausarbeit untersucht genau diese Frage: Ob die schlechten Schulleistungen afro-amerikanischer Schüler primär auf linguistische Barrieren oder pädagogische Defizite zurückzuführen sind.
Was ist das Standard English Proficiency Program (SEP)?
Das SEP ist ein Programm, das darauf abzielt, die Kompetenz in Standard-Englisch bei Schülern zu fördern, für die AAVE die Primärsprache ist.
Welche Expertenmeinungen werden in der Arbeit vorgestellt?
Es werden Positionen von Experten wie John Rickford, John McWhorter, Carrie Secret und William Labov beleuchtet.
Wird die Entstehungsgeschichte von Ebonics in der Arbeit behandelt?
Nein, die Hausarbeit fokussiert sich auf die Reaktionen auf die Resolution und pädagogische Implikationen, nicht auf die historische Entstehung des Sprachsystems.
- Citar trabajo
- M. A. Manoucher Thomas Shareghi-Boroujeni (Autor), 2002, Ebonics als Fremdsprache oder pädagogisches Problem, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209547