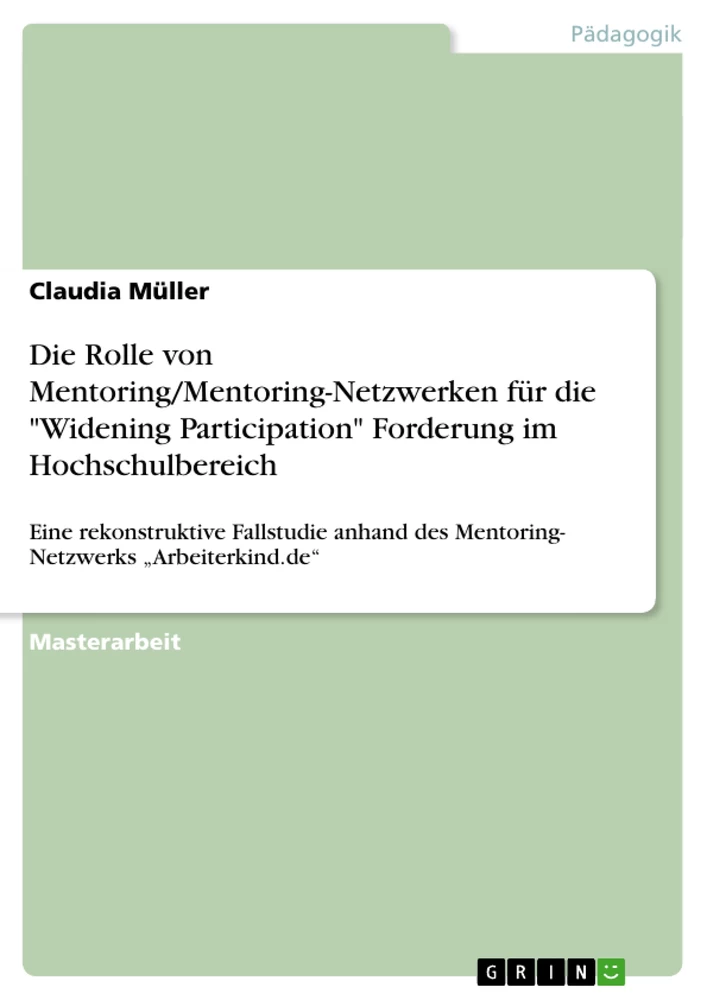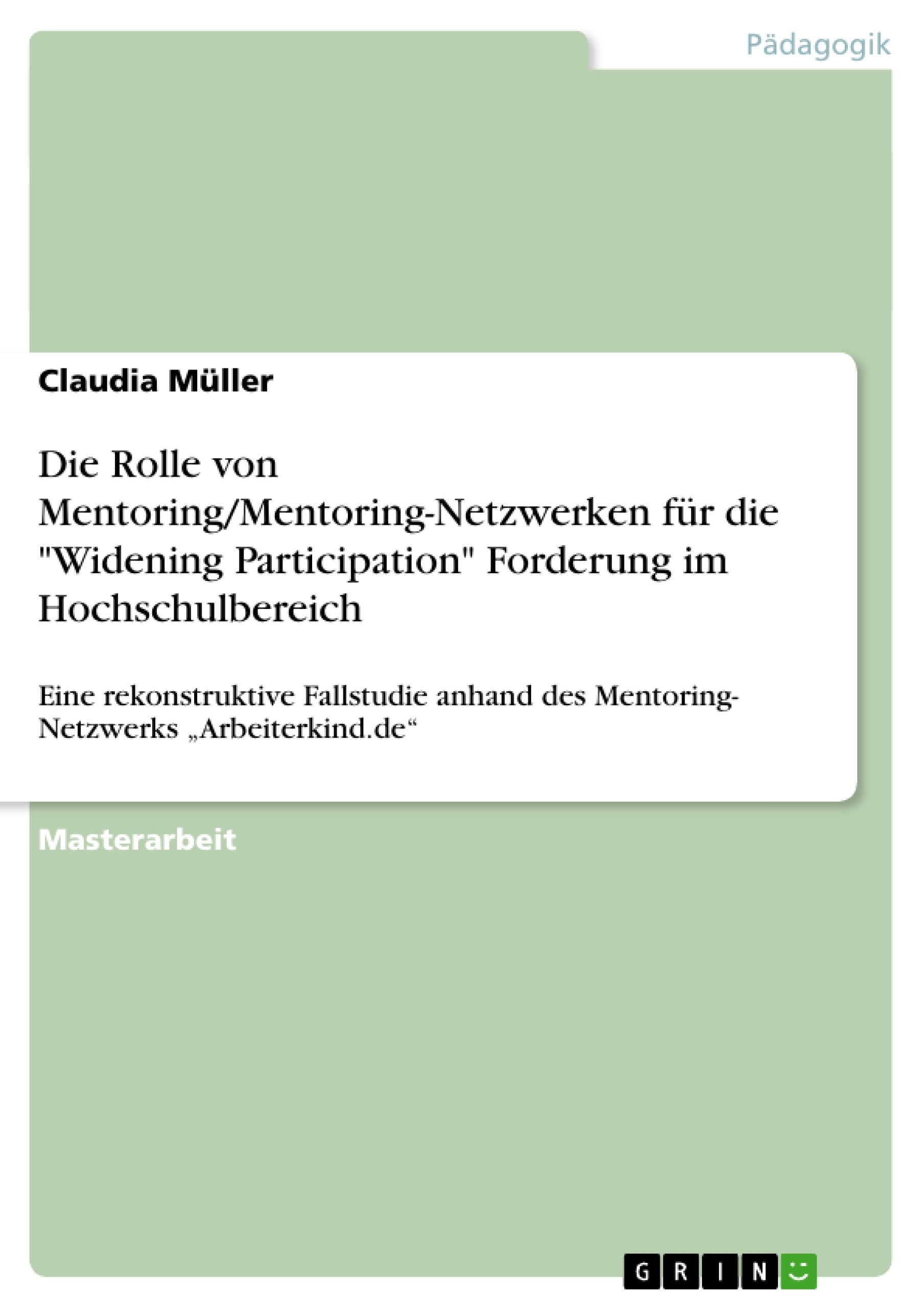Arbeiterkind.de ist eine Initiative, die Kinder und Studierende aus bildungsfernen Schichten auf ihrem Bildungsweg unterstützt.
Diese Arbeit untersucht Struktur, Funktionsweise, Mentoring-Konzept und Motive für das Engagement bei Arbeiterkind.de anhand der Methode der Einzelfallstudie. Aus den Ergebnissen wurden 21 Strukturmerkmale abgeleitet, diese waren Grundlage für die Entwicklung eines Modells.
Das Modell zeigt Arbeiterkind.de als eine Community mit zentraler Steuerung und teilstrukturiertem Angebot. Charakteristisch dafür sind die mitgliedergetriebene Aktivitäten, eine hohe Durchlässigkeit und die nur schwach ausgeprägte zentrale Steuerung. Von einer traditionellen Mentoring-Initiative unterscheidet sich Arbeiterkind.de vor allem durch das Fehlen eines strukturiertes Mentoring-Programms.
Weitere Strukturmerkmale sind die offene Gemeinschaft, dezentrale Organisation in Ortsgruppen, web-2.0-basierte Kommunikation und eine moderate zentrale Steuerung. Der Mentoren-Begriff ist sehr weit gefasst: Abeiterkind.de versteht darunter jede Art von Engagement in der Initiative. Neben 1:1-Mentoring-Beziehungen sind informelle Beratungs-Situationen die Regel. Die Angebote im Netzwerk richten sich jeweils an Mentees und Mentoren. Motive für das Engagement sind sinnstiftende Aktivität und ein Zugehörigkeitsgefühl. Letzteres führt bei einigen Mitgliedern zu einem selbstbewussteren Umgang mit der eigenen Herkunft.
Das Modell der Community ist geeignet, um junge Menschen über Bildungsmöglichkeiten zu informieren und sie zu unterstützen. Onlinebasierte Kommunikation, selbstbestimmtes Engagement und punktuell abrufbare Angebote greifen die Handlungs- und Kommunikationsformen der Zielgruppe auf. Arbeiterkind.de nutzt damit zukunftsweisende Methoden der Zusammenarbeit.
Die wachsende Mitgliederzahl sowie die Motive der Mentoren spiegeln nicht nur die empirisch belegte Ungerechtigkeit im Bildungssystem wider. Auch zeigt der große Zulauf, dass es bisher wenige vergleichbare Initiativen gibt. Die Geschichte von Arbeiterkind.de zeigt damit ein typisches Muster gesellschaftspolitischen Wandels: nämlich, dass häufig gemeinnützige Akteure Wegbereiter für eine breite öffentliche Diskussion sind.
Hochschulen stehen vor der Herausforderung, eine höhere Beteiligung an tertiärer Bildung zu leisten, um den wachsenden Markt für Akademiker zu bedienen. Bei der Entwicklung entsprechender Angebote kann eine Zusammenarbeit mit der Initiative Arbeiterkind.de sinnvoll sein.
Inhalt
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
Zusammenfassung
1 Einleitung
2 Stand der Forschung und Ziel dieser Arbeit
2.1 Einordung des Themas
2.2 Stand der Forschung über das Netzwerk Arbeiterkind.de
2.3 Erkenntnisinteresse und Forschungsziel dieser Arbeit
3 Relevante gesellschaftstheoretische Konzepte – theoretische Grundlagen
3.1 Bildungschancen und soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems
3.1.1 Die Begriffe Arbeiterkind, Nicht-Akademikerkind und andere wichtige Begriffe
3.1.2 Selektivität des Bildungssystems
3.1.3 Ökonomische und gesellschaftspolitische Relevanz
3.1.4 Unterstützungsangebote beim Übergang zur Hochschule
3.2 Diversity Management und Widening Access
3.2.1 Definition
3.2.2 Entwicklung von Diversity Management an deutschen Hochschulen
3.3 Mentoring
3.3.1 Definition, Historie und Anwendungsbereiche
3.3.2 Mentoring-Initiativen an Hochschulen
3.3.3 Mentoring im Netzwerk
3.4 Webbasierte soziale Netzwerke
3.4.1 Definition, Nutzerverhalten und Einfluss auf unsere Lebenswelt
3.4.2 Nutzung durch Mentoring-Netzwerke
4 Methodik
4.1 Die Methode der Einzelfallstudie
4.2 Verwendete Methoden zur Materialsammlung
4.3 Eigene Involviertheit der Autorin: teilnehmende Beobachtung
4.4 Verwendete Methoden zur Materialanalyse
5 Ergebnisse – Darstellung der Initiative Arbeiterkind.de
5.1 Historie
5.1.1 Entstehungsgeschichte
5.1.2 Heutige Größe und Bedeutung
5.2 Äußere Struktur: Unternehmensform, Management und Organisation
5.2.1 Unternehmensform und Größe
5.2.2 Kooperationen, Unterstützer, Finanzierung
5.2.3 Aufgabenverteilung zwischen der Basis und dem Berliner Büro
5.3 Angebote
5.3.1 Information und Unterstützung
5.3.2 Qualifizierung
5.3.3 Austausch
5.3.4 Zwischenfazit Angebote
5.4 Klientel und Motive
5.4.1 Mitgliederstruktur
5.4.2 Motive
5.4.3 Besonderheiten
5.4.4 Zwischenfazit Klientel und Motive
5.5 Mentoring
5.5.1 Das Mentoring-Konzept
5.5.2 Zwischenfazit Mentoring
5.6 Innere Struktur: Funktionsweise
5.6.1 Einstieg, Größe der Initiative, aktive und passive Mitglieder
5.6.2 Die selbstorganisierte Community
5.6.3 Qualitätssicherung
5.6.4 Zwischenfazit Innere Struktur
5.7 Zusammenfassung der Erfolgsfaktoren und Hemmnisse
5.8 Öffentliche Wahrnehmung und politische Wirkung
6 Arbeiterkind.de: Versuch eines Modells
6.1 Fallrekonstruktion
6.2 Das Modell: Arbeiterkind.de als Community
7 Fallkontrastierung
7.1 Vergleich des Modells mit anderen Fällen
7.1.1 Studienkompass
7.1.2 Rock your life
7.1.3 MentorinnenNetzwerk Hessen
7.1.4 Ubuntu
7.2 Überprüfung des Arbeiterkind.de-Modells
8 Schlussfolgerungen
8.1 Schlussfolgerungen für die Initiative Arbeiterkind.de
8.2 Schlussfolgerungen für Mentoring- und Widening-Participation-Maßnahmen
8.3 Ausblick und weitere mögliche Forschungsansätze
Literatur und Quellen
Anhang
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Abbildungen
Abb. 3.1: Bildungsbeteiligung und soziale Zusammensetzung 2007
nach akademischem Abschluss des Vaters absolut und in %
Abb. 3.2: Bildungstrichter 2007: Schematische Darstellung sozialer
Selektion – Bildungsbeteiligung von Kindern nach Hochschul-
abschluss des Vaters in %
Abb. 4.1 Schematische Darstellung der Forschungsarbeit
Abb. 5.1 Angebote von Arbeiterkind.de aus Sicht des Nutzers
Abb. 6.1 Arbeiterkind.de: Community
Abb. 6.2 Arbeiterkind.de: Selbstbestimmtes Engagement und Benefits
Abb. 6.3 Arbeiterkind.de: Orts- und Themengruppen, Berliner Büro und
Regionalbüros
Abb. 6.4 Arbeiterkind.de: Strukturierte Angebote
Abb. 7.1 Studienkompass: menteezentriert, starke operative Steuerung
Abb. 7.2 Rock your life: Franchise und strukturiertes Programm
Abb. 7.3 MentorinnenNetzwerk: abgegrenzte Angebote
Abb. 7.4 Modell Ubuntu: eine typische Community
Tabellen
Tab. 5.1 Auszeichnungen Arbeiterkind.de 2008-2011
Tab. 7.1 Strukturmerkmale von Arbeiterkind.de und Vergleichsfällen
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit sind im Text meist nur die männlichen Formen genannt. Selbstverständlich sind immer die weiblichen Formen mit gemeint.
Zusammenfassung
Arbeiterkind.de ist eine 2008 gegründete und annähernd 5.000 Mitglieder zählende Initiative, die Kinder und Studierende aus bildungsfernen Schichten auf ihrem Bildungsweg berät und während des Studiums unterstützt.
Diese Arbeit untersucht Struktur, Funktionsweise, Mentoring-Konzept und Motive für das Engagement bei Arbeiterkind.de anhand der Methode der Einzelfallstudie. Es wurden dazu qualitative Interviews mit elf Personen unterschiedlicher Funktion geführt. Weitere Datenquellen waren die Homepage und das onlinebasierte soziale Netzwerk von Arbeiterkind.de. Da die Autorin selbst Mitglied ist, wurde die Erhebung durch die Methode der teilnehmenden Beobachtung ergänzt. Aus den Ergebnissen wurden 21 Strukturmerkmale abgeleitet, diese waren Grundlage für die Entwicklung eines Modells.
Das Modell zeigt Arbeiterkind.de als eine Community mit zentraler Steuerung und teilstrukturiertem Angebot. Wesentliche Strukturmerkmale sind: eine offene Gemeinschaft, dezentrale Organisation in Ortsgruppen, web-2.0-basierte Kommunikation und eine moderate zentrale Steuerung. Die Angebote bestehen aus a) Information und Unterstützung, b) Qualifizierung und c) Austausch. Sie sind nur teilweise strukturiert und es gibt kein strukturiertes Mentoring-Programm. Der Mentoren-Begriff ist sehr weit gefasst: Abeiterkind.de versteht darunter jede Art von Engagement in der Initiative. Es kommen 1:1-Mentoring-Beziehungen vor, weitaus häufiger sind jedoch kürzer andauernde, informelle Beratungs-Situationen. Die Angebote richten sich jeweils an alle Mitglieder im Netzwerk, Zielgruppen sind also Mentees und Mentoren. Motive für das Engagement sind sinnstiftende Aktivität und ein Zugehörigkeitsgefühl. Letzteres führt bei einigen Mitgliedern zu einem selbstbewussteren Umgang mit der eigenen Herkunft.
Es konnten sowohl Unterschiede zu einer klassischen Community wie auch zu traditionellen Mentoring-Initiativen aufgezeigt werden. Als Community weist sich Arbeiterkind.de durch mitgliedergetriebene Aktivitäten, eine hohe Durchlässigkeit und die nur sehr schwach ausgeprägte zentrale Steuerung aus. Gegensätzlich zu einer klassischen Community ist das teilweise strukturierte Angebot.
Von einer traditionellen Mentoring-Initiative unterscheidet sich Arbeiterkind.de vor allem durch das Fehlen eines strukturiertes Mentoring-Programms und der nicht eindeutigen Unterscheidung zwischen Mentor und Mentee. Weitere Unterschiede sind die schwache operative Steuerung und der offene, überregionale und Disziplinen übergreifende Zugang.
Das Modell der Community ist geeignet, um junge Menschen über Bildungsmöglichkeiten zu informieren und sie zu unterstützen. Onlinebasierte Kommunikation, selbstbestimmtes Engagement und punktuell abrufbare Angebote greifen die Handlungs- und Kommunikationsformen der Zielgruppe auf. Arbeiterkind.de nutzt damit zukunftsweisende Methoden der Zusammenarbeit. Die Struktur von Arbeiterkind.de und der Mentoring-Begriff werfen jedoch häufig Fragen auf. An dieser Stelle scheint mehr Aufklärungsarbeit und intensivere Kommunikation über die Struktur der Initiative nötig.
Die wachsende Mitgliederzahl sowie die Motive der Mentoren spiegeln nicht nur die empirisch belegte Ungerechtigkeit im Bildungssystem wider. Auch zeigt der große Zulauf, dass es bisher wenige Initiativen gibt, die die Zielgruppe bildungsferner Jugendlicher beim Übergang von Schule zu Hochschule und im Studium unterstützen. Die Geschichte von Arbeiterkind.de zeigt damit ein typisches Muster gesellschaftspolitischen Wandels: nämlich, dass häufig zuerst gemeinnützige Akteure auf gesellschaftliche Probleme reagieren, und damit Wegbereiter für eine breite öffentliche Diskussion sind. Es ist jetzt Aufgabe von Politik und Gesellschaft, Schulen und Hochschulen in dieses Handlungsfeld einzugreifen und entsprechende Maßnahmen zu entwickeln.
Hochschulen haben dem Thema Widening Access, insbesondere dem Zugang bildungsferner Gruppen, bisher nur wenig Beachtung geschenkt. Sie stehen aber vor der Herausforderung, eine höhere Beteiligung an tertiärer Bildung zu leisten und mehr Studierende zum Abschluss zu führen, um den wachsenden Markt für Akademiker zu bedienen. Bei der Entwicklung entsprechender Angebote kann eine Zusammenarbeit mit der Initiative Arbeiterkind.de sinnvoll sein.
1 Einleitung
Besonders im letzten Jahrzehnt haben die deutschen Hochschulen eine Vielzahl von Reformen und Umgestaltungen erfahren: die größten und folgenreichsten unter ihnen dürften der europaweite Bologna Prozess und die bundesdeutsche Exzellenzinitiative gewesen sein. Letztere führte insofern zu einem Paradigmenwechsel im Hochschulsystem, als dass bis dahin der Glaube daran galt, dass es Aufgabe des Staates und der Hochschulen sei, eine flächendeckende, gleichmäßig gute Hochschulbildung für die Masse sicherzustellen. Der Begriff „Elite“ wurde enttabuisiert und brachte Wettbewerb in das Hochschulsystem. Es folgten die Bestrebungen der Hochschulen, Profile zu entwickeln, und bald schon kamen Rankings auf – ein weiterer Tabubruch. Diese Entwicklungen zogen eine Qualitätsdiskussion, Evaluationen und neue Formen des professionalisierten Managements nach sich. In der Lehre kamen die beiden von Bund und Ländern getragenen Initiativen „Hochschulpakt“ und der „Qualitätspakt Lehre“ hinzu, mit denen Studienplätze geschaffen und die Lehre verbessert werden sollten.
Einem reformbedürftigem Aspekt ist bei alldem bisher allerdings zu wenig Beachtung geschenkt worden und das stellt Hochschulen und Gesellschaft jetzt vor eine doppelte Herausforderung, die zwar nicht mehr ganz neu ist, sich aber in jüngster Zeit verschärft. Auf der einen Seite produzieren die Hochschulen derzeit nicht genügend hochqualifizierten Nachwuchs (Stichwort: Fachkräftemangel), zugleich ist auf der anderen Seite die Quote der Beteiligung an universitärer Bildung nicht ausgeschöpft. Letzteres beruht unter anderem auf einer unterdurchschnittlichen Repräsentanz von bildungsfernen Schichten an den Hochschulen. In Großbritannien und den USA wird dieses Thema unter dem Stichwort „Widening Participation“ bereits seit langem angegangen und hat zu entsprechenden staatlichen Förderprogrammen und Anstrengungen der Hochschulen geführt, mit dem Ziel, die Beteiligung von unterrepräsentierten Gruppen (z. B. bestimmte soziale Schichten, Ethnien) an Hochschulbildung zu erhöhen.
Welche Ursachen liegen hierzulande der niedrigen Bildungsbeteiligung an Hochschulen zugrunde? Maßgebliche Gründe sind in den Selektionsmechanismen des deutschen Bildungssystems zu finden. Zentral ist dabei das in der Regel dreigliedrige Schulsystem und die Übergänge von Schule zu Hochschule. Schüler aus bestimmten, höheren sozialen Schichten, die einen bildungsnahen Hintergrund mitbringen, haben bessere Chancen auf Hochschulbildung als Schüler aus bildungsfernen Elternhäusern. Auch die Hochschulen selbst tragen zu dieser Bildungsselektivität bei. Sie gingen lange vom „Normalstudierenden“ aus, nämlich von Studierenden, die ca. zwanzig Jahre alt, deutschstämmig und kinderlos sind und die ihren Hochschulzugang auf dem ersten Bildungsweg erworben haben, und sprachen so nur eine bestimmte Bevölkerungsschicht an. Seit 2005 können sie sich zudem ihre Studierenden zu einem Teil selbst auswählen. Zwar schöpfen die meisten Hochschulen diese Möglichkeit nicht in vollem Maße aus, dennoch birgt sie die Gefahr der Bildung selbstreproduzierender, homogener Gruppen. Es fehlen zudem geeignete, systematische Unterstützungsangebote, die Schüler beim Übergang zum Studium und Studierende während des Studiums begleiten.
Erst jüngst rücken die Themen Widening Participation und Diversität als Aktionsfelder in den Fokus der Hochschulen. Mentoring-Programme für Frauen, Programme für Migranten und der Wettbewerb um Studierende mit bestimmten Profilen sind erste Ansätze. Zumeist beschränkt sich jedoch das traditionelle „Diversity Management“ auf die bereits eingeschriebenen Studierenden – z. B. behinderte Studierende, Studierende mit Kindern, bestenfalls gibt es Angebote für Migranten. Sozioökonomische Randgruppen werden nicht systematisch betreut, höchstens Einzelfälle am Rande durch sog. Härtefallregelungen. Ein umfassendes Diversity Management, und systematische Widening Participation-Ansätze, die auch die Anwerbung von Studierenden umfassen, sind jedoch noch kaum realisiert.
In diesem Vakuum entstand 2008 die Initiative Arbeiterkind.de. Die gemeinnützige Initiative richtet sich an Jugendliche und Schüler aus bildungsfernen Schichten und unterstützt sie auf ihrem Weg ins Studium und während des Studiums. Das mittlerweile vielfach ausgezeichnete Netzwerk ging aus einer privaten Keimzelle hervor und ist in relativ kurzer Zeit sehr stark gewachsen. Insgesamt fast 5.000 Mitglieder sind an 80 Standorten engagiert (Arbeiterkind.de, 2012), eine im Vergleich zu anderen Netzwerken große Anzahl. Die Initiative ist als gemeinnützige Unternehmergesellschaft (sog. „Mini-GmbH“) organisiert.
In allen großen Städten haben sich Ortsgruppen etabliert. Sie bieten auf lokaler Ebene unter anderem Informationsveranstaltungen in Schulen, Informationsstände auf Hochschulveranstaltungen und Messen an und vermitteln Mentoring-Kontakte. Ein soziales Netzwerk im Internet ist die wesentliche Austausch- und Organisationsplattform. Mentoring-Kontakte laufen vergleichsweise formlos ab. Da weder eine Mitgliedschaft noch die Teilnahme an einem Programm vorgesehen ist, ist der Einstieg als Mentor und Mentee mit einer vergleichsweise niedrigen Hemmschwelle verbunden. Auch die Definition des Begriffs Mentoring weicht vom konventionellen Mentoring-Begriff ab: als Mentor zählt jeder, der sich im Netzwerk engagiert, unabhängig davon, auf welche Weise das Engagement erfolgt (z. B. Betreuung von Mentees, Halten von Schulvorträgen, Vertreten von Arbeiterkind.de auf Messeständen, Organisation einer Ortsgruppe). Das Netzwerk unterscheidet sich somit auffällig von klassischen Mentoring-Netzwerken, die sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren an Hochschulen und in deren Umfeld etabliert haben.
Bisher liegen noch keine Untersuchungen zur Struktur und zu den Erfolgsfaktoren vor. Eine erste großangelegte Studie läuft derzeit an der Universität Gießen an und eine Studie der Zeppelin University Konstanz zur Wirkungsforschung von Arbeiterkind.de in Hessen liegt vor. Insbesondere zum Einfluss auf die Bildungspartizipation, zur Verankerung an Hochschulen und zum Einfluss auf Hochschulpolitik gibt es noch keine empirischen Daten.
Diese Arbeit möchte einen ersten, qualitativen Beitrag dazu leisten, die Besonderheiten des Netzwerks darzustellen. Im Fokus der Untersuchung werden die Struktur, die Funktionsweise und das Mentoring-Konzept stehen. Sie werden jeweils auch daraufhin untersucht, inwieweit sie sich als erfolgsfördernd oder als problematisch für die Entwicklung der Initiative erwiesen haben. Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, das die Initiative Arbeiterkind.de mit Stärken und Schwächen abbildet und das gleichzeitig eine Diskussionsgrundlage für die weitere Entwicklung von Mentoring-Initiativen für Schüler und Studierende bietet.
2 Stand der Forschung und Ziel dieser Arbeit
2.1 Einordung des Themas
Der Untersuchungsgegenstand befindet sich in der Schnittmenge mehrerer Forschungsfelder, die hier kurz genannt und deren theoretische Grundlagen in Kapitel drei ausführlich dargestellt werden. Zunächst ist er in das Feld der sozialen Durchlässigkeit des Bildungssystems einzuordnen, damit schneidet das Thema gleichzeitig eine gesellschaftspolitische Dimension an. Arbeiterkind.de ist dabei als eine NGO zu sehen, die im Betätigungsfeld von Übergängen im Bildungssystem Unterstützung leistet. Aus der Perspektive der Hochschulen hat der Untersuchungsgegenstand zweitens eine Schnittmenge mit dem Themenfeld der Diversity-Diskussion und hier insbesondere mit der Diskussion um den Zugang für potenzielle Studierende aus bildungsfernen Schichten. Für diesen Sachverhalt werden im englischen die Begriffe „Widening Access“ und „Widening Participation“ gebraucht.[1] Drittes Feld ist das Mentoring, ein Bereich, in dem viele Hochschulen seit Ende der 90er Jahre aktiv sind. Auch gibt es bereits erste Angebote von Universitäten an Schüler, um diese auf ihrem Weg ins Studium zu begleiten. Aufgrund seiner Struktur und der Verwendung einer Online Austauschplattform kommt als vierter Aspekt der Gesichtspunkt von sozialen Netzwerken hinzu.
2.2 Stand der Forschung über das Netzwerk Arbeiterkind.de
Das Netzwerk Arbeiterkind.de ist bisher noch kaum Gegenstand von systematischen Untersuchungen. Es liegt lediglich eine Studie der Zeppelin University mit dem Titel „Arbeiterkind Impact Report“ vor, die eine Wirkungsforschung über die Angebote des Netzwerks in Hessen angestellt hat (Schabernack & Spokoinyi, 2011). Daneben ist eine größer angelegte Untersuchung des Institutes für Erziehungswissenschaften der Universität Gießen angelaufen. Die zweijährige wissenschaftliche Studie ist sowohl quantitativ als auch qualitativ angelegt. Eine Online-Umfrage unter allen Mitgliedern erhebt zunächst umfangreiche Daten zu Mitgliederstruktur, Motiven und Aktivitäten der einzelnen Mitglieder. Danach sind Gruppendiskussionen, Interviews und Workshops geplant. Im Frühjahr 2012 laufen bereits Gruppeninterviews. Ich selbst habe am Interview in Berlin zusammen mit sieben weiteren Mentoren teilgenommen.[2]
Für die quantitative Untersuchung der Zeppelin University wurden 570 Oberstufenschüler aus 13 Schulen in der Zeit von September 2010 bis September 2011 befragt. Anlass war die Evaluation des von der JP Morgan Chase Foundation geförderten Hessenprojektes. In diesem Pilotprojekt unterstützt eine landesweit tätige Koordinatorin die Aktivitäten der lokalen Gruppen. Eines der Ziele des Hessenprojektes war es, in diesem Zeitraum 5.000 Schülerinnen und Schüler zu erreichen.
Der Untersuchung lag die – von der Leitung des Arbeiterkind.de-Netzwerks aufgestellte – Hypothese zugrunde, dass Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien Unterstützung, Motivation und insbesondere Information über Studienbedingungen fehlen und dass sie daher eine strukturelle Benachteiligung gegenüber Kindern aus Akademikerfamilien erfahren.
Die Untersuchung konnte erstens zeigen, dass das Netzwerk mit seinen Aktivitäten seine Zielgruppe erreicht: durch Schulvorträge, Messeauftritte und andere Aktivitäten wurden insgesamt 17.000 Schülerinnen und Schüler, und damit weit mehr als erwartet, erreicht. Von den Befragten waren 56 Prozent „working class children“ (die Studie liegt in Englisch vor, daher wird die Begrifflichkeit hier übernommen; gemeint ist, dass beide Eltern keinen akademischen Hintergrund haben). Auch konnten alle Themen, die den Schülerinnen und Schülern wichtig waren bedient werden, insbesondere Fragen zu Finanzierung, Hochschulzugang und Informationen über bestimmte Fächer.
Zweitens konnte nachgewiesen werden, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Hochschulstudium aufzunehmen, vom Bildungsgrad der Eltern abhängig ist: Bei gleicher schulischer Leistung streben signifikant weniger Kinder von Nicht-Akademikern ein Studium an, als solche von Akademikern. Dabei spielt vor allem der Bildungshintergrund des Vaters die entscheidende Rolle, ist er Nicht-Akademiker, ist die Entscheidung für ein Studium am wenigsten wahrscheinlich.
Die Studie untersuchte auch, von welchen Bezugspersonen die Schüler Informationen über ein mögliches Studium erhalten. Die Bezugspersonen unterscheiden sich je nach Herkunftsfamilie: fast 60 Prozent der Kinder von Akademikern fragen ihre Eltern, bei Nicht-Akademikerkindern sind es hingegen nur knapp ein Viertel. Dieser Effekt verstärkt sich noch, wenn man davon ausgeht, dass Akademikerkinder durch ihre soziale Herkunft wahrscheinlich ein besseres Netzwerk an Akademikerbekannten haben. Kinder nicht-akademischer Eltern suchten hingegen Lehrer, Schulpersonal oder die Arbeitsagentur zur Beratung auf. Dort seien sie häufig mit Vorurteilen konfrontiert und würden gegen die Aufnahme eines Studiums beraten werden, so die Einschätzung der Autoren der Studie.
Laut den Ergebnissen der Befragung können sich nach den Informationsveranstaltungen durch Arbeiterkind.de mehr Schülerinnen und Schüler mit nicht-akademischen Eltern vorstellen, ein Studium aufzunehmen. Sehr viele von ihnen wollen das Angebot des Netzwerks weiter nutzen, insbesondere das Internet (76 Prozent), aber auch das soziale Netzwerk (25 Prozent) oder das Angebot des Mentorings (16 Prozent).
2.3 Erkenntnisinteresse und Forschungsziel dieser Arbeit
Mit der Studie der Zeppelin University liegt eine erste, sehr aufschlussreiche Untersuchung vor, die das Thema Arbeiterkind.de in den Kontext der sozialen Durchlässigkeit des Bildungssystems einordnet. Die anderen drei genannten Themenkomplexe, Diversity und Widening Access, Mentoring-Konzepte und die Struktur eines sozialen Netzwerks wurden bisher noch nicht untersucht. Auch ist noch keine Verortung des Netzwerks als NGO erfolgt.
Diese Arbeit untersucht Struktur, Funktionsweise als soziales Netzwerk und Mentoring-Aktivitäten von Arbeiterkind.de. Die Forschungsfelder Diversity Management/Widening Access und soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems wären aus der Perspektive der Hochschulsystems bzw. des Bildungssystems zu untersuchen und stehen daher nicht im Fokus der Arbeit. Dennoch sollen die Ergebnisse auch vor diesen Hintergründen diskutiert werden.
Arbeiterkind.de ist innerhalb kurzer Zeit vergleichsweise erfolgreich geworden (schnell wachsende Mitgliederzahl, Bekanntheit, viele Anfragen von Schulen, Schülern und Studierenden, zahlreiche Auszeichnungen). Mein Erkenntnisinteresse besteht darin, die Besonderheiten dieses Netzwerks herauszuarbeiten und zu verstehen, welche Faktoren sich erfolgsfördernd ausgewirkt haben. Auch möglicherweise problematische Faktoren sollen benannt werden. Diese Analyse soll so auch Unterschiede von Arbeiterkind.de zu anderen Netzwerken aufzeigen.
An dieser Stelle ist zu sagen, dass ich selbst seit 2010 Mitglied bei Arbeiterkind.de und darüber hinaus seit 2002 Mitglied im „MentorinnenNetzwerk hessischer Hochschulen für Frauen in Naturwissenschaft und Technik“ bin, einem Netzwerk, welches 2001 offiziell startete. Beide Netzwerke kenne ich also aus ihren Anfängen. Dabei hatte ich den Eindruck, dass das Arbeiterkind.de-Netzwerk weitaus dynamischer gewachsen ist und ich vermutete, dass dies unter anderem an der offeneren Struktur im Gegensatz zu dem stark formalisierten Programm des hessischen MentorinnenNetzwerks liegen könnte.
Bei der Untersuchung sollen insbesondere folgende Fragen anleiten:
- Welche Erfolgsfaktoren und Hemmnisse können benannt werden? Welchen Einfluss haben Größe, Struktur, Mentoring-Konzept und öffentliche Wahrnehmung?
- Welche Rolle spielen Inhalt und Methodik des Netzwerks (Ausfüllen einer „Marktlücke“ die Beratung der Schulen und Studienberatungen nicht abdeckt, bedürfnisorientiertes Angebot, Verankerung an Hochschulen)?
- Welches Mentoring-Konzept liegt zugrunde? Wie erfolgreich ist dieses?
- Was ist die Motivation der Mitglieder (Mentees und Mentoren)?
- Wie sieht die Mitgliederstruktur des Netzwerks aus (Mentees und Mentoren, Alter, Bildungsherkunft)?
- Was bedeutet die Organisationsform als soziales Netzwerk (virtuell, geringerer Grad an Verbindlichkeit, relativ informelles Mentoring-Konzept, Nutzung neuer Kommunikationsformen) und wie nachhaltig ist diese?
- Welche politische und öffentliche Relevanz hat Arbeiterkind.de als NGO?
Die Initiative Arbeiterkind.de soll anhand der Methode der Einzelfallstudie untersucht werden. Diese Methode sieht vor, aus den vorliegenden Daten und Analysen ein Modell zu entwickeln. Im vorliegenden Fall sollte dieses in der Lage sein, die Initiative mit Stärken und Schwächen abzubilden. Insbesondere sollte es die Erfolgsfaktoren erklären und damit begründen können, warum Arbeiterkind.de so schnell gewachsen ist und bisher so erfolgreich scheint.
Das zu entwickelnde Arbeiterkind.de-Modell könnte als Diskussionsgrundlage für die weitere Entwicklung von Mentoring-Initiativen für Schüler und Studierende dienen. Mögliche Aspekte wären etwa Mentoring im Kontext eines sozialen Netzwerks, Mentoring als NGO-Aktivität und Mentoring im Vorfeld des Hochschulzugangs.
3 Relevante gesellschaftstheoretische Konzepte – theoretische Grundlagen
3.1 Bildungschancen und soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems
3.1.1 Die Begriffe Arbeiterkind, Nicht-Akademikerkind und andere wichtige Begriffe
Die Begriffe Arbeiterkind und Nicht-Akademikerkind sind mittlerweile häufig gebrauchte, fast schon politische Schlagworte. Mangelnde Definitionsschärfe macht es jedoch häufig schwierig, vorliegende Zahlen zu vergleichen. Beim Vergleich und der Interpretation von Zahlen und Daten muss daher genau hinterfragt werden, welche Definition zugrunde liegt und welche Gruppe jeweils gemeint ist. Darum steht hier zunächst eine Klärung der Begriffe an.
Arbeiterkind im engeren Sinne bedeutet Kind von Arbeitern zu sein. Der Begriff Arbeiter wiederum definiert, neben Angestellten, Selbständigen und Beamten, eine von vier versicherungsrechtlichen Kategorien. So differenziert wird jedoch kaum mit dem Begriff Arbeiterkind umgegangen, weder in der öffentlichen Diskussion noch in der Literatur. Ein Grund dafür ist, dass häufig davon ausgegangen wird, dass es die Arbeiterklasse in dem Sinne nicht mehr gebe. Meist wird mit „Arbeiterklasse“ heute eine niedrige soziale Herkunft gleichgesetzt, und häufig haben die Mitglieder beider Gruppen in punkto Bildungsbeteiligung die gleichen Nachteile (Wikipedia, Stichwort Arbeiterkind).
Beim Vergleich der Literatur sind drei Systematiken zu erkennen: erstens die Unterscheidung zwischen den o. g. versicherungsrechtlichen Kategorien (Arbeiter, Angestellte, usw.), zweitens die Unterscheidung nach sozialer Herkunft und drittens die Unterscheidung nach Herkunft aus Bildungsmilieus. Dabei sind die Begriffe nicht immer eindeutig belegt. Hinzu kommen Übersetzungsschwierigkeiten aus englischsprachiger Literatur. Wie weiter oben bereits erwähnt, gebrauchen beispielsweise die Autoren der Studie „Arbeiterkind.de Impact Report“ den Begriff „working class children“ in dem Sinne, dass beide Eltern keinen akademischen Hintergrund haben. Zwar wäre hier die wörtliche Übersetzung „Arbeiterkind“, gemeint ist jedoch „Nicht-Akademikerkind“. Andere im Englischen gebrauchte und etwas weiter gefasste Begriffe sind: „first generation students“, „first generation participation“ und, für Personen, die als Akademiker an einer Hochschule arbeiten, „working class academics“.
Nun zu den schwieriger zu unterscheidenden, weil sehr ähnlich belegten Begriffen „soziale Herkunft“ und „Bildungsherkunft“. Grundlage für die Unterscheidung nach sozialer Herkunft sind vier vom HIS definierte soziale Herkunftsgruppen (hoch, gehoben, mittel, niedrig). Diese leiten sich im Wesentlichen von Beruf, Einkommen, Abschluss und Prestige des ausgeübten Berufs der Eltern ab. Heute scheint diese Definition jedoch zu kurz gegriffen, denn neben den genannten Indikatoren spielen auch soziales und kulturelles Kapital eine Rolle (Maaz et al., 2011, S. 11f.). Zum sozialen Kapital gehört es zum Beispiel, in den richtigen Netzwerken zu sein und diese für sich nutzen zu können. Mit kulturellem Kapital sind zum einen Bildungszertifikate gemeint, zum anderen aber auch der sogenannte Habitus. Dieser Begriff geht auf Bordieu zurück und bedeutet, dass eine Person die Zugehörigkeit zu einer Klasse durch ihr Auftreten (also Ausdrucksweisen, Kleidung, Lebensstil) deutlich macht (Bourdieu, 1983).
Im Unterschied zur sozialen Herkunft wird die Bildungsherkunft allein durch die Bildungsbiografien der Eltern definiert. Es interessiert in diesem Zusammenhang insbesondere, ob ein oder beide Elternteile einen Hochschulabschluss haben. Häufig synonym wird der etwas unschärfere Begriff „Bildungsmilieu“ und das Begriffspaar „bildungsnah“ und „bildungsfern“ gebraucht.
Am differenziertesten arbeitet die 19. Sozialerhebung des deutschen Studentenwerks mit den Begriffen. Die Autoren unterscheiden nach allen drei relevanten Kategorien: ob die Eltern Arbeiter, Angestellte, Selbständig oder Beamte sind, nach der sozialen Herkunft (allerdings „nur“ auf Grundlage der HIS-Definition) und nach dem Bildungshintergrund der Eltern. Letztgenannte Unterscheidung manifestiert sich in dem Begriffspaar Akademikerkinder versus Nicht-Akademikerkinder (Isserstedt et al., 2010).
Die Studie zeigt, dass die Bildungsmilieus quer zu den Kategorien Arbeiter, Angestellte usw. verlaufen. Die differenzierte Betrachtungsweise enthüllt, dass die Chancen, ein Studium aufzunehmen viel mehr als von der sozialen Herkunft vom Bildungsgrad der Eltern abhängen (siehe Abb. 3.1).
Daraus, dass der Bildungshintergrund der Eltern den größten Einfluss unter den genannten Faktoren darstellt, ergibt sich, dass die Begriffe Akademikerkind und Nicht-Akademikerkind die Tatsachen am besten widerspiegeln. Um also die Ursachen der ungleich verteilten Chancen im Bildungssystem auch sprachlich zu veranschaulichen, wäre dieses Begriffspaar das am besten geeignete für das hier zu untersuchende Thema.
Welche Begriffe werden nun von der Initiative Arbeiterkind.de benutzt? Das Netzwerk richtet sich mit seinem Angebot „an Schülerinnen und Schüler aus Familien, in denen noch niemand oder kaum jemand studiert hat“ (Arbeiterkind.de, 2012). Die Zielgruppe sind demnach Nicht-Akademikerkinder. Dies steht in einem etwas irreführenden Gegensatz zum Namen des Netzwerks.
In dieser Arbeit wird, um die Zielgruppe des Netzwerks klar zu benennen, mit dem Begriffspaar Akademikerkinder und Nicht-Akademikerkinder gearbeitet. Bei Zitaten aus Studien werden die dort verwendeten Begrifflichkeiten inklusive der zugrundeliegenden Bedeutungen zitiert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.1 Bildungsbeteiligung und soziale Zusammensetzung 2007 nach akademischem Abschluss des Vaters. Nur Deutsche, absolut und in % (gerundet). (Quelle: Isserstedt et al., 2012, S. 9)
3.1.2 Selektivität des Bildungssystems
In den 1950 Jahren stiegen die Studierendenzahlen deutlich an. Hintergrund waren u. a. Reformen im Schulsystem in den 50er und 60er Jahren, die es auch Kindern aus bildungsfernen Schichten ermöglichten, zur Hochschulreife zu gelangen. Jedoch waren die Chancen ungleich verteilt. Dahrendorf prägte bereits im folgenden Jahrzehnt die Formel der katholischen Arbeitertochter vom Land für Mehrfachbenachteiligung im Bildungswesen (Dahrendorf, 1965).[3] Mit dieser These und seinem Postulat von Bildung als Bürgerrecht (Dahrendorf, 1965)[4] sowie der Warnung vor der deutschen Bildungskatastrophe (Picht, 1964)[5] wurde eine politische Debatte um Hochschulbildung angestoßen. Es folgte die Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre und 1969 der Wechsel zur sozial-liberalen Regierungskoalition. Diese reagierte mit erheblicher Ausweitung der Kapazitäten, u. a. durch Universitätsneugründungen und Diversifizierung im Hochschulsystem (Reformuniversitäten, Pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen, später Berufsakademien und Gesamthochschulen). Hinzu kamen in den 70er Jahren das Numerus Clausus Urteil[6] und der Öffnungsbeschluss[7]. Das Resultat war ein im europäischen Vergleich sozial eher durchlässiges Bildungssystem bis etwa in die 80er Jahre hinein.
Auch wenn die Studierendenzahlen im langjährigen Mittel seit 30 Jahren ansteigen – dies hängt im Wesentlichen mit der Zunahme der Studienberechtigten zusammen (Isserstedt et al., 2010, S. 2) – wird das Bildungssystem heute generell als eher undurchlässig bewertet (z. B. Bude, 2011 Seite 40). Dafür werden insbesondere das Schulsystem und die Schwellen bei den Übergängen im Bildungssystem verantwortlich gemacht. Fatalerweise ist laut den Autoren der 19. Sozialerhebung dabei die Barriere von der Grund- zu einer weiterführenden Schule die größte (Isserstedt et al., 2012, S. 8).
Es folgen vier weitere Schwellen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Studienabschluss, nämlich der Übergang von Sekundarstufe I zu Sekundarstufe II, der Erwerb der Studienberechtigung, die Entscheidung zu einer Studienaufnahme und schließlich der Hochschulabschluss selbst. An diesen Schwellen entscheidet in Deutschland in hohem Maße die Herkunftsfamilie über die weitere Bildungskarriere eines Kindes. Am meisten hängt der Übergang zur Hochschule von der sozialen Herkunft ab (Isserstedt et al., 2010 S. 8).
In der Schule spielt die Leistungsdiagnostik eine wichtigte Rolle, wie die Studie „Herkunft zensiert“ der Vodafone Stiftung belegt: Die Benotung von Leistungen hängt nicht allein von der Leistung selbst ab, sondern in hohem Maße auch von der sozialen Herkunft. Kinder aus gebildeten Elternhäusern erreichen demnach mit einer 63-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein hohes Leistungsniveau, während das gleiche Leistungsniveau nur für 26 Prozent der Kinder niedriger sozialer Herkunft zutrifft. Dass bei der Benotung nicht nur die schulische Leistung einfließen kann, liegt auf der Hand: Die Autoren machen dafür auch sogenannte sekundäre Herkunftseffekte, also zum Beispiel den Einfluss der Herkunft eines Schülers auf das Urteil der Lehrer verantwortlich. Auch trauen sich Schüler aus ungebildeten Familien weniger zu, was wiederum einen negativen Einfluss auf ihre Leistung hat.
Aufschlussreich sind auch die Gründe von Nicht-Akademikerkindern für die Aufnahme eines Studiums: die Schüler sind weniger interessiert an Bildung an sich, sondern vielmehr an Unabhängigkeit oder Interesse an einem Fach (Schabernack & Spokoinyi, 2011).
Bemerkenswerterweise kommt die Vodafone-Studie zu dem Ergebnis, dass ein Migrationshintergrund als solcher bei der Notengebung keine Rolle spielt. In Analysen, die primäre (also rein die Leistung betreffende) und sekundäre Effekte trennten, stellte sich heraus, dass schlechtere Noten auf soziale Effekte zurückzuführen waren: „Von einer systematischen Benachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund durch das Bildungssystem kann nicht gesprochen werden“ (S. 13). Dies wird untermauert von dem Ergebnis aus der 19. Sozialerhebung, nämlich, dass Studierende mit Migrationshintergrund deutlich häufiger aus Familien mit eher niedrigerer sozialer Herkunft kommen.
Als Ursache für die soziale Undurchlässigkeit des Bildungssystems werden auch andere Gründe als das Schulsystem diskutiert. Bude sieht dafür zwei Dinge verantwortlich: Die „Dramatisierung der Lage an den Rändern“ und „die Ausbreitung einer sozialen Abschottungsbewegung in der Mitte, die vor allem in der Verteidigung von Bildungsreservaten für die Kinder der Besserverdienenden und Höhergebildeten zum Ausdruck kommt“ (S.41). Diese Schicht nennt er „die neue Mitte“ (S. 21).
In Zahlen bedeutet das: seit der zweiten hälfte der 90er Jahre ist die Zahl der jährlichen Studienanfänger um etwa ein Drittel angestiegen, 2008 lag die Anfängerquote bei 34 Prozent (Isserstedt et al., 2010, S. 2).[8] Die Bildungsbeteiligung von Arbeiterkindern liegt relativ konstant bei 17, von Nicht-Akademikerkindern bei 24 Prozent. Im Vergleich dazu: 61 Prozent der Kinder von Selbständigen, 67 Prozent der Beamtenkinder und 71 Prozent der Akademikerkinder ergreifen ein Studium (Isserstedt et al., 2010, S. 11).
Abbildung 2 zeigt den direkten Vergleich von Akademikerkindern (71 Prozent) und Nicht-Akademikerkindern (24 Prozent). Dies sind auch die Zahlen, auf die sich das Netzwerk Arbeiterkind.de in seinen Veröffentlichungen beruft.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.2 Bildungstrichter 2007: Schematische Darstellung sozialer Selektion – Bildungsbeteiligung von Kindern nach Hochschulabschluss des Vaters in %. (Quelle: Isserstedt et al., 2010, S. 9)
3.1.3 Ökonomische und gesellschaftspolitische Relevanz
Die Selektivität im Bildungssystem hat weitreichende gesellschaftspolitische und ökonomische Konsequenzen. Sie ist nicht nur ungerecht sondern auch gegenläufig zum Trend verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen.
Schauen wir zunächst die relevanten Entwicklungen an: Erstens haben wir es heute mit einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft zu tun. Migration, zunehmende Gestaltungsmöglichkeiten und Individualisierung aber auch Brüche in Lebensläufen sind Grundlage dieser Veränderungen. Zweitens steigen die Anforderungen des Arbeitsmarktes an die Diversität von Absolventen und deren Fähigkeiten, mit Diversität umzugehen. Nach dem Abebben des Studentenberges, der durch geburtenstarke Jahrgänge, doppelte Abiturjahrgänge und Abschaffen der Wehrpflicht verursacht wurde, stehen drittens absehbar rückläufige Studienanfängerzahlen bevor. Dies und der demografische Wandel führen dazu, dass in Deutschland bis 2020 1,2 Millionen Akademiker fehlen (CHE Consult, 2010).
Es ist Aufgabe von Politik, Schulen und Hochschulen, dafür zu sorgen, dass die heterogene Bevölkerung auch im Bildungssystem abgebildet wird. Dabei haben die Akteure zwei Aufgaben. Erstens geht es darum, möglichst vielen Menschen die Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. Voraussetzung ist es, auf unterschiedliche Bedürfnisse heterogener Studierendengruppen einzugehen. Zum Beispiel durch Beratungs- und Unterstützungsangebote bei sprachlichen oder sozioökonomischen Schwierigkeiten. Zum Teil sind den Hochschulen die Bedürfnisse und Schwierigkeiten heutiger Studierender noch gar nicht bekannt (Matuko 2010, S. 314). Eine entsprechende Hilfestellung würde eine heterogene Studentenschaft fördern und maßgeblich dazu beitragen, die Abbruchquoten zu minimieren. Nicht nur der durch einen Studienabbruch verursachte persönliche Schaden, sondern auch der dadurch entstehende volkswirtschaftliche Verlust könnten deutlich verringert werden.
Die zweite Aufgabe ist es, Fachkräfte für den künftigen Arbeitsmarkt auszubilden. Um dem drohenden Akademikermangel zu begegnen, ist es notwendig, den Zugang zu Bildung auch solchen Gruppen zu eröffnen und zu erleichtern, die bisher nicht berücksichtigt wurden. Dabei geht es keineswegs nur um die rein quantitative Bereitstellung von genügend Absolventen. Um die diverser gewordenen Anforderungen unserer Arbeitswelt zu bedienen, ist auch deren Vielfalt von Bedeutung (siehe auch Kap. 3.2 Diversity Management).
3.1.4 Unterstützungsangebote beim Übergang zur Hochschule
Angesichts der geschilderten Lage wäre zu erwarten, dass Politik, Schulen und Hochschulen Schüler wirksam beim Übergang von der Schule ins Studium unterstützen. Auch mit privatem bürgerlichen Engagement wäre an dieser Stelle zu rechnen. Recherchiert man jedoch die Literatur, so stellt sich heraus, dass es zwar eine Vielzahl systematisierter Angebote im Übergang von Schule zum Beruf gibt (Schlimbach, 2009; Ehlers & Kruse, 2009), deutlich weniger Angebote jedoch sind vorhanden, um Schüler auf ihrem Weg ins Studium zu unterstützen. Auch fehlt eine systematische Aufarbeitung darüber.
An dieser Stelle sollen kurz folgende Ergebnisse aus der Studie „Unterstützungsangebote im Übergang Schule-Beruf. Die Rolle gemeinnütziger Organisationen“ erwähnt werden, um eine Idee von dem möglichen Angebotsspektrum zu bekommen (Schlimbach, 2009): Die Vielfalt der Institutionen, die hier aktiv sind, ist beträchtlich: neben Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, gGmbHs, kirchlichen Einrichtungen und privaten Förderern engagieren sich vor allem auch Stiftungen. Die Akteure bieten einerseits systematische Unterstützung in der Schule und andererseits persönliche Beratung, z. B. in Mentoring- und Patenschafts-Programmen (S. 52).
Von Ehrenamt getragene Angebote, die auf den Übergang zum Studium vorbereiten, sind in dieser Vielfalt nicht zu finden. Im Gegenteil scheinen sie bisher weitgehend zu fehlen. Dies ist insofern überraschend, als die Autoren der Studie diagnostizieren, dass das Freiwilligenpotenzial bei der Unterstützung von Jugendlichen noch nicht ausgeschöpft sei (S. 50). Zwar bezieht sich die Aussage auf berufsvorbereitende Maßnahmen, es ist aber davon auszugehen, dass dieses Ergebnis übertragbar ist, denn schließlich sind die Inhalte der Unterstützung sich sehr ähnlich.
Dennoch soll versucht werden, die vorhanden Angebote kurz zu systematisieren.
Zunächst sind studienvorbereitende Themen in den Lehrplänen der Schulen vorgesehen. Wie bereits oben erwähnt, hängt die schulische Leistungsbewertung und Förderung und damit auch der Übergang zur Hochschule in hohem Maße von der sozialen Herkunft ab. Insofern ist bei studienvorbereitenden Maßnahmen zu befürchten, dass diese von den geschilderten Effekten überlagert werden. Dies und ob sie in ausreichender Quantität und Qualität angeboten werden, kann hier nicht beurteilt werden, da dies den Rahmen der Arbeit überschreiten würde.
Daneben bieten die Agenturen für Arbeit Hilfe bei der Orientierung. Es ist allgemein bekannt, dass deren Angebot allerdings häufig beklagt wird. Die Hochschulen selbst beraten und informieren im Rahmen von Hochschulinformationstagen und Studienberatungen. Beide Angebote, die der Arbeitsagenturen und die der Hochschulen, setzen aber voraus, dass Schülerinnen und Schüler sich bereits für ein Studium interessieren. Dies ist aber, wie beschrieben, vor allem bei denjenigen der Fall, die sich ein Studium auch zutrauen, nämlich Kinder aus Elternhäusern mit entsprechendem kulturellen Kapital.
Kommen wir zum Angebot von Vereinen, Verbänden und Stiftungen. Sie haben in der Regel fachliche oder soziale Schwerpunkte: Der gemeinnützige Verein MINT unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel etwa fördert naturwissenschaftliche und technische Fächer und ist mit Initiativen an gymnasialen Oberstufen präsent. Ebensolches gilt für die Angebote von Berufsverbänden, etwa dem VDI.
Während viele Stiftungen finanzielle Unterstützung im Studium anbieten, gibt es kaum stiftungsgetragene Beratungs- und Unterstützungsangebote für Schüler und angehende Studierende. Dies ist jedenfalls der Eindruck nach einer Internetrecherche, u. a. auf den Seiten des Stifterverbandes (Stifterverband, 2012) und des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen (Bundesverband Deutscher Stiftungen, 2012). Die folgenden beiden Stiftungen fördern sehr gezielt bestimmte soziale Gruppen bei der Vorbereitung auf ein Studium: Die Hertie-Stiftung bietet Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund das sogenannte Start-Stipendium (Start Stiftung, 2012). Der Studienkompass der Accenture-Stiftung, der Deutsche Bank Stiftung und der Stiftung der deutschen Wirtschaft richtet sich explizit an Schüler, deren Eltern keine akademische Ausbildung haben (Studienkompass, 2012).
Schließlich stellen verschiedene Akteure im Internet Informationen bereit, etwa die Bundesländer auf der Seite www.studienwahl.de, die Hochschulen auf der Seite www.hochschul-kompass.de und die Aktiengesellschaft xStudy SE[9] ihre Seite www.studieren.de.
3.2 Diversity Management und Widening Access
Aus dem bisher Gesagten lassen sich leicht die Herausforderungen der Hochschulen erkennen, in Zukunft mit heterogener werdenden Zielgruppen umzugehen und dieses Thema systematisch zu bearbeiten. Diversity Management ist eine Methode, die sich dazu eignet und gerade von Hochschulen für diese Zwecke adaptiert wird. Daher ist diesem Thema das folgende Kapitel gewidmet.
3.2.1 Definition
Unter Diversity Management versteht man, eine Organisation so zu mangen und entwickeln, dass dabei einerseits die Individuen in ihrer Einzigartigkeit wahrgenommen, in ihren Potenzialen gefördert und bei ihrer Entfaltung unterstützt werden, und dass andererseits die Organisation von dieser Vielfalt profitiert. Diversity Management geht damit über die Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsaufträge hinaus: nicht gleichzustellen – und damit in gewisser Weise Unterschiede zu negieren – sondern das Gegenteil, nämlich Unterschiedlichkeit zu betonen und zu fördern ist das Ziel.[10]
Es wird zwischen körperlich-biologischen und sozio-kulturellen Diversity-Merkmalen unterscheiden. Zu ersteren gehören zum Beispiel Alter, Hautfarbe, körperliche Fähigkeiten und Einschränkungen sowie das Geschlecht. Zu den soziokulturellen Merkmalen gehören unter anderem regionale und soziale Herkunft, Sprache (auch Dialekt), Habitus, Gender, Ernährungsgewohnheiten, Zeitverständnis, Religion und Weltanschauung.
Die Aufgabe von Diversity Management ist es, Bedingungen zu schaffen, die dazu geeignet sind, den Anteil an unterrepräsentierten Gruppen zu erhöhen, diesen einen diskriminierungsfreien Zugang zu ermöglichen und die Entfaltung der Potenziale aller Gruppen zu fördern (Döge, 2008; Weheliye, n. d.).
Die Begriffe „Widening Access“ und „Widening Participation“ beschreiben Diversity Management Maßnahmen an englischen und amerikanischen Hochschulen, die dazu dienen, bestimmte Personengruppen, z. B. solche mit niedrigem sozialen Hintergrund, aus bildungsfernen Schichten (Großbritannien) oder aus verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen (USA) zu attrahieren und ihnen den Zugang zu tertiärer Bildung zu erleichtern. An amerikanischen Universitäten gibt es bereits seit über 20 Jahren aktives Diversity Management mit spezifischen Angeboten für alle Gruppen, insbesondere für verschiedene Ethnien. Mittlerweile gilt bereits „unter Highschool-Absolventen ethnische Vielfalt als wichtiges Argument bei der Wahl des Studienorts. Wer nicht wenigstens einige schwarze, asiatische oder lateinamerikanische Gesichter in den Vorlesungen und Seminaren vorzuweisen hat, gilt als spießig, intellektuell langweilig, ja unamerikanisch“ (Spiewak, 2008).
3.2.2 Entwicklung von Diversity Management an deutschen Hochschulen
Der Diversity-Diskussion steht in Deutschland zunächst die historisch bedingte Vorsicht im Umgang mit Diversity-Merkmalen gegenüber: nach den Schreckenstaten des NS-Regimes und dem 1949 im Grundgesetz verankerten Grundsatz, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, war das gemeinhin akzeptierte Prinzip, „blind“ gegenüber den meisten Diversity-Merkmalen zu handeln. Bis heute ist es daher unüblich und würde Befremden hervorrufen, wenn eine Institution Bewerber oder Beschäftigte nach ihrer Zugehörigkeit zu Rasse, Ethnie oder sexuellen Neigungen fragen würde. Hinzu kommen Datenschutzgesetze, die fordern, so wenig an persönlichen Daten wie möglich zu erheben und weiterzuverarbeiten.
Dennoch hat sich die Diskussion um mehr Vielfalt auch hier ihren Weg gebahnt. Seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts wird Diversity Management in Unternehmen eingesetzt, um Unternehmensressourcen voll auszuschöpfen.[11],[12] Bekannte Unternehmen, die bereits früh mit umfassenden Diversity Management Ansätzen arbeiteten, sind Ford, Daimler Chrysler AG, Hewlett Packard, Commerzbank und die Lufthansa AG.
In Verwaltungen und Hochschulen hingegen waren Maßnahmen, die über das gesetzlich Vorgeschriebene hinausgingen, wenig verbreitet. Gesetzliche Grundlagen bestimmten lediglich grobe Richtlinien oder regelten die Rechte einiger weniger Gruppen: das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, die Verpflichtungen der Hochschulen, Gleichstellungsbüros einzurichten sowie besondere Verpflichtungen gegenüber behinderten Angestellten. Über die Hochschulgesetze waren die Hochschulen zur Fürsorge gegenüber Studierenden mit Kindern, Behinderten und ausländischen Studierenden sowie zur geschlechtlichen Gleichbehandlung von Studierenden verpflichtet. Viele Aufgaben wurden in erster Linie von den Studentenwerken übernommen. Andere Diversity-Merkmale, wie Alter, Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Gender und die Herkunft, wurden nicht berücksichtigt. Im Gegenteil gingen die Hochschulen lange vom „Normalstudierenden“ aus: Männlich/weiblich, Innländer/-in, beide Eltern deutsch, kein Migrationshintergrund, aus Akademikerfamilie stammend, finanziell von der Familie unterstützt, 20 bis 24 Jahre, weiße Hautfarbe, heterosexuell, Hochschulreife auf dem ersten Bildungsweg erlangt, rational, individualistisch, kontrolliert, gesund und mobil (nach Matuko, 2010).
Initiativen, die ab den 90er Jahren aufkamen, wie Gender Mainstreaming, Total E-Quality und Audit Familienfreundliche Hochschule waren, zusammengenommen, erste Keime einer weiter verstandenen Vielfalt. Auch wenn sie im einzelnen vom modernen Diversity Management sehr verschiedene Ansatzpunkte hatten, können sie doch als Wurzeln von diesem angesehen werden (Vedder, 2006).
Die Idee des aktiven Diversity Managements und des Widening Access allerdings kommt in deutschen Hochschulen tatsächlich erst in den letzten Jahren auf (CHE Consult, 2010; Matuko, 2010). Grund ist, dass die Hochschulen damit der Herausforderungen einer zunehmend diverseren Studierendenschaft (ältere Studierende, Teilzeitstudierende, internationale Studierende, verschiedene Ethnien, ungerade Bildungswege, ...) begegnen wollen. Vorbilder sind dabei Unternehmen und natürlich internationale Hochschulen und deren Widening Participation Maßnahmen. Das CHE hatte zwei Wettbewerbe ausgeschrieben: „Vielfalt als Chance“ und zusammen mit dem Stifterverband „Ungleich besser“, um Diversity Management an deutschen Hochschulen zu etablieren. Es sind jeweils acht Pilothochschulen beteiligt. Beide Projekte enden 2012, ihre Ergebnisse werden als Best Practice veröffentlicht (CHE Consult 2012a, 2012b).
In jüngster Zeit gewinnt das Thema an gesellschaftspolitischer Notwendigkeit und ökonomischer Relevanz: Alterung der Bevölkerung, drohender massiver Fachkräftemangel und die zunehmend vielfältiger werdende Gesellschaft machen es notwendig, dass Hochschulen „mehr Fachkräfte ausbilden, und sie darüber hinaus auf die Erwartungen im Umgang mit der Vielfalt der Gesellschaft, der zukünftigen Arbeitgeber und vor allem der Vielfalt der Kundschaft entsprechend vorbereiten“ (Klammer & Matuko, 2010, S. 9).
Dies hat für die Hochschulen mehrere Implikationen: Zunächst müssen sie sich vom homogenen Bild der Studierendenschaft verabschieden und die Vielfalt anerkennen. Zweitens müssen sie ihr Angebot strukturell anpassen, um damit weitere Kreise potenzieller Studierender ansprechen zu können (z. B. Eltern, Berufstätige, Teilzeitstudierende). Besonders vor dem Hintergrund der aufgrund der demografischen Entwicklung ab 2020 prognostizierten stark rückgängigen Studienanfängerzahlen ist dies eine besondere Herausforderung, auf die sich die Hochschulen schon jetzt vorbereiten sollten, indem sie nicht mehr nur auf traditionelle Studierendengruppen zurückgreifen. Drittens müssen die Studienangebote sich stärker an den Bedürfnissen der Studierenden ausrichten, etwa um das vorzeitige Abbrechen zu verhindern. Konkret können dies spezifische Betreuungsangebote oder studienbegleitende Einführungskurse sein. Und viertens müssen die Hochschulen ihre Absolventen fit für eine diverse Gesellschaft machen. Hierzu gehört es auch, die Heterogenität bereits im Studium abzubilden. Voraussetzung ist es, anzuerkennen, dass heterogene Lerngruppen aufgrund der verschiedenen Denkmuster und Erfahrungen der Studierenden kreativer und innovativer sind (siehe z. B. Klammer & Matuko, 2010, S. 111).
Entsprechend ist die Forschung zu Diversity Management an Hochschulen noch recht jung. Systematische Bestandserhebungen zu Alter, Geschlecht, Ethnie, Elternschaft und sozialem Hintergrund haben lange lediglich die Studentenwerke in ihren Sozialerhebungen durchgeführt. Bis 2006 gab es nur zwei nennenswerte empirische Studien, die eine Bestandsaufnahme zu Diversity Management und deren Begleitforschung an Hochschulen unternahmen. Die erste Studie (Drewing, unveröffentlicht, zitiert in Vedder, 2006) zeigte allererste Ansätze an wenigen Hochschulen, die zudem noch weit von einem ausgereiften Diversity Management entfernt waren, unter anderem weil sie wesentliche Merkmale wie Alter, sexuelle Orientierung, Religionszugehörigkeit und sozioökonomische Herkunft noch nicht erfassten und „managten“. Auch war Diversity Management noch nicht Gegenstand von Forschung und Lehre insbesondere nicht im Fach BWL, wo es als Management Thema zu erwarten gewesen wäre, wie die zweite Studie zeigte (Krell et al., 2006).
Zum Schluss dieses Kapitels soll nicht unerwähnt bleiben, dass einige wenige Hochschulen in puncto Diversity Management bereits weit fortgeschritten sind: Einige Exzellenzuniversitäten haben das Thema Diversity Management in ihre Zukunftsstrategie integriert,[13] und die Universität Duisburg-Essen hat 2008 bundesweit das erste Prorektorat für Diversity Management eingerichtet. Zu dem dortigen umfassenden Diversity Management-Ansatz gehört die Einbindung aller Fakultäten über Zielvereinbarungen. Das Angebot an Teilzeitstudiengängen wird ständig überarbeitet und verbessert und die „Internationalisierung at home“ wird bewusst gefördert: Mit der Einbindung ausländischer Studierender wird die interkulturelle Kompetenz auch derjenigen Studierenden gestärkt, die sich einen Auslandsaufenthalt, zum Beispiel aus finanziellen Gründen, nicht leisten können. Unter dem Gesichtspunkt der hier vorliegenden Arbeit ist vor allem das dortige Projekt Chance2 erwähnenswert, ein Maßnahmenbündel, um die Beteiligung von begabten Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten oder mit Zuwanderungshintergrund an Hochschulbildung zu erhöhen. In dem Projekt arbeitet die Hochschule mit Schulen, engagierten Studierenden und Bürgern zusammen, um junge Leute zu informieren und zu unterstützen. Bestandteil ist u. a. ein Stipendienprogramm und spezielle Kurse, die den Übergang begleiten, wie zum Beispiel Studieneinstiegskurse und Sprachkurse (Klammer & Matuko, 2010).
3.3 Mentoring
3.3.1 Definition, Historie und Anwendungsbereiche
Der Begriff Mentor entstammt der griechischen Mythologie: Für die Zeit seiner Abwesenheit bat Odysseus seinen Freund Mentor, sich seines Sohnes Telemachos anzunehmen. In heutigen Mentoring-Konzepten bezeichnet man als Mentor eine (berufs-) erfahrene und meist ältere Person, die einer jüngeren Person, der Mentee, hierarchieübergreifend Unterstützung, Beratung, Zugang zu Netzwerken und informellen Informationen bietet und sie so für einen Zeitraum in ihrem (beruflichen) Werdegang begleitet (Wender & Poppov, 2005, S. 43). Die Unterstützung durch einen Mentor umfasst explizit, dass dieser seine Persönlichkeit und seine lebensgeschichtliche Erfahrung einbringt. Vom Coaching unterscheidet sich Mentoring dadurch, dass der Mentor keine explizite Ausbildung für diese Tätigkeit hat, dass er sich mit seiner persönlichen Erfahrung als Rollenmodell anbietet und dass die Zusammenarbeit häufig längerfristig angelegt ist.
Mentoring als Instrument der Karriereförderung entwickelte sich erstmals in den 60er Jahren in den USA. Dort, wie auch hier in Deutschland, wurde es zunächst in der Personalentwicklung großer Wirtschaftsunternehmen eingesetzt, wobei schon früh die Frauenförderung im Fokus von Mentoring-Projekten stand. Nach und nach entstanden auch in Politik und Wissenschaft, später auch in der Jugendförderung entsprechende Initiativen und Projekte. Heute gehört es zum Forderungskatalog der Politik, Mentoren-Programme verstärkt als ausbildungsvorbereitende und -begleitende Hilfen einzusetzen.[14]
Man unterscheidet verschiedene Arten von Mentoring: neben dem klassischen 1:1-Mentoring gibt es zunächst das Gruppenmentoring und das Peermentoring. Beim Gruppenmentoring betreut ein Mentor mehrere Personen. Beim Peermentoring organisieren die Gruppenmitglieder die Mentoringbeziehungen selbst, jedes Mitglied kann Mentor und Mentee sein und die Funktionen können auch wechseln. Relativ neu sind Formen des Online-Mentorings oder E-Mentorings, bei denen der Kontakt vorwiegend oder ganz über Medien wie Internet, E-Mail oder Telefon stattfindet, daneben entwickeln sich natürlich entsprechende Mischformen. Alle genannten Mentoring-Formen sind in der Regel eingebettet in einen formellen Rahmen, das heißt, sie sind Bestandteil eines Mentoring-Programms, zu dem in der Regel neben einer Programmkoordination begleitende Angebote gehören. In solchen Programmen werden Mentor und Mentee „gematcht“ (also von der koordinierenden Stelle einander zugeteilt), es ist ein zeitlicher Rahmen vorgesehen und von den Beteiligten werden Zielvereinbarungen erwartet. Häufig sind die Programme finanziert und es werden damit bestimmte institutionelle oder politische Ziele verfolgt. Davon unterscheidet man informelles Mentoring: Dies reicht vom „regelmäßigen Gespräch einer erfahrenen, älteren Person mit einer jüngeren, die sie für förderungswürdig hält“ (Schell-Kiehl, 2007, S. 19) bis hin zu den „Old-Boys-Networks“, in denen Männer ihre Erfahrung und ihre Beziehungen weitergeben, um ihre eigenen Position und die ihrer Verbündeten zu sichern (Ehlers & Kruse, 2007, S. 23).
3.3.2 Mentoring-Initiativen an Hochschulen
Der Schwerpunkt bei Mentoring-Aktivitäten an Hochschulen liegt traditionell auf der Förderung von Frauen. Das Forum Mentoring, die bundesweite Dachorganisation der Mentoring-Programme an Hochschulen, betont auf der Startseite des Internetauftritts, dass es sich für die berufliche Förderung von Frauen und Männern einsetzt und dass „Mentoring ein zentrales Instrument der geschlechtergerechten Nachwuchsförderung“ ist (Forum Mentoring, 2012a; siehe auch Franzke, 2006). Entsprechend sind vor allem solche Netzwerke Mitglied, die sich an Schülerinnen, Studentinnen/Absolventinnen, Doktorandinnen/Postdoktorandinnen und Habilitandinnen/Juniorprofessorinnen richten. Folgt man jedoch den Links zu den einzelnen Netzwerken, findet man darunter auch (zumeist jüngere) Programme, die geschlechtsneutral formuliert sind.
Im Frühjahr 2012 zählt Forum Mentoring 120 Programme. Sie sind an einzelnen Fachbereichen angesiedelt, hochschulweit oder hochschulübergreifend angelegt. Vermutlich gibt es deutlich mehr Programme, z. B. solche an privaten Hochschulen, und weitere, die nicht Mitglied sind (z. B. das Netzwerk femtec, in dem u. a. sieben Technische Universitäten zusammenarbeiten[15] ).
Zahlreiche Evaluationen von Mentoring-Programmen weisen deren Erfolg nach (Forum Mentoring, 2012b). Zum Beispiel zeigt die Evaluation des „MentorinnenNetzwerks für Frauen in Naturwissenschaft und Technik“ vom Juni 2010, dass Mentoring-Aktivitäten Mentees und Mentorinnen nutzen, beide Gruppen einen hohen persönlichen Gewinn erfahren, die gesteckten Ziele erreicht werden und Berufseinstiege leicht fallen. Zudem werden die Strukturen des Netzwerks als Karrierenetzwerke genutzt (MentorinnenNetzwerk, 2012a).
Heute sind viele Mentoring-Programme dabei, dem experimentellen Stadium zu entwachsen. Seit etwa 2005 geht es darum, die Ansätze dauerhaft in die Hochschulstrukturen zu implementieren (Franzke, 2006). Jedoch sind die Motive für eine Verstetigung in manchem Fall zu hinterfragen: wenn es um „Herzeigeprojekte geht, die man übernehmen soll“ oder um den „Zwang zur Ökonomisierung“[16], so kann man daraus kaum auf eine ernst gemeinte „Modernisierung der Universitäten im emanzipatorischen Sinne“ schließen (Nöbauer & Genetti, 2006, S. 71) Eben diese ernst gemeinte Bereitschaft ist aber Voraussetzung, um Strukturen und die Kultur einer Organisation wirklich zu verändern. Nur wenn Gleichstellung und Diversität in der ganzen Organisation ehrlich gewollt sind und nach diesen Prinzipien gehandelt wird, können alte Muster erfolgreich aufgebrochen werden, was letztlich der gesamten Organisation nützt.
3.3.3 Mentoring im Netzwerk
Strukturierte Mentoring-Programme haben in der Regel einen Pool von Mentoren und Mentees, für die häufig spezifische Angebote aufgebaut (z. B. moderierte Netzwerktreffen, Stammtische, Mailing-Listen) und die so zu einem Netzwerk weiterentwickelt werden. Selten bis gar nicht vorhanden sind allerdings eigene soziale Netzwerke (zur Definition von „soziales Netzwerk“ siehe Kap. 3.4) oder die Nutzung von bereits vorhandenen (siehe 3.4.2). Von vielen Mentoren und Mentees werden Mentoring-Projekte als Netzwerke wahrgenommen und dieses Merkmal wird besonders geschätzt. Die meisten Mentoring-Projekte nehmen damit gleichzeitig zwei Funktionen wahr, nämlich eine Mentoring-Funktion und eine Netzwerk-Funktion.
Im Netzwerk können weitere Rollenbilder präsentiert werden und weitere Kontakte entstehen. Die Mitglieder identifizieren sich mit dem Netzwerk und haben weniger Hemmungen, ein anderes Mitglied des Netzwerks anzusprechen – im Prinzip ein ähnliches Motiv wie es Studentenverbindungen zu Grunde liegt. Dies untermauert beispielhaft folgendes Zitat aus der Evaluation des hessischen MentorinnenNetzwerks: „Die Identifikation und Verbundenheit der Teilnehmerinnen mit dem MentorinnenNetzwerk ist sehr hoch. Mentees und Mentorinnen bleiben mehrheitlich über viele Jahre Mitglied und nutzen das Netzwerk als Forum für Austausch und berufliche Weiterentwicklung. Die Mentoring-Kooperationen münden nach ihrem offiziellen Ende meist in einen lockeren Kontakt. Viele Mentees engagieren sich nach erfolgreichem Berufseinstieg als Mentorinnen. Auf diese Weise wird auch die Verbundenheit der Alumnae mit ihren ehemaligen Hochschulen gestärkt. Unter den Mentorinnen entstehen eigenständige Vernetzungsaktivitäten über das offizielle Programm hinaus, wie zum Beispiel interne Firmennetzwerke, Stammtische oder Gruppen zur Kollegialen Beratung.“ (Forum Mentoring, 2012a).
3.4 Webbasierte soziale Netzwerke
Der folgende kurze Überblick über die Bedeutung und die Möglichkeiten von webbasierten sozialen Netzwerken soll helfen, den Stellenwert von OpenNetworX, dem sozialen Netzwerk, welches Arbeiterkind.de nutzt, zu bewerten.
3.4.1 Definition, Nutzerverhalten und Einfluss auf unsere Lebenswelt
Ein soziales Netzwerk ist eine Webanwendung für eine Gemeinschaft an Nutzern. Es bietet Mitgliedern eine Reihe von Funktionen: Das Erstellen eines persönlichen Profils, die Möglichkeit, sich mit anderen Nutzern zu vernetzen, Nachrichten auszutauschen und eigene Inhalte zu erstellen, z. B. über Statusmeldungen, Blogs, Bilder und Videos. Die Netzgemeinschaften werden als Online-Communities bezeichnet. In der Regel haben sie ein bestimmtes Thema, z. B. private Kontakte (Facebook) oder Geschäftskontakte (Linkedin und Xing).
Die Anfänge der sozialen Netzwerke liegen kaum ein Jahrzehnt zurück. Mittlerweile ist diese Kommunikationsform Bestandteil des täglichen Lebens und hat sich nicht nur als Mittel zur Kontaktpflege etabliert. Auch Unternehmen, politische Parteien und NGOs nutzen soziale Netzwerke für die Kommunikation mit ihren Mitgliedern.
Diese breite Nutzung hat inzwischen auch Einfluss auf Politik und Gesellschaft und verändert unsere Lebenswelt. Hier seien beispielhaft einige politische Aktionsformen genannt: Flashmobs (über soziale Netzwerke organisierte, kurze Menschenversammlungen im öffentlichen Raum, bei denen die Teilnehmer sich nicht kennen und ungewöhnliche Dinge tun), Crowd Intelligence (z. B. als Börsen organsierte Wahlumfragen, die weit zuverlässigere Wahlprognosen liefern, als die traditionellen Umfragen) und Blogs. Es gibt keine Qualitätssicherung, etwa in Form einer Redaktion. Die Netzgemeinschaft wählt aus, was wichtig wird: jeder Eintrag hat die Chance entdeckt und verbreitet zu werden (Zeger, 2009).
Die Untersuchung der Beziehung von virtuellen zu sozialen Netzwerken zeigt, dass im Online-Netzwerk Facebook vor allem bereits bestehende reale Kontakte vertieft werden (Kontaktpflege zu strong ties), dass das Kennenlernen hingegen eine Ausnahme darstellt (Kneidinger, 2010). Pelzl hingegen findet auch die Pflege schwacher Beziehungen vor (Pelzl, 2008). Das Projekt Medienkonvergenz Monitoring der Universität Leipzig zeigt empirisch, dass Jugendliche reale und digitale Kommunikation komplementär nutzen, d. h. sie handeln und kommunizieren in beiden Sphären nach den gleichen Regeln und mit gleicher Symbolik (Schorb et al., 2010). Verschiedene Studien weisen auf ein genderspezifisches Nutzungsverhalten, nämlich, dass Frauen soziale Netzwerke stärker nutzen als Männer (Boland et al., 2010; Hermeier, 2009).
3.4.2 Nutzung durch Mentoring-Netzwerke
Die Hochschul-Mentoring-Netzwerke nutzen externe soziale Netzwerke bisher so gut wie gar nicht. Das ergab meine stichprobenartige Suche auf Facebook nach den bei forum-mentoring.de gelisteten Netzwerken (Forum Mentoring, 2012a). Lediglich das Programm „Mena – Mentoring für Nachwuchswissenschaftlerinnen“ der Universität Koblenz-Landau hat einen Facebook-Auftritt. Zum Vergleich: Nicht nur unterhält Arbeiterkind.de (neben dem eigenen sozialen Netzwerk) einen Facebook-Auftritt. Auch gibt es auf Facebook Auftritte der einzelnen Ortsgruppen, die hier Werbung machen und einen Teil der Organisation abwickeln.
Ob die Mentoring-Programme der Hochschulen jeweils eigene, kleine soziale Netzwerke unterhalten, kann zwar nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Aber es spricht auch nicht vieles dafür, vor allem nicht die Tatsache, dass das Netzwerk-Selbstverständnis noch von Mailing-Listen ausgeht (Forum Mentoring, 2012a). Weiteres kann nur spekuliert werden, etwa dass es kaum zeitliche Ressourcen gibt, um ein solches Netzwerk einzurichten und zu unterhalten, und dass die Anfänge dieser Netzwerke – und damit vermutlich das meiste Personal – aus der Zeit stammen, als es soziale Netzwerke noch nicht gab. Viele der Koordinatorinnen werden vermutlich auch später dort nicht die Prioritäten ihrer Arbeit gelegt haben.
[...]
[1] Im Deutschen werden die Begriffe „Erweiterung/Ausweitung des Hochschulzugangs“ vor allem in Verbindung mit der Ausweitung der Hochschulzugangsberechtigung gebraucht (also Studieren ohne Abitur). Dies ist hier aber nicht gemeint und daher werden die englischen Begriffe (synonym) verwendet.
[2] "Arbeiterkinder an deutschen Hochschulen. Gelingensbedingungen, pädagogische und politische Konsequenzen. Wissenschaftliche Begleitforschung von Arbeiterkind.de.“ siehe http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb03/institute/ifezw/prof/sve/
mitarbeitende/ingridmiethe/forschung. (Zugriff am 03.02.2012) Die Einladung zur Online Umfrage durch Arbeiterkind.de erfolgte am 2. März 2012.
[3] Die heutige Formel für Mehrfachbenachteiligung lautet „Türkischer Jugendlicher aus Problemviertel“. (Wikipedia, Stichwort „Katholische Arbeitertochter vom Land“ Zugriff am 18.03.2012).
[4] Ralf Dahrendorf fordert den Zugang zu Bildung nicht nur im formalen, rechtlichen Sinne, sondern im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit. Menschen sollen durch Bildung die Chance bekommen, sich in ihrer Freiheit zu entfalten und davon Gebrauch zu machen.
[5] Mit einer Artikelserie in der Zeitschrift „Christ und Welt“ machte der evangelische Theologe Georg Picht Mitte der 60er Jahre auf den Bildungsnotstand in Schulen und Hochschulen aufmerksam. Er brachte erstmals die Argumente der Chancengleichheit aber auch von Bildung als Schlüsselqualifikation und Grundlage für ökonomisches Wachstum einer Gesellschaft auf. Mit seinen Veröffentlichungen stieß er eine politische Diskussion, die sog. Reformdebatte an.
[6] Das Bundesverfassungsgericht folgert 1972 aus dem Grundrecht für Berufsfreiheit, dass es ein Recht auf Zulassung zum Hochschulstudium gibt. Zulassungsbeschränkungen sind nur in Ausnahmefällen möglich.
[7] 1977 beschlossen Bund und Länder trotz des zu erwartenden Studentenbergs die Hochschulen offen zu halten und zeitweise Überkapazitäten hinzunehmen.
[8] Also der Anteil der deutschen Bildungsinländer/innen an der altersspezifischen Bevölkerung, die ein Studium aufgenommen haben. Bei Berücksichtigung von zugwanderten ausländischen Studierenden lag die Quote bei 40 Prozent.
[9] Die xStudy SE (Societas Europaea) ist eine europäische Aktiengesellschaft mit Sitz in München. Sie unterhält ein Portal zur Studienwahl im europäischen Hochschulraum. Quelle: www.studieren.de (Zugriff am 25.5.2012).
[10] Siehe dazu auch die Ausführungen von Peter Döge: Antidiskriminierung und Chancengleichheit haben per definitionem zum Ziel, Fremdes in die Gruppe zu integrieren, z. B. durch Quotenregelungen. Objekt des Handelns sind „defizitäre“ Personengruppen. Auf Dauer wird jedoch den entsprechenden Personengruppen einen Negativstatus zugewiesen. Diversity Management strebt jedoch nicht mehr Gleichheit sondern gleichwertige Vielfalt an (Döge S. 31 f.).
[11] Es lassen sich dabei unterschiedlich weit gehende Ansätze feststellen: Von der Anti-Diskriminierung, die zunächst nur die Gleichbehandlung sicherstellt und Diskriminierungen zu vermeiden sucht, über verschiedene Ansätze, die Vielfalt als Potenzial für die Wettbewerbsfähigkeit der Organisation oder für ihre innere Stärkung begreifen, bis hin zum dem Ansatz, der eine Organisation als soziales System ansieht (Weheliye, n. d.).
[12] Zum Thema des Managements von Diversity-Merkmalen siehe Döge, 2008: Als Grundlage für ein Diversity Management müssen Merkmale nicht nur erfasst werden. Darüber hinaus bedarf es einer Gegenüberstellung ausgewählter Merkmalskombinationen.
[13] RWTH Aachen, TU München (Klammer & Matuko, 2010).
[14] Z. B. Pressemitteilung BMBF 110/2006; Quelle: http://www.bmbf.de (Zugriff am 18.03.2012).
[15] Im Rahmen der Femtec arbeiten elf große Technologie-Unternehmen und sieben Technische Universitäten aus dem TU9-Verbund sowie die ETH Zürich zur Förderung des weiblichen Führungsnachwuchses zusammen. Quelle: http://.femtec.org/ (Zugriff am 0305.2012).
[16] Die Autorinnen argumentieren, dass die Hochschulen zunehmend wettbewerblichen und marktwirtschaftliche Mechanismen unterworfen sind. Diese verringerten die demokratischen Mitbestimmungsrechte und stärkten hierarchische Managementstrukturen. In der Folge führe dies zu „neuen Ausschließungen von strukturell verwundbaren Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlern“ (S. 71).
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Initiative Arbeiterkind.de?
Arbeiterkind.de ist ein Netzwerk, das Schüler und Studierende aus Familien ohne Hochschulerfahrung unterstützt, um die soziale Durchlässigkeit im Bildungssystem zu erhöhen.
Wie funktioniert das Mentoring-Modell von Arbeiterkind.de?
Im Gegensatz zu traditionellen Programmen gibt es kein starres 1:1-System. Es ist eine offene Community, in der Engagement breit gefasst wird und informelle Beratungssituationen sowie webbasierte Kommunikation dominieren.
Was bedeutet „Widening Participation“ im Hochschulbereich?
Dieser Begriff bezeichnet das Ziel, die Beteiligung unterrepräsentierter Gruppen an der Hochschulbildung zu steigern, um Bildungsgerechtigkeit und den Bedarf an Akademikern zu fördern.
Welche Rolle spielen Web 2.0-Technologien für das Netzwerk?
Web-2.0-basierte Kommunikation ermöglicht eine dezentrale Organisation in Ortsgruppen und einen schnellen, punktuellen Austausch zwischen Mentoren und Mentees über ganz Deutschland hinweg.
Warum engagieren sich Mentoren bei Arbeiterkind.de?
Die Hauptmotive sind sinnstiftende Aktivitäten und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, das oft zu einem selbstbewussteren Umgang mit der eigenen sozialen Herkunft führt.
- Citation du texte
- Dipl.-Biol. Claudia Müller (Auteur), 2012, Die Rolle von Mentoring/Mentoring-Netzwerken für die "Widening Participation" Forderung im Hochschulbereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210078