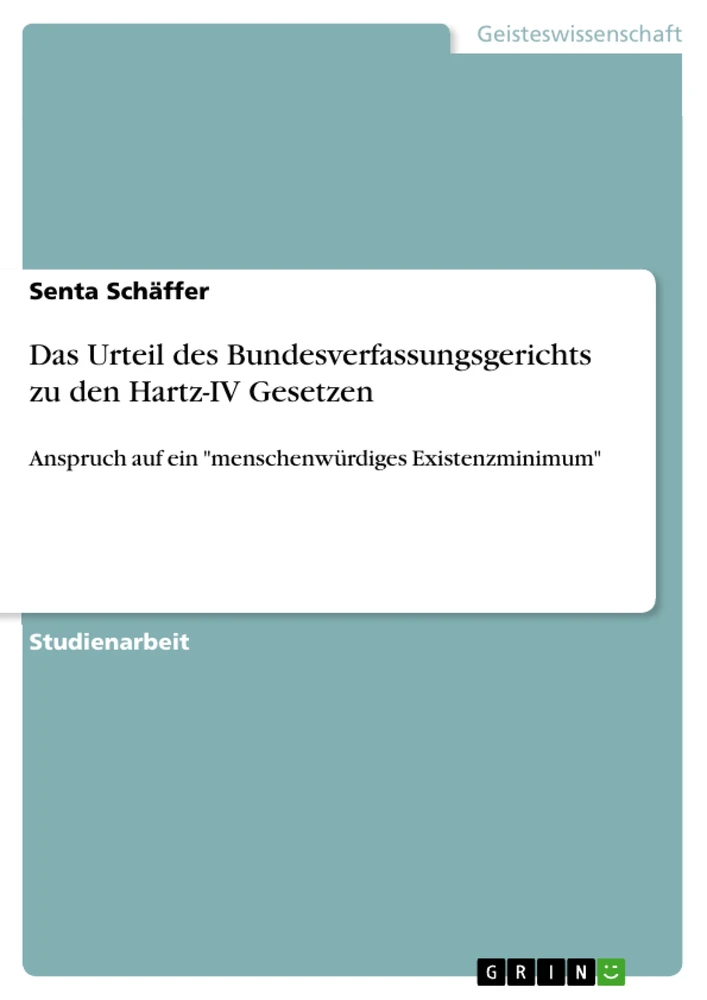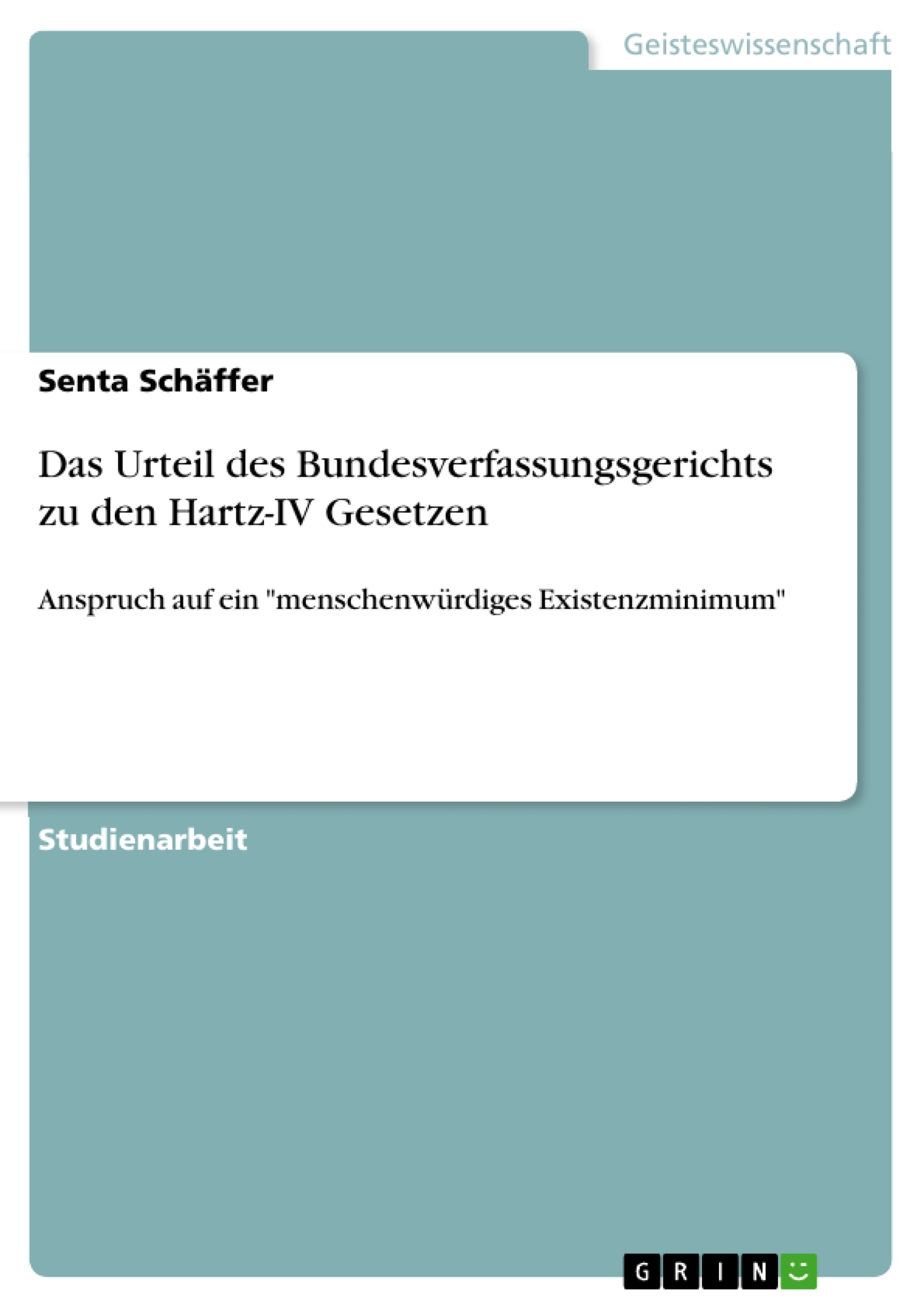Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dieser Entscheidung des BVerfG. Dabei werden im Einzelnen mehrere Aspekte durchleuchtet. Bevor die Argumente des Gerichts vorgestellt werden, wird zunächst das Bundesverfassungsgericht und seine Aufgaben, sowie die Grundsicherung im Allgemeinen vorgestellt. Nach einer kurzen Einführung in die Entstehung und Zusammensetzung der Grundsicherung, wird vor allem die Berechnungsweise der Regelleistung thematisiert. Hierzu werden verschiedene kritische Stellungnahmen, beispielsweiße vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, angeführt. Eine spezielle Thematisierung fordert das Konstrukt „menschenwürdiges Existenzminimum“, dass nach Urteil des BVerfG durch die Grundsicherung nicht erfüllt ist. In Kapitel 5 soll dieses Konstrukt auf seine Bedeutung hin überprüft und der Frage, ob die Grundsicherung auf dieser Grundlage die Chance auf ein menschenwürdiges Dasein bietet, nachgegangen werden. Um sich dieser Fragestellung zu nähern, ist es erforderlich die Strukturprinzipien „Menschenwürde“ und „Sozialstaatsprinzip“, aus denen sich das geforderte soziokulturelle Existenzminimum ergibt, kurz in Bezug auf die vorliegende Thematik zu erläutern. In einem abschließenden Fazit wird auf die Frage, ob die aktuellen Leistungen nach dem SGB II verfassungskonform sind eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Bundesverfassungsgericht
- 2.1 Die Organisation des BVerfG
- 2.2 Verfahrensarten
- 3 Die Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 3.1 Die Reform des Sozialhilferechts
- 3.2 Die Ermittlung des Regelbedarfs - Das Statistikmodell
- 3.3 Kritische Stellungnahme
- 4 Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
- 4.1 Das Urteil
- 4.2 Argumente des BVerfG
- 4.3 Umsetzung des Urteils durch den Gesetzgeber
- 5. Das,,soziokulturelle Existenzminimum"
- 5.1 Die Menschenwürde
- 5.2 Das Sozialstaatsprinzip
- 5.3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 9. Februar 2010 zu den Hartz-IV-Gesetzen, die den Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG betrifft. Sie beleuchtet die Funktionsweise des BVerfG, die Reform des Sozialhilferechts und die Berechnungsweise der Regelleistung. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse des Konstrukts „menschenwürdiges Existenzminimum“, insbesondere in Bezug auf die Strukturprinzipien „Menschenwürde“ und „Sozialstaatsprinzip“.
- Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz-IV Gesetzen
- Der Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum
- Die Organisation und Funktionsweise des Bundesverfassungsgerichts
- Die Reform des Sozialhilferechts und die Berechnung der Regelleistung
- Das soziokulturelle Existenzminimum im Kontext der Menschenwürde und des Sozialstaatsprinzips
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und skizziert die einzelnen Kapitel. Kapitel 2 gibt einen Überblick über das Bundesverfassungsgericht, seine Organisation und die wichtigsten Verfahrensarten. Kapitel 3 erläutert die Reform des Sozialhilferechts, die Einführung der Grundsicherung und die Kritik an der Berechnungsweise des Regelbedarfs. Kapitel 4 analysiert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz-IV-Gesetzen, insbesondere die Argumente des Gerichts. Kapitel 5 untersucht das Konzept des „soziokulturellen Existenzminimums“ und setzt es in Bezug zur Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Hartz-IV-Gesetze, Bundesverfassungsgericht, menschenwürdiges Existenzminimum, soziokulturelles Existenzminimum, Sozialhilferecht, Grundsicherung, Regelbedarf, Menschenwürde, Sozialstaatsprinzip.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern des BVerfG-Urteils zu den Hartz-IV-Gesetzen?
Das Gericht stellte fest, dass die bisherige Berechnung der Regelleistungen nicht den Anforderungen an ein menschenwürdiges Existenzminimum entsprach.
Aus welchen Grundrechten leitet sich das Existenzminimum ab?
Der Anspruch ergibt sich aus der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG).
Was wird an der Berechnungsweise der Regelleistung kritisiert?
Kritisiert wurde vor allem das Statistikmodell und die Frage, ob die daraus resultierenden Beträge tatsächlich eine Teilhabe am soziokulturellen Leben ermöglichen.
Welche Rolle spielt der Paritätische Wohlfahrtsverband in der Arbeit?
Die Arbeit führt kritische Stellungnahmen solcher Verbände an, um die Diskrepanz zwischen politischer Festsetzung und tatsächlichem Bedarf zu verdeutlichen.
Welche Konsequenzen hatte das Urteil für den Gesetzgeber?
Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, die Regelleistungen auf einer transparenten und sachgerechten Basis neu zu berechnen, um die Verfassungskonformität sicherzustellen.
- Citar trabajo
- Senta Schäffer (Autor), 2011, Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz-IV Gesetzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210187