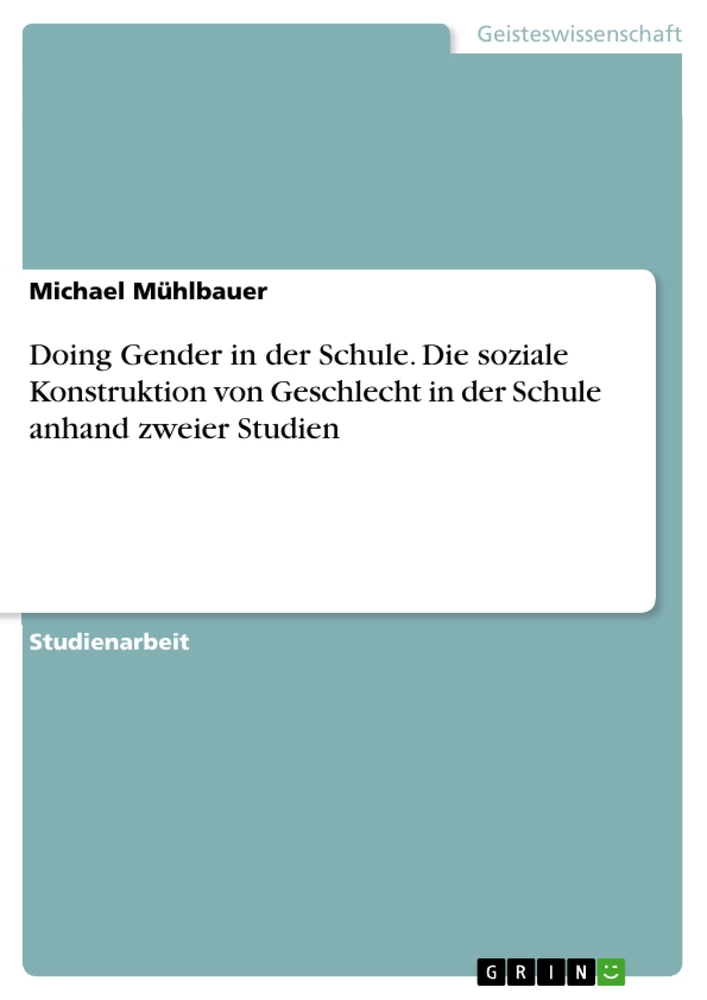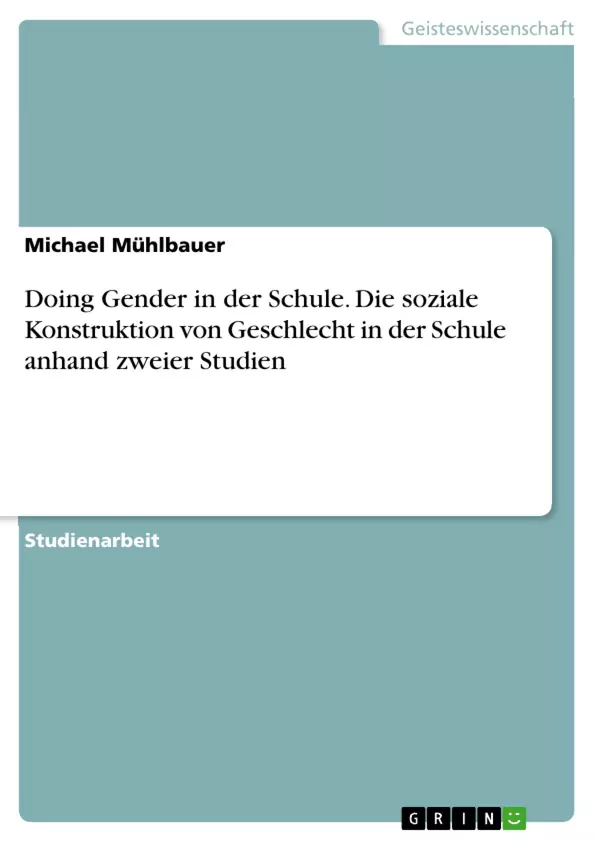In Schweden sorgte vor einiger Zeit eine Vorschule mit einem ganz besonderen
Konzept für ein enormes Medieninteresse, welches sich auch bis nach Deutschland
ausbreitete. So titelte die Zeit in ihrem Onlineauftritt „Sei, was du willst“ und
beschreibt in einem Artikel die umstrittene Idee: „Egalia ist die umstrittenste
Vorschule Schwedens. Ihr Ziel: Eine geschlechtsneutrale Erziehung. [...] Jedes Kind
soll sich so entwickeln, wie es möchte, und sich nicht durch geschlechtsspezifische
Stereotypisierungen in der Erziehung und die Erwartungen der Gesellschaft in eine
bestimmte Rolle gedrängt fühlen.“ (Zeit Online GmbH (Hrsg.)).
Das Konzept führte zu einem ausgedehnten Diskurs über die Möglichkeiten einer
geschlechtsneutralen Erziehung, stieß jedoch ebenso auf große Ablehnung. Es stellt
sich die Frage, ob und in welchem Umfang Kindern eine Geschlechtsidentität
aufgezeigt werden soll. Dazu ist es interessant, einen Blick in die Schulen zu werfen
und zu untersuchen, wie dort mit Geschlecht umgegangen wird. Dabei ist vor allem
das Konzept des Doing Gender von besonderer Bedeutung und in vielerlei Hinsicht
einer genaueren Forschung wert.
Die zwei in dieser Arbeit dargestellten empirischen Studien behandeln genau dieses
Konzept des Doing Gender und untersuchen, wie und ich welchem Ausmaß das
Geschlecht in der Schule sozial konstruiert wird. Dazu dienen die Vorstellung von
Doing Gender und dessen Bedeutung in der Jugend sowie eine kurze historische
Rekonstruktion von Gleichstellung in der Bildung als Überblick, bevor im Hauptteil
auf die Studien mit ausgewählten Beispielen eingegangen wird. Nach einem
Vergleich der unterschiedlichen Forschungsarbeiten wird ein bündiges Fazit
gezogen.
Inhaltsangabe
1. Einleitung und Fragestellung
2. Das Konzept des Doing Gender
und dessen Bedeutung in der Jugend
3. Historische Betrachtung von Gleichstellung in der Bildung
4. Doing Gender in der Schule
4.1 Geschlechteralltag in der Schulklasse (Breidenstein/Kelle)
4.1.1 Die Studie und ihre Rahmenbedingungen
4.1.2 „Mädchen“ und „Jungen“ - die Bedeutung
der Zweigeschlechtlichkeit
4.1.3 Geschlechterdifferenzierende Inszenierungen
4.2 Geschlechtergerechtigkeit in der Schule (Budde/Schuland/Faulstich-Wieland)
4.2.1 Vorstellung der Studie
4.2.2 Der Sportunterricht als Differenzierungspraktik
4.2.3 Mögliche Unterschiede in der Bewertung von Leistungsnachweisen
4.3 Vergleich der Studien
5. Fazit und Schlussbemerkung
6. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept "Doing Gender"?
Es beschreibt die Vorstellung, dass Geschlecht keine angeborene Eigenschaft ist, sondern durch alltägliches Handeln und soziale Interaktion ständig neu konstruiert wird.
Wie wird Geschlecht in der Schule konstruiert?
Durch differenzierende Praktiken im Unterricht (z.B. Sportunterricht), die Bewertung von Leistungen und die Interaktion zwischen Lehrkräften und Schülern.
Was ist das Ziel einer geschlechtsneutralen Erziehung?
Kinder sollen sich frei von stereotypen Rollenerwartungen entwickeln können, wie es etwa das schwedische Vorschulkonzept "Egalia" anstrebt.
Gibt es Unterschiede bei der Bewertung von Jungen und Mädchen?
Empirische Studien untersuchen, ob Lehrkräfte unbewusst unterschiedliche Maßstäbe anlegen, was die Leistungsbewertung und das Sozialverhalten betrifft.
Welche Rolle spielt der Sportunterricht beim "Doing Gender"?
Sportunterricht gilt oft als klassische "Differenzierungspraktik", in der körperliche Unterschiede und geschlechtsspezifische Zuschreibungen besonders deutlich inszeniert werden.
- Arbeit zitieren
- Michael Mühlbauer (Autor:in), 2012, Doing Gender in der Schule. Die soziale Konstruktion von Geschlecht in der Schule anhand zweier Studien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/210432