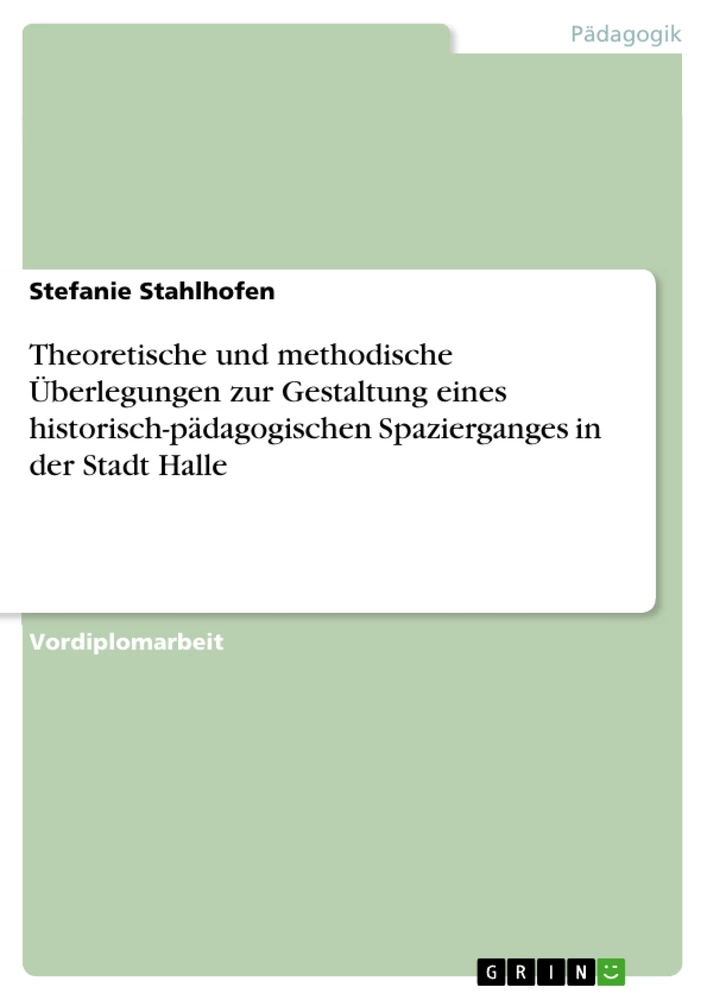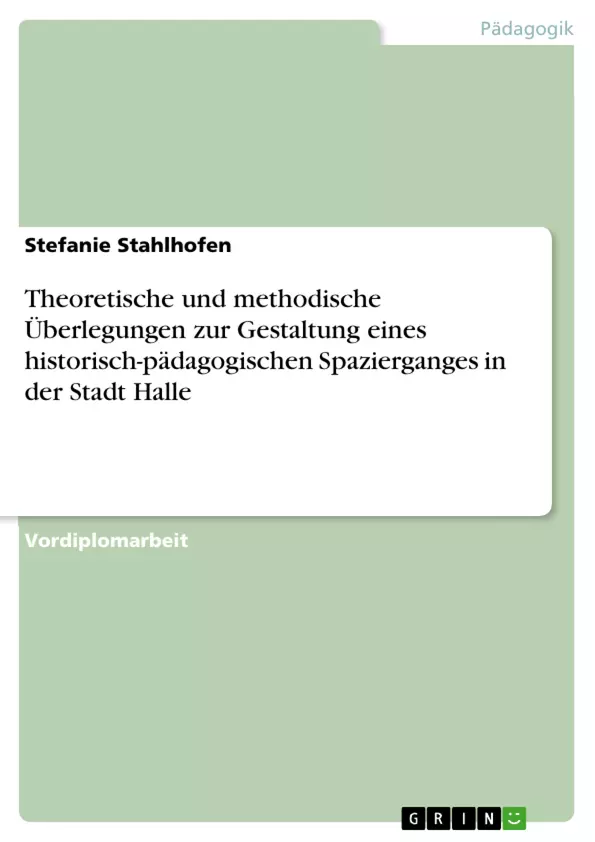[...] Die Arbeit ist so aufgebaut, dass sie deduktiv, vom Allgemeinen ins Besondere, führt.
Zur Grundlegung beginnt die Arbeit mit dem Kontext und den theoretischen
Dimensionen. Die erste Dimension bilden dabei Kultur und Pädagogik. Von der
Reichweite dieser Begriffe, ihren Zusammenhängen, über die Bedeutung kultureller
Bildung gelange ich zu den Aufgaben der Kulturpädagogik und einem speziellen
Arbeitsbereich von ihr. Die nächste Dimension beschreibt traditionelles Lernen an der
Universität und begründet anhand von erfahrungsorientierten Konzepten die
Notwendigkeit, auch andere lernfreundlichere Lehrformen einzuführen. Als dritte und
letzte theoretische Dimension dienen Geschichte und Gegenwart. Welche Bedeutung
Geschichte für unser Leben und unsere Zukunft allgemein besitzt und darauf folgend,
was ein Erziehungswissenschafts-Student von der Geschichte seiner Disziplin hat, ist
Inhalt dieses Punktes.
Aus diesem theoretischen Rahmen heraus folgt die Idee des historisch-pädagogischen
Spazierganges, ein Vorhaben, dass alle zuvor beschriebenen Dimensionen in sich
vereint. Die Besonderheiten der Projektarbeit, Organisation und Adressaten dieses
studentischen Projekts werden im ersten Teil erläutert. Es folgt eine Zusammenstellung
denkbarer und bisher genutzter Stätten aus Halles Bildungshistorie, welche Teil des
Spazierganges sein sollen und schließlich wird erklärt, was wir mit dem Rundgang
erreichen wollen und wie man das überprüfen könnte.
Im letzten Teil dieser Arbeit geht es um die Umsetzung des Projekts. Mithilfe
methodischer und didaktischer Überlegungen soll verdeutlicht werden, wie wir unsere
Ziele erreichen wollen. Vom sehr allgemeinen theoretischen Rahmen am Anfang geht
es jetzt bis zu speziellen Vorstellungen unserer Vorgehensweise, die zuletzt an
Beispielen deutlich gemacht wird.
Während ich theoretische Konzepte und Definitionen mithilfe von passender
wissenschaftlicher Literatur erarbeite, ist es mein Ziel, die Anwendung dieser
Grundlagen auf das Spezielle, also auf den historisch-pädagogischen Spaziergang,
selbstständig zu formulieren.
Ich hoffe, das gesamte Projekt mit dieser Arbeit bereichern zu können. Deshalb soll
nicht nur erwähnt werden, was bereits passiert, sondern auch, welche Innovationen
denkbar sind, um unseren Ziele näher zu kommen.
Gliederung
1. Einleitung
2. Grundlagen: Kontext und theoretische Dimensionen
2.1 Kultur und Pädagogik
2.2 Erfahrungsorientiertes versus traditionelles Lernen
2.3 Geschichte und Gegenwart
3. Die Idee: ein historisch-pädagogischer Spaziergang in der Stadt Halle
3.1 Dimensionen eines studentischen Projekts
3.2 Stationen des Spazierganges
3.3 Funktion und Intention des Spazierganges
4. Die Umsetzung: Methodische und didaktische Überlegungen
4.1 Vorgehensweise
4.2 Partizipation
4.3 Umsetzung am Beispiel zweier Stationen
4.3.1 Niemeyer-Haus / Riesenhaus
4.3.2 Universitätsplatz
5. Schluss
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein historisch-pädagogischer Spaziergang?
Es handelt sich um ein erfahrungsorientiertes Lernkonzept, bei dem bildungshistorische Stätten besucht werden, um Geschichte und Gegenwart der Pädagogik vor Ort zu verknüpfen.
Welche Stationen in Halle sind Teil des Spaziergangs?
Wichtige Stationen sind unter anderem das Niemeyer-Haus (Riesenhaus) und der Universitätsplatz, die zentrale Rollen in Halles Bildungshistorie spielen.
Warum ist erfahrungsorientiertes Lernen wichtig?
Es dient als Ergänzung zum traditionellen Lernen an der Universität und fördert durch die direkte Begegnung mit historischen Orten ein tieferes Verständnis für die Disziplin.
An wen richtet sich dieses Projekt?
Das Projekt ist primär für Erziehungswissenschafts-Studenten konzipiert, um ihnen die Geschichte ihrer eigenen Fachrichtung greifbar zu machen.
Welche Aufgaben hat die Kulturpädagogik hierbei?
Die Kulturpädagogik vermittelt zwischen kulturellen Inhalten und pädagogischen Zielen, um kulturelle Bildung durch Partizipation und Erleben zu ermöglichen.
- Quote paper
- Stefanie Stahlhofen (Author), 2007, Theoretische und methodische Überlegungen zur Gestaltung eines historisch-pädagogischen Spazierganges in der Stadt Halle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211230