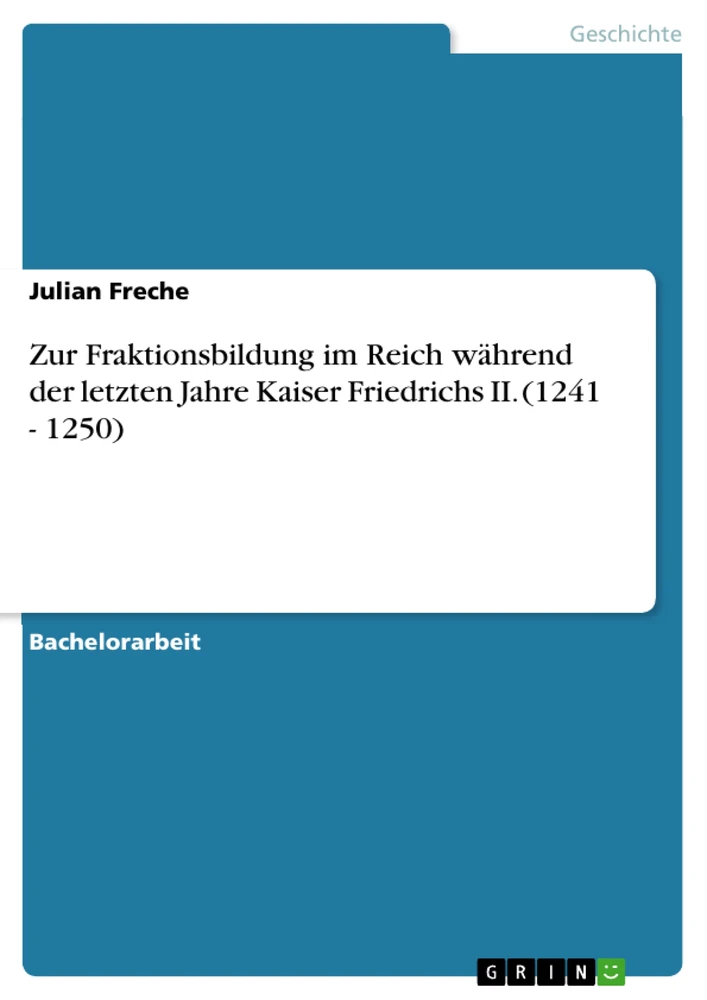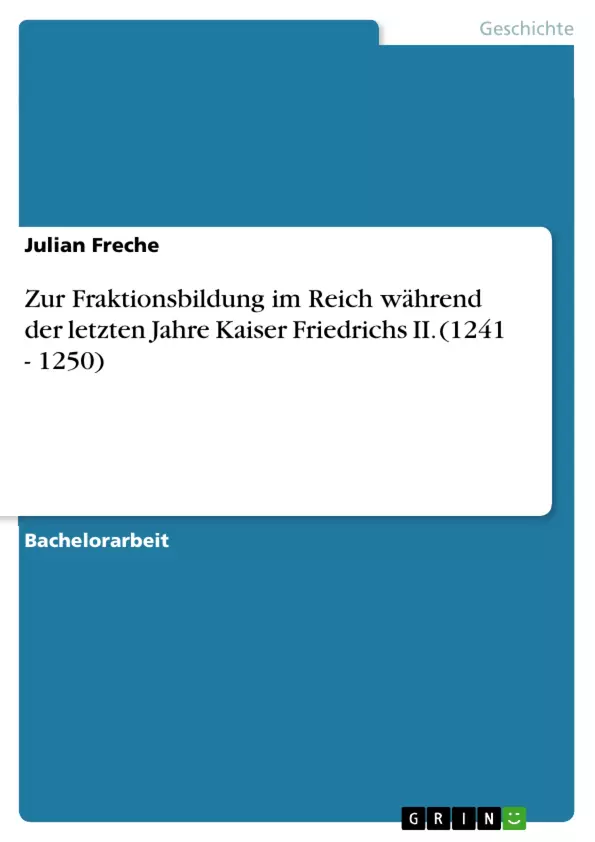Der Konflikt zwischen Kaiser und Papst bestimmte große Teile der Regierungszeit von Kaiser Friedrich II., vor allem der Streit mit Papst Gregor IX. Dieser hatte den Kaiser 1227 exkommuniziert weil Friedrich ein Kreuzzugsversprechen nicht eingehalten hatte. Zwar wurde der Streit mit dem Frieden von San Germano vorerst beigelegt, aber er schwelte auch während der 1230er Jahre weiter. Grund für den Konflikt war vor allem die Italienpolitik des Kaisers, welche den Einflussbereich des Papstes gefährdete. Obwohl Friedrich zeitweise dem Kirchenbann unterlag, hielten die meisten Fürsten des Heiligen Römischen Reiches weiter zu ihm. So konnte er den staufisch-welfischen Gegensatz beenden, indem er das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg schuf und den Welfen Otto das Kind damit belehnte. Als der Kaiser allerdings im Jahr 1239 zum zweiten Mal exkommuniziert wurde, begannen sich viele Fürsten von Friedrich zu distanzieren.
In dieser Arbeit soll der Fokus auf dem Zeitraum von 1241, Tod des Papstes Gregor, bis 1250, Tod von Kaiser Friedrich II., liegen. Anhand von einigen Beispielen soll aufgezeigt werden, warum sich bestimmte Fürsten einer der beiden Fraktionen anschlossen, welche Ziele sie dabei verfolgten und letztlich auch, welche Auswirkungen dies auf das Reich hatte. Die Auswirkungen sind vor allem deshalb von Interesse, weil das Reich in diesem kurzen Zeitraum einen erheblichen Wandel durchlebte und das Königtum nach dem Ende der staufischen Herrschaft an Einfluss verloren hatte. Als Beispiele dienen neben den drei rheinischen Erzbistümern Köln, Mainz und Trier auch zwei weltliche Fürsten. Die Erzbischöfe in dieser Zeit waren Konrad I. in Köln, Siegfried III. in Mainz und Dietrich II., bzw. Arnold II. in Trier, die hier betrachteten weltlichen Fürsten sind Landgraf Heinrich Raspe aus Thüringen und der bayerische Herzog Otto II., der auch Pfalzgraf bei Rhein war. Außerdem soll am Beispiel der Stadt Regensburg aufgezeigt werden, dass auch Städte von der Spaltung in Papsttreue und Kaisertreue betroffen waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Fraktion
- Die Entwicklung von Fraktionen
- Allgemeine Strukturen von Fraktionen
- Geistliche Reichsfürsten im Streit zwischen Kaiser und Papst – die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier
- Die Ambitionen des Erzbischofs von Mainz
- Wechsel auf die Seite des Papstes
- Konrad I. von Hochstaden
- Wahl zum Bischof und Annäherung an Siegfried III.
- Opposition gegen die Staufer und die niederrheinischen Fürsten
- Der Fraktionswechsel des Erzbistums Trier
- Erzbischof Dietrich II. und seine Nachfolge
- Die Sicherung und Erweiterung des Erzbistums Trier unter Arnold II.
- Weltliche Reichsfürsten im Zwiespalt zwischen Kirche und Reich - Heinrich Raspe und Otto von Bayern
- Heinrich Raspe - Einer der mächtigsten Fürsten des Reiches
- Herrschaftsantritt und mehrfache Fraktionswechsel
- Die Königswahl von 1246
- Die Königsherrschaft Heinrich Raspes
- Otto von Bayern
- Herrschaftsantritt und Konflikte mit den Staufern
- Wechsel von der päpstlichen in die kaiserliche Fraktion
- Kampf auf der Seite der Staufer
- Regensburg im Spannungsfeld zwischen Landesherren und Kaiser
- Die Erhebung Regensburgs zur Freien Reichsstadt
- Verteidigung der Unabhängigkeit und Frieden mit dem Bischof
- Die Auswirkungen der Fraktionsbildung auf die Fürsten und das Reich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Fraktionsbildung im Heiligen Römischen Reich während der letzten Jahre Kaiser Friedrichs II. (1241-1250). Sie analysiert, warum sich bestimmte Fürsten einer der beiden Fraktionen anschlossen, welche Ziele sie dabei verfolgten und welche Auswirkungen dies auf das Reich hatte. Die Arbeit beleuchtet insbesondere den Wandel, den das Reich in dieser Zeit durchlebte, und den Verlust an Einfluss des Königtums nach dem Ende der staufischen Herrschaft.
- Die Entstehung und Entwicklung von Fraktionen im Hoch- und Spätmittelalter
- Die politischen und religiösen Motive der Fürsten bei der Wahl ihrer Fraktion
- Die Auswirkungen der Fraktionsbildung auf die Machtverhältnisse im Reich
- Die Rolle der Städte im Spannungsfeld zwischen Papst und Kaiser
- Der Wandel des Königtums nach dem Ende der staufischen Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Konflikt zwischen Kaiser Friedrich II. und Papst Gregor IX. und die Entstehung der beiden Fraktionen, die sich dem Papst oder dem Kaiser anschlossen. Kapitel 2 beleuchtet den Begriff Fraktion, seine Entstehung im Mittelalter und die verschiedenen Faktoren, die zur Bildung von Fraktionen führten. Kapitel 3 analysiert die Positionen der drei rheinischen Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier im Streit zwischen Kaiser und Papst. Die Kapitel 4 fokussieren sich auf zwei weltliche Fürsten, Heinrich Raspe und Otto von Bayern, und deren Wechsel zwischen den beiden Fraktionen. Kapitel 5 stellt die Stadt Regensburg vor und ihre Position im Spannungsfeld zwischen Landesherren und Kaiser. Schließlich beleuchtet Kapitel 6 die Auswirkungen der Fraktionsbildung auf die Fürsten und das Reich.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Fraktionsbildung im Heiligen Römischen Reich im 13. Jahrhundert. Sie behandelt die politischen und religiösen Konflikte zwischen Kaiser Friedrich II. und Papst Gregor IX., die zur Spaltung des Reiches führten. Wichtige Themen sind die Rolle der weltlichen und geistlichen Fürsten im Streit zwischen Kaiser und Papst, die politische und gesellschaftliche Bedeutung der Fraktionen sowie die Auswirkungen der Fraktionsbildung auf das Reich und das Königtum. Schlüsselbegriffe sind daher: Fraktionen, Kaiser Friedrich II., Papst Gregor IX., geistliche Reichsfürsten, weltliche Reichsfürsten, Reich, Königtum, Machtverhältnisse, politische und religiöse Konflikte.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Ursache für den Konflikt zwischen Kaiser Friedrich II. und dem Papst?
Hauptgründe waren die Italienpolitik des Kaisers, die den Einfluss des Papstes gefährdete, sowie ein nicht eingehaltenes Kreuzzugsversprechen, das 1227 zur ersten Exkommunikation führte.
Welche Rolle spielten die rheinischen Erzbischöfe in diesem Streit?
Die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier waren zentrale geistliche Reichsfürsten, die zwischen Kaisertreue und päpstlicher Opposition schwankten, oft um ihre eigenen territorialen Machtbereiche zu sichern.
Wer war Heinrich Raspe und welche Bedeutung hatte er?
Heinrich Raspe war ein mächtiger Landgraf aus Thüringen, der mehrfach die Fraktion wechselte und 1246 als Gegenkönig zu Friedrich II. gewählt wurde, was die Spaltung des Reiches vertiefte.
Wie verhielt sich Bayern unter Herzog Otto II. im Konflikt?
Otto II. von Bayern wechselte von der päpstlichen Seite zurück zur kaiserlichen Fraktion und kämpfte schließlich als einer der wichtigsten Verbündeten auf der Seite der Staufer.
War die Stadt Regensburg ebenfalls vom Konflikt betroffen?
Ja, Regensburg stand im Spannungsfeld zwischen dem Kaiser und den lokalen Landesherren (Bischof). Die Stadt nutzte die Situation, um ihre Unabhängigkeit als Freie Reichsstadt zu verteidigen.
Welche langfristigen Auswirkungen hatte die Fraktionsbildung auf das Reich?
Die ständigen Fraktionswechsel und Kämpfe führten zu einem erheblichen Machtverlust des Königtums nach dem Ende der staufischen Herrschaft und stärkten die Position der Landesfürsten.
- Citar trabajo
- Julian Freche (Autor), 2010, Zur Fraktionsbildung im Reich während der letzten Jahre Kaiser Friedrichs II. (1241 - 1250), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211253