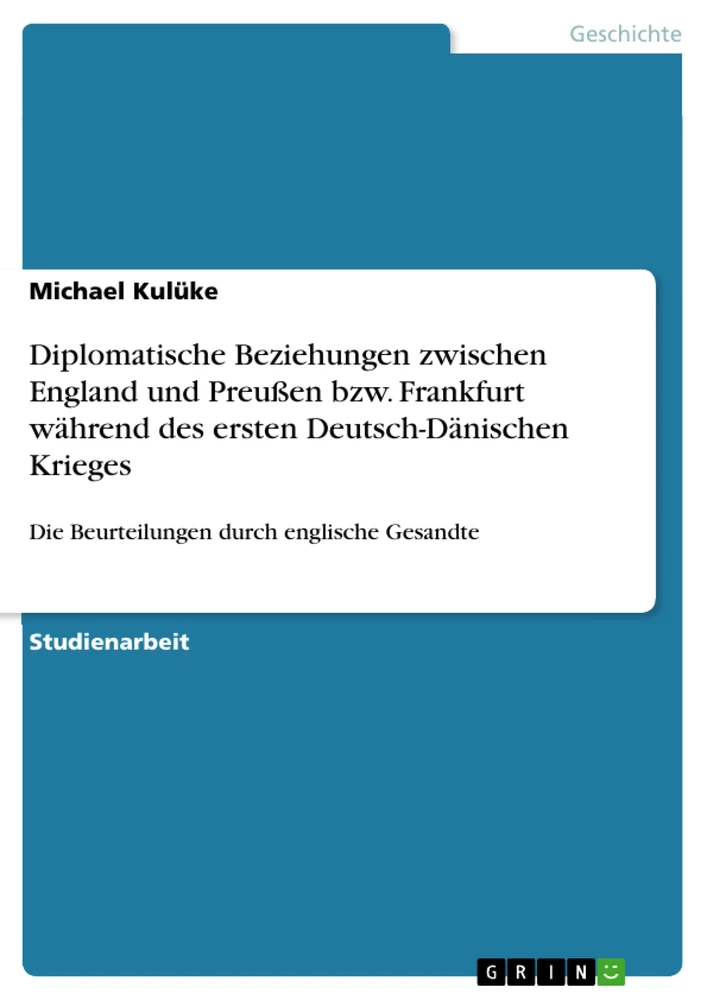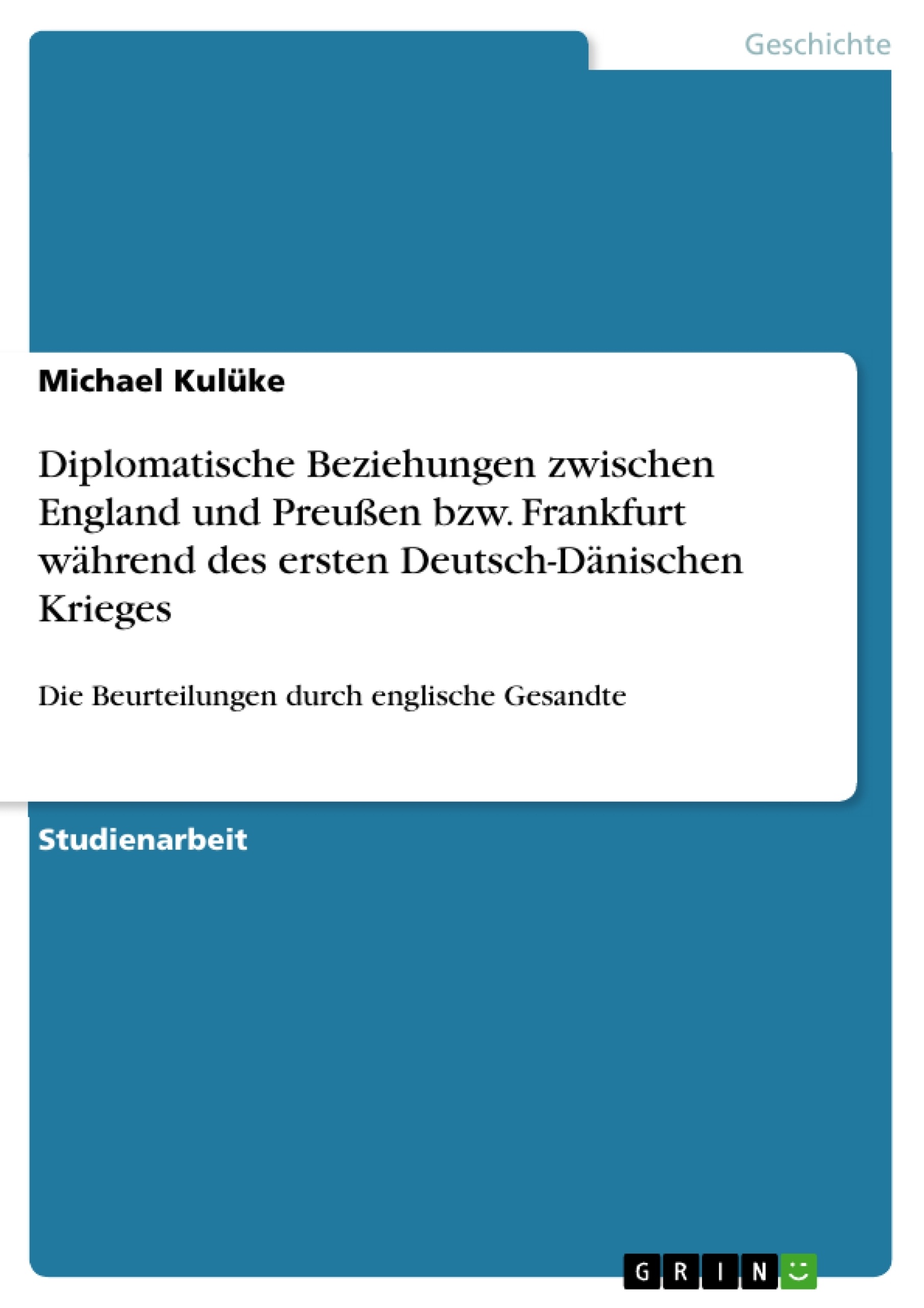Die Krise um die Herzogtümer Schleswig und Holstein stellte die erste außenpolitische Herausforderung größeren Ausmaßes für die Frankfurter Nationalversammlung und den Deutschen Bund dar, und sollte sich im Laufe der Jahre zu einem der Kernkonflikte entwickeln, die zur Gründung des Deutschen Reichs führen sollten.
Die klassisch-aristokratisch orientierten Erbfolgestreitigkeiten, die in der Vergangenheit weniger Aufsehen erregt hätten, entwickelten unter dem Druck nationalistischer und liberaler Strömungen in Europa eine Dynamik die wohl selbst die erfahrensten Machthaber überrascht haben dürfte.
Die Verstrickungen zwischen hegemonialem Interesse an den Herzogtümern, nationalistischen Ideologien und Reichsbildungstendenzen führten symbolisch für die gesamten Revolutions- und Reformationsbewegungen in Europa zu einem Konflikt europäischer Mächte, die sich ansonsten eher durch politisches Wohlwollen als durch unbedingte Konkurrenzhaltung ausgezeichnet hatten.
Der Hilferuf des Königreichs Dänemark an imperiale Großmächte wie England, Russland oder Frankreich, sorgte dafür dass der Konflikt, bei dem es auf der aristokratischen Seite vor allem um Territoriumsfestigung ging, auf der anderen um die Bildung eines Nationalstaats-ähnlichen Gebildes unter Berücksichtigung der Volksverteilung, zu einer ernst zunehmenden internationalen Krise auswuchs, welche schließlich militärische Züge trug, und in die Geschichtsbücher als 'erster dänisch-deutscher Krieg' einging.
Die Betrachtung dieser Thematik und der damaligen Problematik bietet ein unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten, und es fällt schwer sich auf etwas festzulegen, da die Umstände und Einflüsse stark miteinander verwoben sind, und es scheint fast untrennbar.
Dennoch möchte ich mit dieser Arbeit den Versuch unternehmen, etwas Licht in die Problematik der damaligen diplomatischen Beziehungen zwischen England und dem Königreich Preußen, respektive der deutschen Nationalversammlung in Frankfurt, während dieser Krise bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Der erste dänisch-deutsche Krieg
- Die Untrennbarkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein
- Vorzeichen des Konflikts
- Ausbruch des Konflikts
- Der Krieg
- Diplomatische Bemühungen und Ende des Krieges
- England und der Deutsche Bund
- Englische Außenpolitik im 19. Jahrhundert
- Das System des Diplomatic Service
- Die Briten im deutsch-dänischen Konflikt 1848
- Die Quellen
- Englische Gesandte in Berlin und Frankfurt
- Analyse
- Schlussfolgerung
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die diplomatischen Beziehungen zwischen England und dem Königreich Preußen bzw. der Frankfurter Nationalversammlung während des Ersten Dänisch-Deutschen Krieges (1848-1851). Der Fokus liegt auf der Rolle Englands im Konflikt und den komplexen Verflechtungen zwischen Erbstreitigkeiten, nationalistischen Bestrebungen und der Reichsgründung.
- Die Untrennbarkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein und die daraus resultierenden Erbstreitigkeiten.
- Der Einfluss nationalistischer und liberaler Strömungen auf den Konflikt.
- Die Rolle Großbritanniens als europäische Großmacht und seine außenpolitischen Ziele.
- Die militärischen Auseinandersetzungen und deren Verlauf.
- Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges.
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort erläutert die Bedeutung des Deutsch-Dänischen Krieges von 1848-1851 als ersten großen außenpolitischen Konflikt für die Frankfurter Nationalversammlung und den Deutschen Bund. Es hebt die besondere Dynamik hervor, die aus dem Zusammentreffen klassisch-aristokratischer Erbfolgestreitigkeiten mit nationalistischen und liberalen Strömungen resultierte. Der Konflikt wird als ein vielschichtiges Ereignis dargestellt, das die Verflechtung von hegemonialen Interessen, nationalistischen Ideologien und Bestrebungen zur Reichsgründung symbolisiert. Der Hilferuf Dänemarks an Großmächte wie England führte zu einer internationalen Krise mit militärischen Folgen.
Der erste dänisch-deutsche Krieg: Dieses Kapitel beschreibt den Verlauf des Krieges, beginnend mit der historischen Problematik der Untrennbarkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein und den daraus resultierenden Erbstreitigkeiten. Es analysiert die Vorzeichen des Konflikts, die mit dem drohenden Aussterben der männlichen Linie des dänischen Königshauses und der damit verbundenen Nachfolgeregelung in Verbindung stehen. Der Ausbruch des Konflikts wird im Kontext der Februarrevolution und der Märzbewegung dargestellt, wobei die unterschiedlichen Positionen der Bevölkerung und der politischen Akteure beleuchtet werden. Der militärische Verlauf des Krieges und die schließlich durch diplomatische Bemühungen erreichte Beendigung des Konflikts werden ausführlich beschrieben. Das Kapitel beleuchtet die Rolle der nationalen und internationalen Akteure und ihre jeweiligen Interessen.
England und der Deutsche Bund: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle Englands im Konflikt. Es analysiert die britische Außenpolitik des 19. Jahrhunderts und das Funktionieren des britischen diplomatischen Dienstes. Die Arbeit beleuchtet, wie die britischen Gesandten in Berlin und Frankfurt die Ereignisse bewerteten und wie die britische Politik versuchte, den Konflikt zu beeinflussen. Das Kapitel analysiert die Motive und Interessen der englischen Politik im Kontext des europäischen Machtgleichgewichts und der deutschen Einigungsprozesse.
Schlüsselwörter
Erster Dänisch-Deutscher Krieg, Schleswig-Holstein, Nationalismus, Liberalismus, Frankfurter Nationalversammlung, Deutscher Bund, England, Diplomatie, Erbstreitigkeiten, Großmächte, Außenpolitik, Reichsgründung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Ersten Dänisch-Deutschen Krieg
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die diplomatischen Beziehungen zwischen England und dem Königreich Preußen bzw. der Frankfurter Nationalversammlung während des Ersten Dänisch-Deutschen Krieges (1848-1851). Der Fokus liegt auf der Rolle Englands im Konflikt und den komplexen Verflechtungen zwischen Erbstreitigkeiten, nationalistischen Bestrebungen und der Reichsgründung. Die Arbeit enthält ein Vorwort, Kapitel zum Krieg selbst, zur Rolle Englands und des Deutschen Bundes, eine Analyse der Quellen und eine Bibliographie.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Untrennbarkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein und die daraus resultierenden Erbstreitigkeiten, den Einfluss nationalistischer und liberaler Strömungen, die Rolle Großbritanniens als europäische Großmacht und seine außenpolitischen Ziele, die militärischen Auseinandersetzungen und deren Verlauf sowie die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist strukturiert in Kapitel zu: Vorwort, dem Ersten Dänisch-Deutschen Krieg (inkl. Untrennbarkeit Schleswig-Holsteins, Vorzeichen, Ausbruch, Verlauf und Ende des Krieges), England und dem Deutschen Bund (inkl. englischer Außenpolitik und des diplomatischen Dienstes), den Quellen (inkl. Analyse und Schlussfolgerung) und einer Bibliographie. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Rolle spielte England im Ersten Dänisch-Deutschen Krieg?
Die Arbeit untersucht die Rolle Englands als europäische Großmacht und analysiert die britische Außenpolitik des 19. Jahrhunderts und den britischen diplomatischen Dienst. Es wird beleuchtet, wie die britischen Gesandten die Ereignisse bewerteten und wie die britische Politik versuchte, den Konflikt zu beeinflussen, unter Berücksichtigung des europäischen Machtgleichgewichts und der deutschen Einigungsprozesse.
Was waren die Hauptursachen des Ersten Dänisch-Deutschen Krieges?
Die Hauptursachen waren die Untrennbarkeit der Herzogtümer Schleswig und Holstein und die daraus resultierenden Erbstreitigkeiten, verschärft durch nationalistische und liberale Strömungen im Kontext der Februarrevolution und der Märzbewegung. Der drohende Aussterben der männlichen Linie des dänischen Königshauses und die damit verbundene Nachfolgeregelung spielten ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Berichte englischer Gesandter in Berlin und Frankfurt. Eine detaillierte Bibliographie listet die verwendeten Quellen auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erster Dänisch-Deutscher Krieg, Schleswig-Holstein, Nationalismus, Liberalismus, Frankfurter Nationalversammlung, Deutscher Bund, England, Diplomatie, Erbstreitigkeiten, Großmächte, Außenpolitik, Reichsgründung.
- Citar trabajo
- Michael Kulüke (Autor), 2008, Diplomatische Beziehungen zwischen England und Preußen bzw. Frankfurt während des ersten Deutsch-Dänischen Krieges, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211315