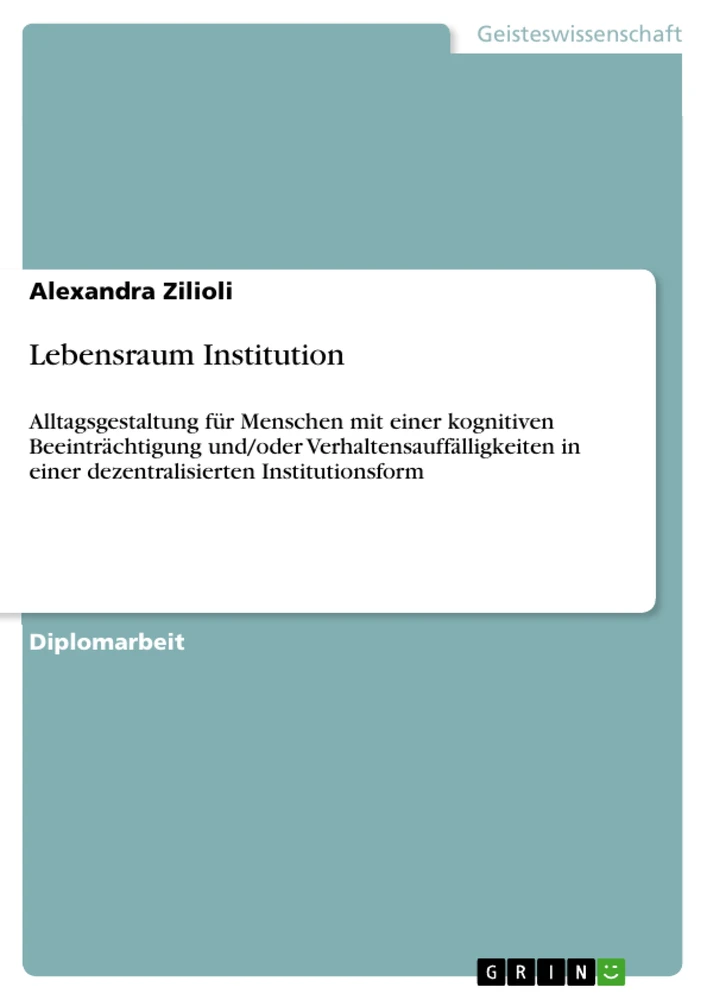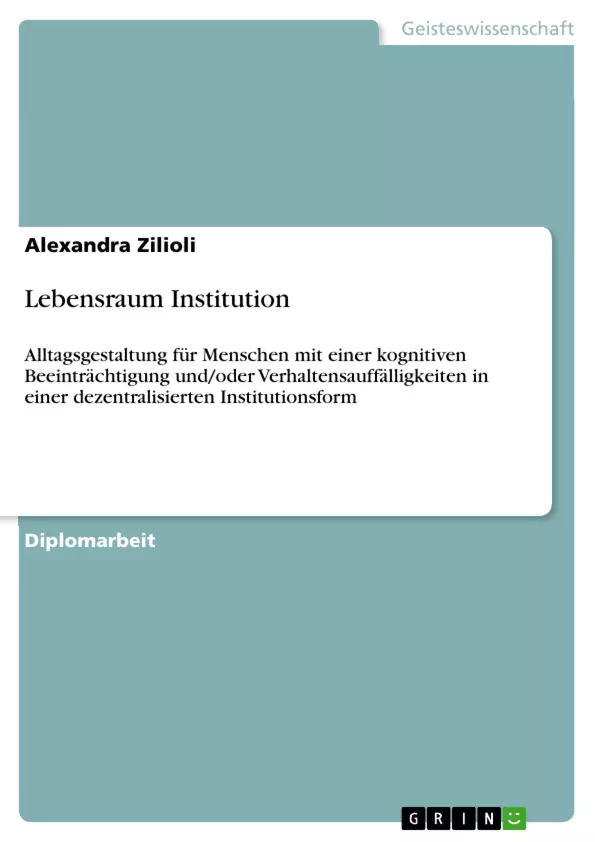Für eine Zeitgemässe Wohnform für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung gibt es nicht eine richtige Art, es gibt Varianten, welche auf die Individuellen Bedürfnisse des Bewohnenden zu geschnitten sein sollten.
In dieser Arbeit stelle ich eine Art von vielen vor, welche ich persönliche positive Erfahrungen gemacht habe, besondern bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, welche starke Verhaltensauffälligkeiten zeigen.
Diese Wohnform ist angelehnt an das Normalisierungsprinzip von Nirjie und der Inklusionstheorie von Theunissen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Motivation und Begründung der Themenwahl
- 1.2 Eingrenzung des Themas und Begründung der Eingrenzung
- 1.3 Ziel und Begründung
- 1.4 Aufbau der Arbeit
- 1.5 Deklaration bezüglich des Umgangs mit der beruflichen Schweigepflicht
- 1.6 Geschlechtergerechte Sprache
- 2. Die dezentrale Institutionsform
- 2.1 Definition „Institution“
- 2.2 Institutionelle Geschichte
- 2.3 Deinstitutionalisierung
- 2.4 Leitbild
- 2.5 Organisationsprinzipien
- 2.6 Konzeption einer dezentralen Wohnform
- 3. Begriffsverständnisse „Geistige Behinderung“ und „Verhaltensauffälligkeiten“
- 3.1 Begriff „Geistige Behinderung“
- 3.2 Begriff „Verhaltensauffälligkeiten“
- 3.3 Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten
- 4. Lebensraum: Wohnen, Freizeit und Arbeit
- 4.1 Meine Definition von Lebensqualität
- 4.2 Bedingungen einer Institution, um Lebensqualität zu ermöglichen
- 4.3 Normalisierungsprinzip und die Umsetzung im sozialpädagogischen Alltag
- 4.4 Inklusion unter dem Schwerpunkt Wohnen
- 4.5 Teilhabe (Partizipation) und sinnstiftende Arbeit
- 4.6 „Freizeit ist Freiheit“
- 5. Klientenerfassungssystem „Individueller BetreuungsBedarf“ (IBB)
- 5.1 Vernetzung vom IBB und die Auswirkungen auf den Betreuungsalltag
- 5.2 Privatheit durch Verlaufsdokumentation möglich?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Alltagsgestaltung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten in einer dezentralisierten Institutionsform. Das Hauptziel besteht darin, die Rahmenbedingungen einer solchen Institution und die Möglichkeiten verschiedener Wohnformen zu analysieren und zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf die Lebensqualität der Bewohner. Die Arbeit befasst sich mit dem Normalisierungsprinzip und dessen Umsetzung im sozialpädagogischen Alltag, sowie der Bedeutung von Inklusion und Teilhabe.
- Lebensqualität von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten
- Normalisierungsprinzip in dezentralisierten Wohnformen
- Inklusion und Teilhabe im Kontext von Wohn- und Betreuungsangeboten
- Das Klientenerfassungssystem „Individueller BetreuungsBedarf“ (IBB)
- Die Rolle der Institution und des Betreuungspersonals
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, die sich aus ihrer sechsjährigen Erfahrung in der Betreuung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten speist. Sie hebt die positiven Auswirkungen individueller Rahmenbedingungen und kleiner Wohneinheiten auf die Fortschritte der Bewohner hervor. Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung der Rahmenbedingungen einer Institution und die Möglichkeiten von Wohnformen, um die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern. Die Autorin stellt ihre persönliche Grundhaltung dar und benennt zentrale Forschungsfragen.
2. Die dezentrale Institutionsform: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Institution“ und beleuchtet die institutionelle Geschichte der Trägerschaft, in der die Autorin arbeitet. Es behandelt die Deinstitutionalisierung und beschreibt das Leitbild sowie die Organisationsprinzipien der dezentralen Wohnform. Die Konzeption einer dezentralen Wohnform wird vorgestellt und analysiert, mit einem Fokus auf den Ansatz der „Großfamilie“ und der Herausforderungen der Finanzierung.
3. Begriffsverständnisse „Geistige Behinderung“ und „Verhaltensauffälligkeiten“: Dieses Kapitel befasst sich mit den Begriffen „Geistige Behinderung“ und „Verhaltensauffälligkeiten“, bietet Definitionen und analysiert verschiedene Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten. Es legt die Grundlage für das Verständnis der komplexen Bedürfnisse der Bewohner und die Notwendigkeit individueller Betreuung.
4. Lebensraum: Wohnen, Freizeit und Arbeit: Der vierte Kapitel befasst sich eingehend mit dem Lebensraum der Bewohner, inklusive Wohnen, Freizeit und Arbeit. Es definiert die Autorin's Verständnis von Lebensqualität und analysiert die notwendigen Bedingungen einer Institution, um diese zu ermöglichen. Das Normalisierungsprinzip wird im Detail betrachtet, ebenso wie Inklusion, Teilhabe und die Bedeutung sinnstiftender Arbeit und Freizeitgestaltung.
5. Klientenerfassungssystem „Individueller BetreuungsBedarf“ (IBB): Das Kapitel beschreibt das Klientenerfassungssystem IBB und dessen Vernetzung sowie die Auswirkungen auf den Betreuungsalltag. Es werden die Vor- und Nachteile des Systems im Hinblick auf die Lebensqualität der Bewohner sowie Aspekte der Privatsphäre durch Verlaufsdokumentation diskutiert.
Schlüsselwörter
Dezentrale Wohnform, Geistige Behinderung, Verhaltensauffälligkeiten, Lebensqualität, Normalisierungsprinzip, Inklusion, Teilhabe, Partizipation, Individueller BetreuungsBedarf (IBB), Alltagsgestaltung, Institution, Betreuung, Sozialpädagogik.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Alltagsgestaltung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten in einer dezentralisierten Institutionsform
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Alltagsgestaltung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten in einer dezentralisierten Institutionsform. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rahmenbedingungen einer solchen Institution und der Möglichkeiten verschiedener Wohnformen, insbesondere im Hinblick auf die Lebensqualität der Bewohner.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Lebensqualität von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten; Normalisierungsprinzip in dezentralisierten Wohnformen; Inklusion und Teilhabe im Kontext von Wohn- und Betreuungsangeboten; Das Klientenerfassungssystem „Individueller BetreuungsBedarf“ (IBB); Die Rolle der Institution und des Betreuungspersonals.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Motivation, Zielsetzung, Methodik); Die dezentrale Institutionsform (Definition, Geschichte, Organisationsprinzipien); Begriffsverständnisse „Geistige Behinderung“ und „Verhaltensauffälligkeiten“ (Definitionen und Erklärungsansätze); Lebensraum: Wohnen, Freizeit und Arbeit (Lebensqualität, Normalisierungsprinzip, Inklusion, Teilhabe); Klientenerfassungssystem „Individueller BetreuungsBedarf“ (IBB) (Beschreibung, Auswirkungen, Datenschutz).
Was versteht die Autorin unter Lebensqualität?
Die Diplomarbeit definiert die Lebensqualität der Bewohner im Kontext der Wohnform und bezieht Aspekte wie Wohnen, Freizeit und Arbeit mit ein. Sie untersucht die Bedingungen, die eine Institution schaffen muss, um eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten.
Welche Rolle spielt das Normalisierungsprinzip?
Das Normalisierungsprinzip spielt eine zentrale Rolle und wird im Kontext des sozialpädagogischen Alltags in dezentralisierten Wohnformen untersucht. Die Arbeit analysiert die praktische Umsetzung des Prinzips und seine Bedeutung für die Lebensqualität der Bewohner.
Welche Bedeutung hat Inklusion und Teilhabe?
Inklusion und Teilhabe werden als entscheidende Faktoren für die Lebensqualität der Bewohner betrachtet. Die Arbeit untersucht, wie diese Aspekte im Kontext von Wohn- und Betreuungsangeboten umgesetzt werden können.
Was ist das Klientenerfassungssystem IBB und welche Rolle spielt es?
Das Klientenerfassungssystem „Individueller BetreuungsBedarf“ (IBB) wird detailliert beschrieben. Die Arbeit analysiert dessen Vernetzung, Auswirkungen auf den Betreuungsalltag, Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Lebensqualität der Bewohner sowie Aspekte der Privatsphäre durch Verlaufsdokumentation.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit sind im Text nicht explizit als FAQ formuliert. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt jedoch Einblicke in die Ergebnisse der einzelnen Kapitel. Die Arbeit analysiert die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten von Wohnformen, um die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern, unter Berücksichtigung der genannten Themenschwerpunkte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte in der Sozialpädagogik, die mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten arbeiten, sowie für Einrichtungen und Organisationen, die Wohn- und Betreuungsangebote für diese Personengruppe entwickeln und gestalten. Sie kann auch für Wissenschaftler*innen im Bereich der Sozialen Arbeit und Behindertenhilfe von Interesse sein.
- Citar trabajo
- Alexandra Zilioli (Autor), 2013, Lebensraum Institution, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211563