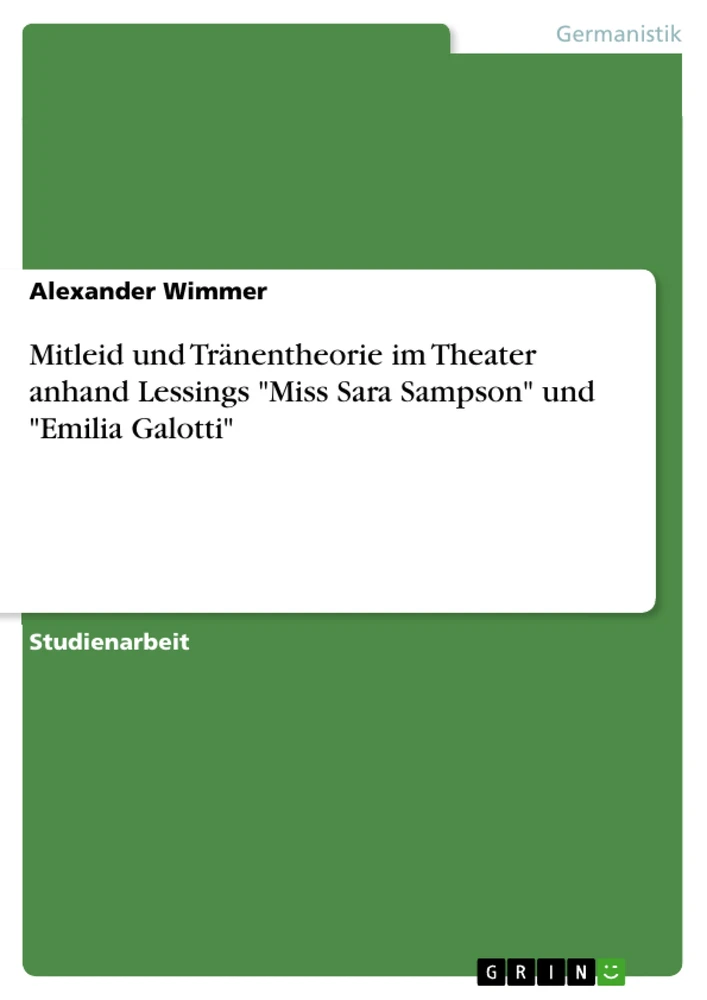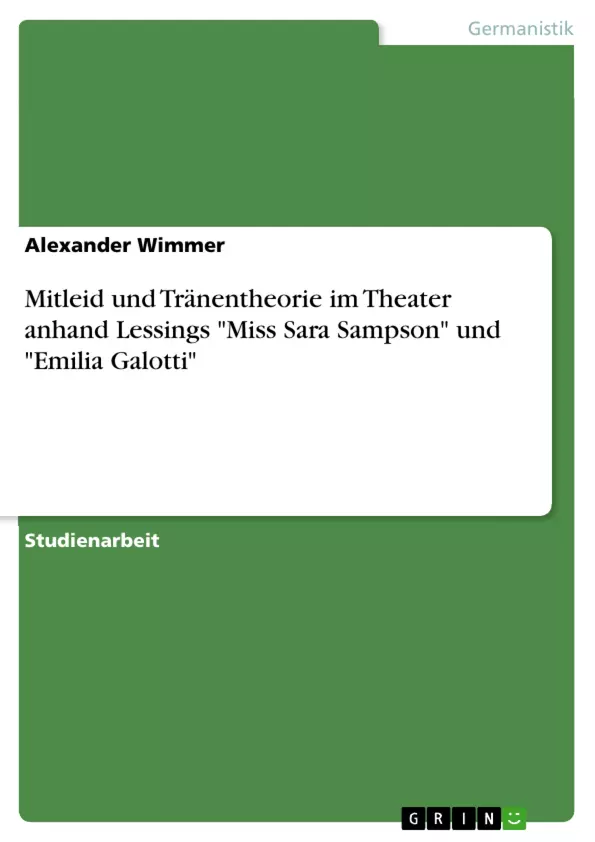Zu allererst werde ich in meiner Arbeit auf Lessing eingehen und seine Mitleidkonzeption näher beschreiben, da diese sehr wichtig für seine Trauerspiele ist und für die Gattung des Dramas insgesamt. (...)
Anschließend werde ich auf die Physiognomik und die Lehre der Körpersäfte eingehen, um den historischen Kontext der Träne näher zu beleuchten und auch welche Bedeutung die Träne in dieser Theorie hat.
Weiters werde ich mich mit einem Punkt beschäftigen, den ich „Allgemeine Tränentheorie“ genannt habe und mich mit der Frage auseinandersetzen, wie man denn beim Publikum Tränen hervorrufen kann und worauf es ankommt, dass der Zuseher zu Tränen gerührt ist. Dieser Punkt bezieht sich auf dramaturgische Aspekte, wie man beim Publikum Mitleid erregt.
Als nächstes werde ich mich Lessings Texten zuwenden, da diese für meine Fragestellungen am interessantesten und am besten geeignet sind. Ich beginne mit „Miss Sara Sampson“ und arbeite einige wichtige Aspekte heraus, die Tränen auf der Bühne erzeugen und welche Wirkung sie auf das Publikum haben. Danach beschäftige ich mich mit „Emilia Galotti“, da sie, obwohl vom selben Autor, doch ganz andere Prioritäten setzt und im Gegensatz zur „Sara“ nicht so viele Emotionen aufkommen lässt.
(...) Ein Vergleich dieser Werke bietet sich aufgrund desselben Autors und der breiten Diskussion der vergangenen Jahrhunderte an, da bereits Lessings Zeitgenossen diese beiden Werke ausführlich miteinander verglichen.
(...)
Eine weitere wichtige Frage ist die, nach den rührenden Elementen des Textes und wie diese eingesetzt werden. Ich werde versuchen herauszuarbeiten welche Handlungen und Gespräche die Dramatik auf der Bühne verstärken und somit das Publikum zu Tränen rühren. So meint Mattenklott hierzu:„ Tränen sind hier als eine Ursprache der Natur zu verstehen, sie sind die unmittelbarste Äußerung der Affekte.“ Es gibt einige Textstellen, an denen sich dieses Zitat beweisen lässt und genau diese versuche ich in meiner Arbeit herauszufiltern.
Die letzte und abschließende Frage, die ich mir zu diesem Thema gestellt habe, ist: Warum war „Emilia Galotti“ nicht so ein großer „Weinerfolg“ wie „Miss Sara Sampson“? Ich werde die beiden Texte eingehend miteinander vergleichen und versuchen herauszuarbeiten warum selbst Herder und Goethe die Emilia als kalkuliert bezeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lessing und das Mitleid
- Die Träne im historischen Kontext
- Allgemeine Tränentheorie
- Miss Sara Sampson
- Emilia Galotti
- Vergleich beider Werke
- Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Lessings Konzept des Mitleids im Kontext seiner Trauerspiele und dessen Rolle für die Erzeugung von Tränen auf der Bühne. Dabei werden die historische Bedeutung der Träne, dramaturgische Aspekte der Mitleidserregung und die Unterschiede in Lessings Werken "Miss Sara Sampson" und "Emilia Galotti" beleuchtet.
- Lessings Mitleidskonzeption und ihre Bedeutung für seine Trauerspiele
- Der historische Kontext der Träne im 18. Jahrhundert
- Dramaturgische Strategien zur Erzeugung von Tränen beim Publikum
- Analyse der Unterschiede in "Miss Sara Sampson" und "Emilia Galotti"
- Vergleich der beiden Werke hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Mitleid und Tränen zu erzeugen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Thema der Arbeit ein: „Einübung in das Mitleid: Tränen auf der Bühne“. Sie erläutert, dass die Arbeit Lessings Mitleidskonzeption, den historischen Kontext der Träne und dramaturgische Aspekte der Mitleidserregung untersuchen wird.
Das Kapitel „Lessing und das Mitleid“ beleuchtet Lessings Abgrenzung von der klassischen Dramentheorie Aristoteles, die er für "übersetzungsfehlerhaft" hält, da sie Schrecken als primären Affekt des Dramas sieht. Lessing hingegen postuliert das Mitleid als wichtigsten Bestandteil der Tragödie und sieht Schrecken und Bewunderung lediglich als "Vorstufe" an.
Das Kapitel "Die Träne im historischen Kontext" betrachtet die Träne im Kontext der Physiognomik und der Lehre der Körpersäfte, um deren Bedeutung in dieser Epoche zu beleuchten.
Das Kapitel "Allgemeine Tränentheorie" beschäftigt sich mit der Frage, wie man beim Publikum Tränen hervorrufen kann und was es braucht, um einen Zuseher zu Tränen zu rühren. Es beleuchtet dramaturgische Aspekte der Mitleidserregung.
Das Kapitel "Miss Sara Sampson" analysiert Lessings Werk und untersucht, wie es Tränen auf der Bühne erzeugt und welche Wirkung sie auf das Publikum haben.
Das Kapitel "Emilia Galotti" betrachtet Lessings anderes Werk, das, obwohl vom selben Autor, andere Prioritäten setzt und weniger Emotionen hervorruft. Das Kapitel untersucht die Gründe für diesen Unterschied.
Das Kapitel "Vergleich beider Werke" vergleicht "Miss Sara Sampson" und "Emilia Galotti" ausführlich und analysiert die Gründe für die unterschiedliche Wirkung der beiden Werke.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Mitleid, Träne, Dramaturgie, bürgerliches Trauerspiel, Lessing, "Miss Sara Sampson", "Emilia Galotti", Physiognomik, Körpersäfte, Empfindsamkeit und Aristoteles. Die Arbeit beleuchtet die Konzeption des Mitleids im Kontext der Tragödie und untersucht, wie Tränen auf der Bühne erzeugt und beim Publikum wahrgenommen werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Lessings Mitleidskonzeption?
Lessing sieht Mitleid als den zentralen Affekt der Tragödie. Er grenzt sich von Aristoteles ab, indem er Mitleid über Schrecken und Bewunderung stellt.
Was besagt die "Tränentheorie" im Theater?
Die Tränentheorie untersucht dramaturgische Mittel, die darauf abzielen, beim Publikum Mitleid zu erregen und es physisch zu Tränen zu rühren.
Warum war "Miss Sara Sampson" erfolgreicher als "Emilia Galotti"?
Während "Miss Sara Sampson" als hochemotionales bürgerliches Trauerspiel galt, empfanden Zeitgenossen wie Goethe "Emilia Galotti" als kalkulierter und weniger rührend.
Welche Rolle spielt die Physiognomik in diesem Kontext?
Die Physiognomik und die Lehre der Körpersäfte dienten im 18. Jahrhundert dazu, die Träne als unmittelbaren Ausdruck innerer Affekte und als "Ursprache der Natur" zu deuten.
Was ist das Ziel des bürgerlichen Trauerspiels bei Lessing?
Es soll die moralische Besserung des Zuschauers durch die Übung im Mitleid erreichen.
- Quote paper
- Alexander Wimmer (Author), 2012, Mitleid und Tränentheorie im Theater anhand Lessings "Miss Sara Sampson" und "Emilia Galotti", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211787