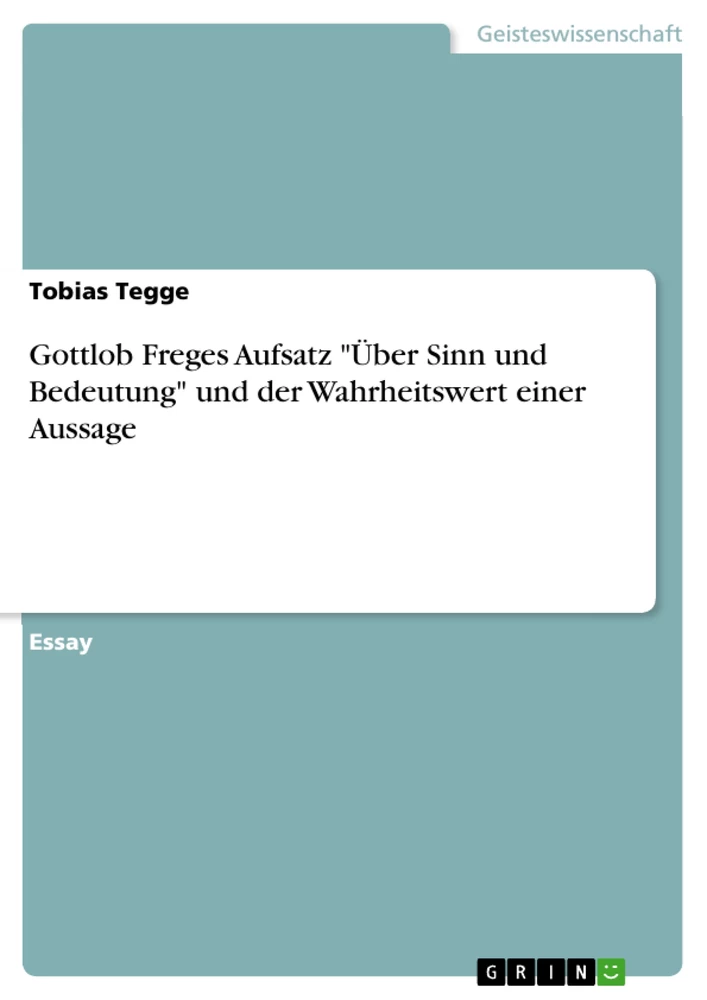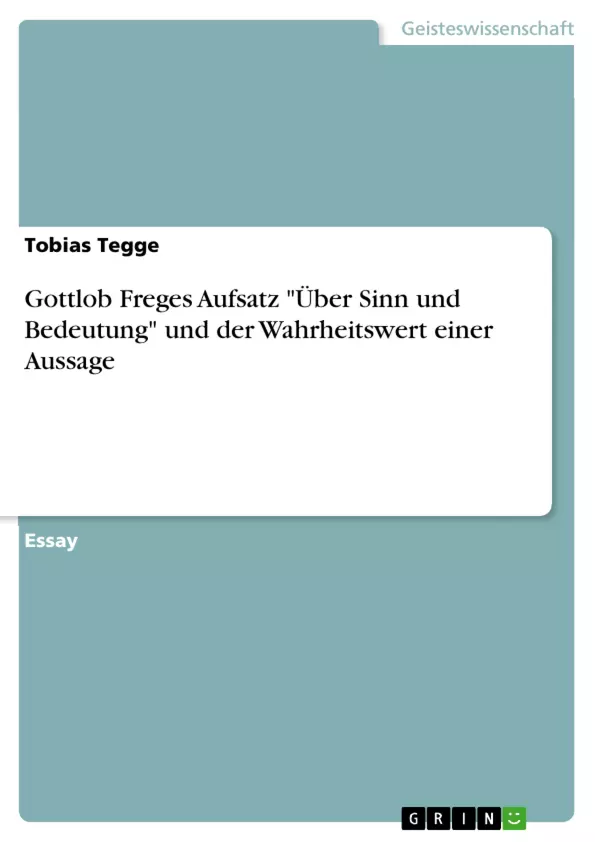Aussagesätze wie „Die Sonne scheint“ besitzen unserer klassischen Auffassung nach einen von
zwei möglichen Wahrheitswerten. Entweder besitzt ein solcher Satz den Wert, wahr zu sein, oder
den Wert, falsch zu sein. Wir fragen uns, woran wir den Wert ablesen können, wie er zustande
kommt und was dieser Wert ist. Eine mögliche Antwort lässt sich in Gottlob Freges Aufsatz Über
Sinn und Bedeutung finden. Dort kommt dieser zu dem Schluss, dass die Bedeutung eine Satzes
dessen Wahrheitswert ist. Die Fragen, die sich so stellen, sind:
1.Wie kommt Frege zu diesem Schluss und warum?
2.Was ist überhaupt Bedeutung?
Und diese möchte ich beantworten, die zweite zuerst, weil ihre Antwort zur Beantwortung der
ersten offensichtlich unabdingbar ist.
Aussagesätze wie „Die Sonne scheint“ besitzen unserer klassischen Auffassung nach einen von zwei möglichen Wahrheitswerten. Entweder besitzt ein solcher Satz den Wert, wahr zu sein, oder den Wert, falsch zu sein. Wir fragen uns, woran wir den Wert ablesen können, wie er zustande kommt und was dieser Wert ist. Eine mögliche Antwort lässt sich in Gottlob Freges Aufsatz Über Sinn und Bedeutung finden. Dort kommt dieser zu dem Schluss, dass die Bedeutung eine Satzes dessen Wahrheitswert ist. Die Fragen, die sich so stellen, sind:
1. Wie kommt Frege zu diesem Schluss und warum?
2.Was ist überhaupt Bedeutung?
Und diese möchte ich beantworten, die letzte zuerst, weil ihre Antwort zur Beantwortung der zweiten offensichtlich unabdingbar ist.
Was ist Bedeutung?
Bedeutung nach Frege steht in Beziehung zu Zeichen und wird vom Sinn unterschieden, der ebenfalls in einer Beziehung zu Zeichen steht. Als Zeichen bezeichnet Frege nicht bloß
„Schriftzeichen“ oder Zeichen der Gebärdensprache, sondern auch Namen“ und „Wortver- bindungen“.1 Nach eigenen Angaben beschränkt er die Zeichen in seinem Aufsatz auf Eigennamen und in dem Fall beschränkt sich die Bedeutung der Zeichen auf bestimmte Gegenstände „im weitesten Umfange“. Andere Zeichen könnten andere Bedeutungen haben, die dann Begriffe oder Beziehungen wären. Eigennamen sind hier aber auch nicht im üblichen Sinne zu verstehen, sondern werden weiter gefasst als Wörter oder Reihungen von Wörtern, die einen einzelnen Gegenstand bezeichnen. Ein Beispiel hierfür, das er selbst nicht gibt, könnte „der Präsident der Vereinigten Staaten“ sein, denn es gibt ohne Kontext nur einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, denjenigen, der im Augenblick amtiert. „Der Präsident der Vereinigten Staaten“ bezieht sich also auf einen Gegenstand, besteht aber aus vier und damit aus mehreren Wörtern.
Von der Bedeutung eines Zeichens grenzt Frege dessen Sinn ab. Der Sinn ist das, was „von jedem erfasst“ werden kann, „der die Sprache oder das Ganze von Beziehungen hinreichend kennt, der“ der Eigenname angehört.2 Jedem Zeichen entspricht genau „ein bestimmter Sinn“, die Bedeutung von etwas kann aber auch aus mehreren Zeichen bestehen. Im Zeichen steckt der Sinn, das, was wir unter dem Zeichen verstehen, und dem Sinn wird die Bedeutung entnommen. Die Bedeutung ist also nicht Bedeutung nach alltäglichem Verständnis, in dem wir unter Bedeutung all das verstehen,
was wir mit dem Zeichen assoziieren. In indirekter Rede, die Frege als „ungerade Rede“ bezeichnet, wird der Sinn, den der aus der direkten Rede wiedergegebene Satz hat, zur Bedeutung des Satzes in der indirekten Rede.3
Wie kommt Frege zu dem Schluss, dass die Bedeutung eines Satzes sein Wahrheitswert ist?
Zuerst einmal besteht für Frege die Bedeutung eines Satzes aus der Bedeutung der Zeichen, aus denen der Satz besteht. Im Satz „Odysseus wurde tief schlafend in Ithaka an Land gesetzt“ ist die fehlende Bedeutung von „Odysseus“ der Grund dafür, dass der ganze Satz keine Bedeutung hat.4 Außerdem setzt Frege das Verhältnis des Gedankens zum Wahren mit dem Verhältnis des Sinns zur Bedeutung gleich. Dies liegt daran, dass er der Ansicht ist, dass Behauptungssätze Gedanken enthalten und diese Gedanken wiederum der Sinn des Behauptungssatzes sind. Sie sind deshalb der Sinn, weil ein Satz, dessen Subjekt durch ein Wort mit derselben Bedeutung und verschiedenem Sinn ersetzt wird, als neuer Behauptungssatz aufgefasst werden kann. Der Satz „Der Morgenstern ist ein von der Sonne beleuchteter Körper“ kann auch dann für falsch gehalten werden, wenn man „Der Abendstern ist ein von der Sonne beleuchteter Körper“ als wahr erkannt hat, obwohl „der Morgenstern“ und „der Abendstern“ dieselbe Bedeutung haben. Das Verhältnis des Gedankens zum Wahren wird von ihm ohne Begründung vorausgesetzt, während er für das Verhältnis des Sinns zur Bedeutung eine Begründung liefert. Dieses Verhältnis ergibt sich daraus, dass Sinn und Bedeutung beide Teile eines Zeichens sind.
Frege sagt, der Sinn eines Satzes sei der Gedanke, den der Satz ausdrückt, und er unterscheidet Gedanken von Vorstellungen. Mir scheint, dass die Vorstellung, soweit es aus dem Aufsatz hervorgeht, als Kandidat für das Sinn-sein ebenso gut geeignet ist wie der Gedanke. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Frege keinen Grund dafür angibt, weshalb der Gedanke der Sinn eines Satzes ist. Ebenso fehlt eine Begründung dafür, weshalb die Vorstellung kein geeigneter Kandidat ist.
Davon abgesehen denke ich, dass man zumindest so, wie wir wahre und falsche Aussagen im Alltag verstehen, auch ebensolche Aussagen über fiktive Gegenstände machen kann. Nach Frege wäre das nicht möglich. Wenn ich sage, „Sherlock Holmes ist ein berühmter Detektiv“, dann halte ich die Aussage für wahr, selbst wenn ich mir dessen bewusst bin, dass Homes eine fiktive Person ist (und
ich nehme an, dessen bin ich mir in diesem Moment bewusst, wobei die Existenz von Sherlock Holmes oder einer real existierenden Vorlage für ihn tatsächlich von einigen in Betracht gezogen wird). Ich denke auch, wenn man nach berühmten Detektiven fragte und die Menge nicht derart beschränkte, nach nicht-fiktionalen Personen zu fragen, würden Menschen durchaus Sherlock Holmes als einen Besitzer dieser Eigenschaft nennen. Dass dies besonders beweiskräftig ist, lässt sich allerdings wiederum bestreiten.
Wenn wir jedenfalls annehmen, dass ein solcher Aussagesatz wahr ist, indem es auf Holmes zutrifft, ein berühmter Detektiv zu sein und indem es auf berühmte Detektive zutrifft, dass Holmes einer von ihnen ist, dann haben wir mit dem Frege'schen Modell ein Problem. Denn entweder sagen wir, Sherlock Homes gibt es in unserer Realität und somit hat sein Zeichen und damit das komplexe Zeichen dieses speziellen Aussagesatzes eine Bedeutung. Oder wir sagen, nein, Sherlock Holmes gibt es nicht, man hätten ihn nicht 1885 in London treffen können und das Zeichen „Sherlock Holmes“ hat keine frege'sche Bedeutung, somit auch der Satz nicht. Im letzteren Falle würde das bedeuten, dass dem Satz ein Wahrheitswert zugesprochen wird, obwohl der Satz keine Bedeutung hat. Damit wäre die Bdeutung nicht der Wahrheitswert eines Satzes.
[...]
1 Gottlob Frege: „Über Sinn und Bedeutung“. In: Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien.. Göttingen 1986, S. 41.
2 Ebenda, S. 42.
3 Ebenda, S. 43.
4 Ebenda, S. 47.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Gottlob Frege unter "Sinn" und "Bedeutung"?
Der "Sinn" ist die Art des Gegebenseins eines Gegenstandes, während die "Bedeutung" der Gegenstand selbst ist, auf den sich ein Zeichen bezieht.
Was ist laut Frege die Bedeutung eines Aussagesatzes?
Frege kommt zu dem Schluss, dass die Bedeutung eines Satzes dessen Wahrheitswert (Wahr oder Falsch) ist.
Wie wird "Sinn" im Kontext eines Satzes definiert?
Der Sinn eines Satzes ist der Gedanke, den der Satz ausdrückt. Dieser Gedanke ist objektiv und kann von jedem erfasst werden, der die Sprache versteht.
Welche Problematik ergibt sich bei fiktiven Namen wie "Odysseus"?
Da es für "Odysseus" keinen realen Referenten gibt, hat der Name zwar einen Sinn, aber keine Bedeutung. Folglich hat auch der ganze Satz nach Frege keinen Wahrheitswert.
Was ist der Unterschied zwischen einem Gedanken und einer Vorstellung?
Ein Gedanke ist objektiv und allgemein zugänglich, während eine Vorstellung subjektiv ist und nur im Bewusstsein eines Einzelnen existiert.
Welche Kritik äußert der Autor an Freges Modell bezüglich Fiktion?
Der Autor argumentiert, dass wir im Alltag Sätzen über fiktive Figuren (wie Sherlock Holmes) durchaus Wahrheitswerte zusprechen, was Freges strikte Trennung in Frage stellt.
- Citation du texte
- Tobias Tegge (Auteur), 2011, Gottlob Freges Aufsatz "Über Sinn und Bedeutung" und der Wahrheitswert einer Aussage, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/211987