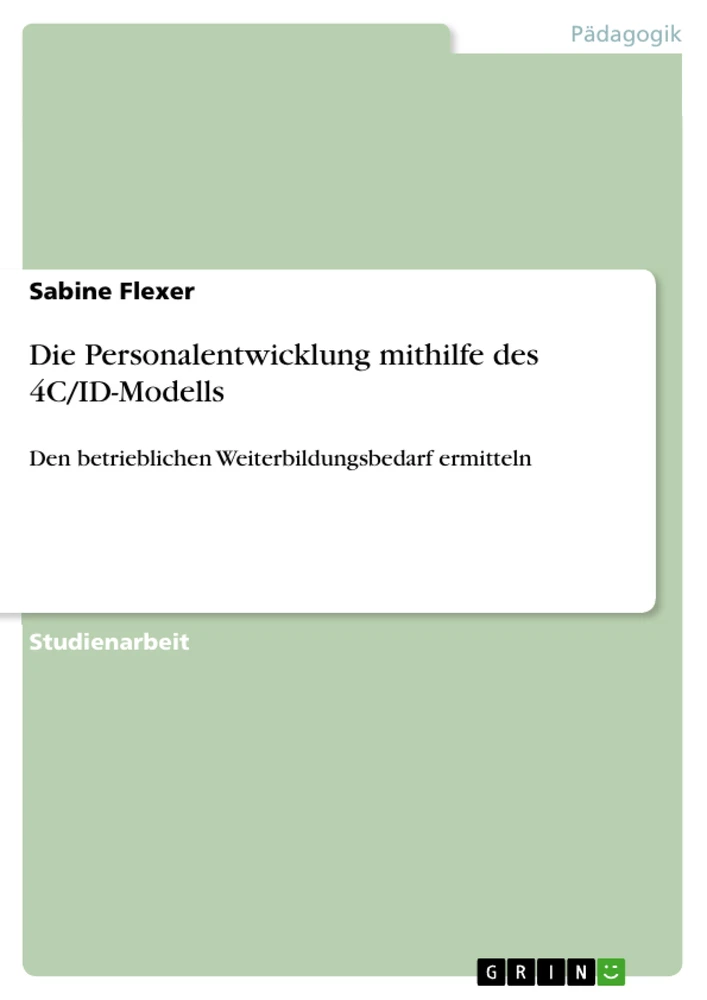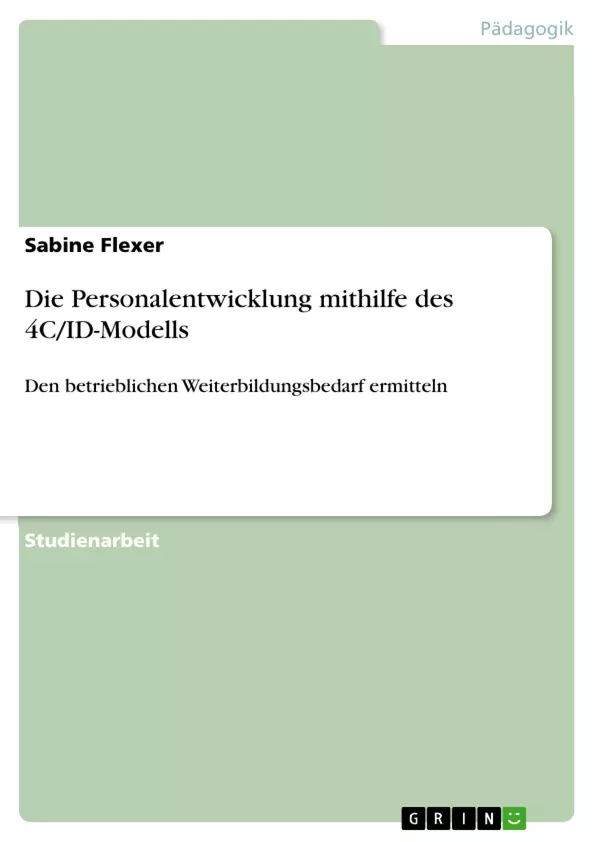Durch Einführung neuer Technologien, zunehmende Globalisierung des
Wettbewerbs und erhöhte Anforderungen an die Produktqualität, sowie
wachsende Kundenorientierung verändert sich die Arbeitswelt in jüngster
Zeit immer schneller. Diese Veränderungen machen eine ständige Anpassung
der beruflichen Qualifikationen erforderlich (Holling & Liepmann, 2004, S.
345).
Die Personalentwicklung beschäftigt sich mit der systematischen Erweiterung
von beruflichen Handlungskompetenzen, und verwendet dazu spezifische
Methoden der Beratung, Aus- und Weiterbildung (Holling & Liepmann,
2004, S. 347).
Die vorliegende Hausarbeit enthält einen Lehrplanentwurf (Blueprint) für einen
Bildungswissenschaftler1, der nach seinem Universitätsabschluss in der
Personalentwicklungsabteilung eines Unternehmens Anstellung gefunden hat.
Zu seinem Aufgabengebiet soll künftig die Implementation von Trainingsprogrammen
zur betrieblichen Weiterbildung der Mitarbeiter gehören. Daher
gilt es für ihn zunächst, den Weiterbildungsbedarf zu ermitteln
Im ersten Teil wird ein auf Basis des von Jeroen van Merriënboer entwickelten
Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modells (im Folgenden 4C/IDModell)
entwickelter Blueprint vorgestellt, der den Bildungswissenschaftler
beim Erwerb der erforderlichen Kompetenzen unterstützt.
Beginnend mit der Erstellung einer Fertigkeitenhierarchie werden im weiteren
Verlauf Lernaufgaben, unterstützende -, sowie Just-in-time Informationen
beschrieben.
Im theoretischen Teil der Arbeit wird das 4C/ID-Modell in Bezug zu Lerntheorien
und situiertem Lernen betrachtet. Darüber hinaus werden didaktische
Szenarien aufgezeigt, die sich zur Integration in das 4CI/D-Modell eignen,
und es werden Medien zur Unterstützung des Blueprints erläutert.
Den Abschluss bildet eine zusammenfassende Bewertung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die praktische Anwendung des 4C/ID-Modells
- Kompetenzanalyse
- Sequentialisierung der Aufgabenklassen
- Entwurf von Lernaufgaben
- Entwurf von unterstützenden Informationen
- Entwurf von Just-in-time-Informationen
- Das 4C/ID-Modell in der Theorie
- Lerntheoretische Überlegungen
- Aspekte des situierten Lernens
- Didaktische Szenarien
- Medien zur Unterstützung des Blueprints
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Lehrplanentwurfs (Blueprint) für einen Bildungswissenschaftler, der in der Personalentwicklung eines Unternehmens tätig ist und Trainings-programme zur betrieblichen Weiterbildung implementieren soll. Der Blueprint soll den Bildungswissenschaftler beim Erwerb der notwendigen Kompetenzen im Bereich der Weiterbildungsbedarfsermittlung unterstützen.
- Anwendung des 4C/ID-Modells zur Entwicklung eines Blueprints
- Erstellung einer Fertigkeitenhierarchie und Definition von Lernaufgaben
- Integration von unterstützenden und Just-in-time-Informationen
- Theoriebezug des 4C/ID-Modells zu Lerntheorien und situiertem Lernen
- Einsatz von Medien zur Unterstützung des Blueprints
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Problem der zunehmenden Anforderungen an die berufliche Qualifikation im Kontext der modernen Arbeitswelt dar. Sie beschreibt die Rolle der Personalentwicklung bei der Erweiterung von Handlungskompetenzen und skizziert das Ziel der Arbeit: die Entwicklung eines Blueprints für einen Bildungswissenschaftler in der Personalentwicklung.
- Die praktische Anwendung des 4C/ID-Modells: Dieses Kapitel erläutert das 4C/ID-Modell und seine vier Komponenten: Lernaufgaben, Teil-Aufgaben-Übung, unterstützende Informationen und Just-in-time-Informationen. Es zeigt die praktische Umsetzung des Modells anhand eines Beispiels.
- Das 4C/ID-Modell in der Theorie: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des 4C/ID-Modells, indem es Lerntheoretische Überlegungen, Aspekte des situierten Lernens, didaktische Szenarien und medienbasierte Unterstützungsformen behandelt.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit behandelt die Themen Personalentwicklung, betriebliche Weiterbildung, Kompetenzanalyse, 4C/ID-Modell, Lernaufgaben, unterstützende Informationen, Just-in-time-Informationen, Lerntheorie, situiertes Lernen, didaktische Szenarien, Medien zur Unterstützung des Lernens.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 4C/ID-Modell?
Das von Jeroen van Merriënboer entwickelte Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell (4C/ID) dient der Gestaltung von Lehrplänen für den Erwerb komplexer kognitiver Fertigkeiten durch die Integration von Lernaufgaben, unterstützenden Informationen und Just-in-time-Informationen.
Welches Ziel verfolgt die vorliegende Hausarbeit?
Ziel ist die Erstellung eines Lehrplanentwurfs (Blueprint) für einen Bildungswissenschaftler in der Personalentwicklung, um ihn beim Erwerb von Kompetenzen zur Ermittlung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs zu unterstützen.
Was sind "Just-in-time-Informationen" im 4C/ID-Modell?
Dies sind Informationen, die dem Lernenden genau in dem Moment zur Verfügung gestellt werden, in dem er sie zur Ausführung einer Teilaufgabe benötigt, um die kognitive Belastung zu steuern.
Welche Rolle spielt das "situierte Lernen" in dieser Arbeit?
Die Arbeit setzt das 4C/ID-Modell in Bezug zu Theorien des situierten Lernens, bei denen der Wissenserwerb eng an den Anwendungskontext und reale Problemlösungen geknüpft ist.
Was beinhaltet die Kompetenzanalyse im Rahmen des Blueprints?
Sie umfasst die Erstellung einer Fertigkeitenhierarchie und die Definition von Lernaufgaben, die systematisch aufeinander aufbauen, um die berufliche Handlungskompetenz zu erweitern.
- Arbeit zitieren
- Sabine Flexer (Autor:in), 2013, Die Personalentwicklung mithilfe des 4C/ID-Modells, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212199