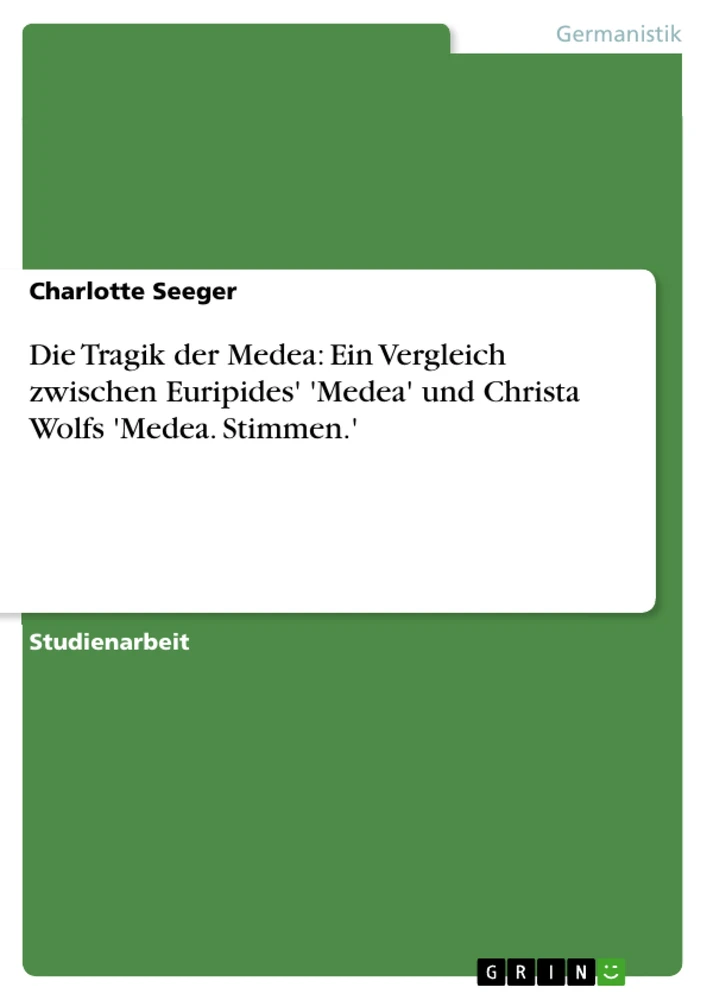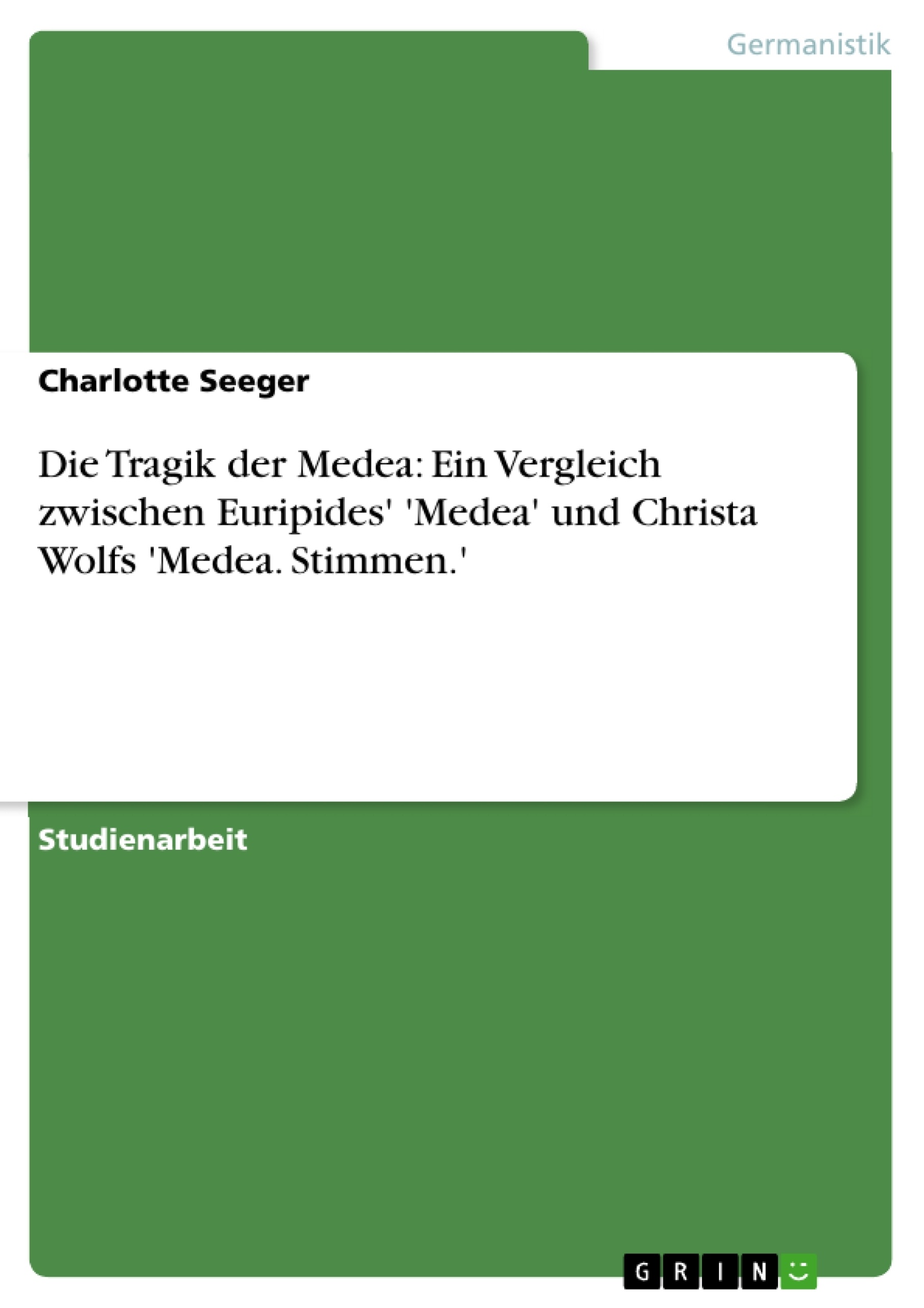Die Rezeption antiker Mythen erfreut sich bereits seit Jahrhunderten besonderer Beliebtheit. Schon in der Antike selbst wurden die meist mündlich tradierten Sa¬gen immer wieder neu erzählt und verändert. Auf Grund der Variationsvielfalt der mythischen Stoffe, ihrer Zeitlosigkeit und der Offenheit der Überlieferungen, ist ein breites Interpretationsspektrum gegeben. Diese Varianz hat im Besonderen Autoren der Moderne gereizt und somit zu immer wieder neuartigen Varianten des Mythos beigetragen.
So auch der Medea-Mythos, der im Laufe der Literaturgeschichte bereits zahlrei¬che Bearbeitungen, Umdeutungen und Korrekturen erfahren musste. Über Jahr¬tausende beweist sich die Figur der Medea als höchst ambivalente Persönlichkeit. Ihre umstrittenen Taten und ihr charakterstarkes Wesen rücken sie in ein sehr viel¬schichtiges Licht. Tabuisierte und düstere Seiten von Liebe und Mütterlichkeit werden aufgeschlagen und erinnern an barbarische, unzivilisierte Zeiten, die mit dem Lauf der Jahrhunderte überwunden werden konnten. Positive und negative Eigenschaften sind in dieser Figur vereint und in zahlreichen literarischen Varia-tionen zugespitzt, oder auch abgeschwächt. Die vielfache Mörderin und rachsüch¬tig Liebende steht dabei im Gegensatz zur intellektuellen, erotischen, sowie selbstbewussten Frau und sorgender Mutter. Als tragische Heldin wird ihre gren¬zenlose Liebe, die sie anderen Individuen gegenüber empfindet zum Verhängnis und lässt sie in ihrer ambiguen Gestalt besonders interessant wirken. Die zahlrei¬chen Widersprüche, in der sich die Figur Medeas bewegt macht die Bearbeitung eines solchen Sujets besonders reizvoll.
Die Tragik, die diesem mythischen Stoff inhärent ist, soll anhand zweier Beispiele analysiert werden. Zunächst soll die antike Vorlage des Medea-Stoffes, in Form von Euripides Tragödie „Medea“ auf ihre tragischen Komponenten untersucht und in einen direkten Vergleich zu Senecas Medea-Bearbeitung gestellt werden. Nach eingehender Analyse von Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“, soll ein Vergleich der beiden tragischen Konzepte Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufdecken und somit eine vielseitige Sicht auf den Mythos Medea ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Die Tragik der euripideischen Medeafigur..
- Das Los der gedemütigten Ehefrau
- Medea als Inkarnation von Affekt und Emotionalität?
- Medeas Rache...
- Exkurs: Medea, die Furie - Senecas Medea..
- Die Tragik in Christa Wolfs „Medea. Stimmen.“.
- Die Sündenbockproblematik
- Medea als Projektionsfigur für Ethnizität und Fremdheit.
- Medea als Identifikationsfigur im Kampf der Geschlechter..
- Vergleich.....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Tragik der Medeafigur in zwei unterschiedlichen literarischen Werken: Euripides' "Medea" und Christa Wolfs "Medea. Stimmen." Ziel ist es, die tragischen Komponenten in beiden Texten zu untersuchen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Die Analyse soll einen tiefen Einblick in den Umgang mit dem Mythos Medea im Wandel der Zeit ermöglichen.
- Die Tragik des Frauenloses in der antiken Welt
- Medea als Inkarnation von Emotion und Leidenschaft
- Der Konflikt zwischen Vernunft und Affekt
- Medea als Figur der Ambivalenz und des Kampfes der Geschlechter
- Die Rolle des Mythos in der modernen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Rezeption antiker Mythen und die Vielschichtigkeit der Medeafigur ein. Sie hebt die Bedeutung des Mythos in der Literaturgeschichte hervor und unterstreicht die Ambivalenz der Figur. Kapitel 2 untersucht die Tragik der euripideischen Medeafigur. Hier werden die Tragik des Frauenloses, insbesondere das Los der gedemütigten Ehefrau, sowie die Darstellung von Medea als Inkarnation von Affekt und Emotionalität analysiert. Zudem wird Medeas Rache und der Exkurs über Senecas Medea-Bearbeitung behandelt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit Christa Wolfs "Medea. Stimmen." und beleuchtet die Sündenbockproblematik, Medea als Projektionsfigur für Ethnizität und Fremdheit sowie als Identifikationsfigur im Kampf der Geschlechter.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Tragik, anhand der Analyse der Medeafigur in zwei verschiedenen literarischen Werken: Euripides' "Medea" und Christa Wolfs "Medea. Stimmen." Zentral sind die Konzepte des Frauenloses, der Affektivität und Emotionalität, der Ambivalenz der Figur, der Konflikt zwischen Vernunft und Gefühl sowie der Umgang mit dem Mythos im Wandel der Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Euripides' und Christa Wolfs Medea?
Während Euripides Medea als rachsüchtige Kindsmörderin darstellt, deutet Christa Wolf die Figur um und beleuchtet sie im Kontext von Fremdheit, Sündenbock-Mechanismen und Geschlechterkampf.
Warum gilt Medea als eine ambivalente Figur?
Medea vereint gegensätzliche Eigenschaften: Sie ist einerseits eine liebende Mutter und intellektuelle Frau, andererseits eine rachsüchtige Mörderin und eine "Barbarin" in den Augen der antiken Gesellschaft.
Was wird unter der „Sündenbockproblematik“ bei Christa Wolf verstanden?
In Wolfs Roman wird Medea zum Sündenbock einer korrupten Gesellschaft gemacht. Ihr wird Schuld zugeschrieben, um von den Verfehlungen der herrschenden Macht abzulenken.
Wie wird das Schicksal der Frau in der antiken Tragödie thematisiert?
Der Text analysiert die Tragik der gedemütigten Ehefrau in einer patriarchalischen Welt, in der Medea zwischen ihren Emotionen (Affekt) und der gesellschaftlichen Vernunft gefangen ist.
Welche Rolle spielt die Fremdheit in der Figur der Medea?
Medea dient als Projektionsfläche für Ethnizität und das "Andere". Ihre Herkunft aus Kolchis macht sie in Korinth zur Außenseiterin, was ihre Tragik verstärkt.
Wird auch Senecas Medea in der Arbeit berücksichtigt?
Ja, die Arbeit enthält einen Exkurs zu Senecas Medea-Bearbeitung, in der sie verstärkt als "Furie" und Inkarnation extremer Leidenschaft dargestellt wird.
- Quote paper
- Charlotte Seeger (Author), 2011, Die Tragik der Medea: Ein Vergleich zwischen Euripides' 'Medea' und Christa Wolfs 'Medea. Stimmen.', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212353