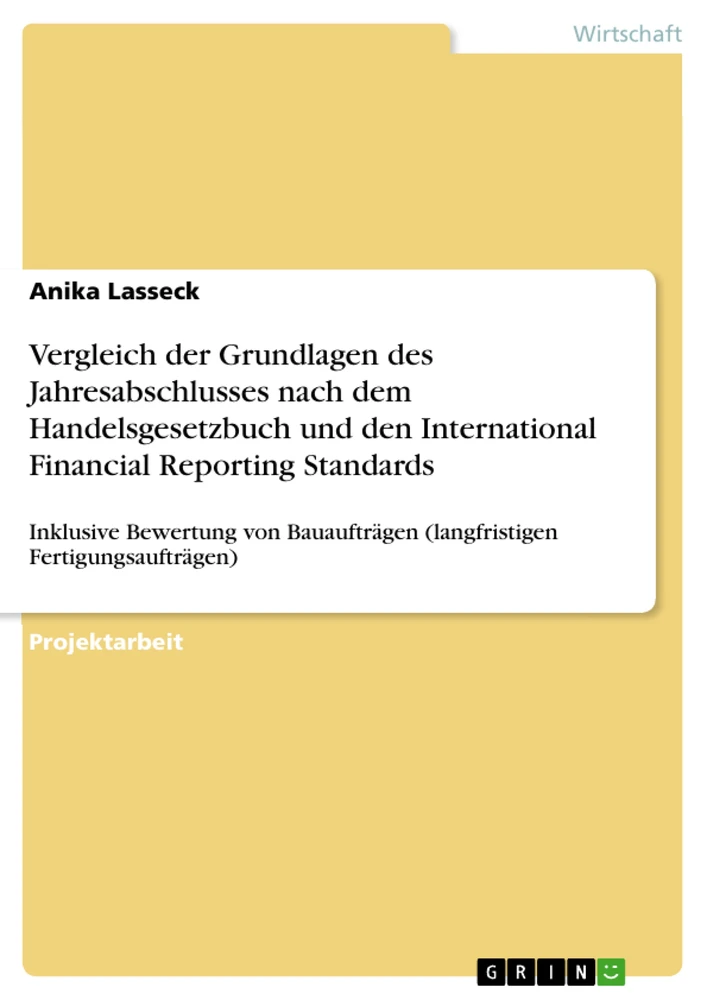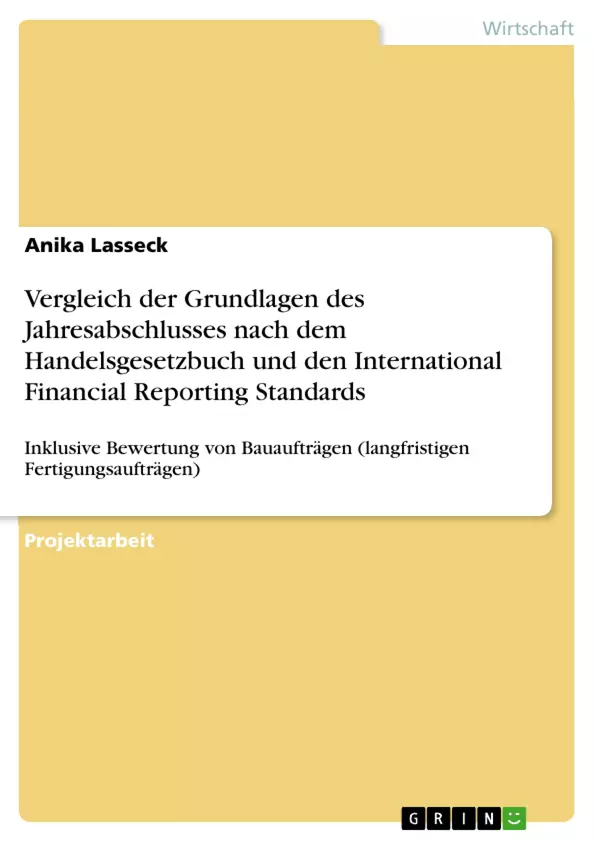Die Vermeidung von Falschangaben in der Bilanz begründet die Notwendigkeit zur Schaffung einheitlich geltender Rechtsnormen. In Deutschland wurde dafür das Handelsgesetzbuch (HGB) eingeführt, welches Gültigkeit für alle Kaufleute besitzt.
Kaufmann ist im Sinne des § 1 Abs. (Absatz) 1 HGB derjenige, der ein Handelsgewerbe betreibt. Ein Handelsgewerbe ist gemäß § 1 Abs. 2 HGB jeder Gewerbebetrieb, der nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.2
Die bestehenden nationalen Gesetze basieren auf dem Vorsichtsprinzip und dem Gläubigerschutz. Der Kaufmann soll sich nach dem HGB lieber ärmer als reicher rechnen, das dient der Vermeidung von ungerechtfertigter Gewinnausschüttung. In den letzten Jahren stand der deutsche Jahresabschluss zunehmend in der Kritik.
Hauptproblem des Jahresabschlusses nach dem HGB besteht darin, dass für die Unternehmen die Möglichkeit besteht, stille Reserven zu bilden, welche in schlechten Zeiten aufgelöst werden können. Dadurch entsteht eine nicht der Wirklichkeit entsprechende Darstellung. Aber auch die zunehmende Globalisierung hat die Entwicklung von neuen, über die deutschen Staatsgrenzen hinaus geltenden, Regelungen gefordert. Um dem entgegenzuwirken wurden Vorschriften im Rahmen des internationalen Rechnungswesens festgelegt. Anfangs waren diese unter der Bezeichnung International Accounting Standards bekannt, heute sind das die weiter entwickelten International Financial Reporting Standards (IFRS). Das Hauptziel der IFRS ist die Wiedergabe der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens und die Erfüllung einer Informationsfunktion für die Abschlussadressaten.3
In meiner Praxisarbeit werde ich mich vorrangig mit den Grundprinzipien des HGB’s und der IFRS auseinandersetzen. Des Weiteren werde ich auf die verschiedenartigen Bilanzansätze für langfristige Fertigungsaufträge eingehen, weil in der Bauwirtschaft die Abwicklung von komplexen Bauvorhaben meist einen Zeitraum über einen oder mehrere Bilanzstichtage beansprucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Jahresabschluss nach dem Handelsgesetzbuch
- Allgemeine Informationen und die Entstehung des Handelsgesetzbuches
- Der Aufbau des Dritten Buches des Handelsgesetzbuch
- Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- Der Grundsatz der Richtigkeit und der Willkürlichkeit
- Der Grundsatz der Klarheit
- Der Grundsatz der Vollständigkeit
- Der Grundsatz der Stetigkeit
- Der Grundsatz der Vorsicht
- Abgrenzungsgrundsätze
- Die Bestandteile des Jahresabschlusses
- Die Bilanzierung von langfristigen Fertigungsaufträgen
- Der Jahresabschluss nach den International Financial Reporting Standards
- Hintergründe zur Entstehung der IFRS und Ziele
- Der Aufbau der IFRS
- Die Grundprinzipien der IFRS-Rechnungslegung
- Die Grundannahmen
- Die qualitativen Anforderungen
- Die Beschränkungen für die relevanten und zuverlässigen Informationen
- Die Bestandteile des Jahresabschlusses
- Die Bilanzierung von Fertigungsaufträgen
- Vergleich und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich der Grundlagen des Jahresabschlusses nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Im Fokus steht dabei die Bewertung von Bauaufträgen, insbesondere von langfristigen Fertigungsaufträgen.
- Vergleich der Grundlagen des Jahresabschlusses nach HGB und IFRS
- Analyse der Bilanzierung von langfristigen Fertigungsaufträgen nach HGB und IFRS
- Untersuchung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Bewertung von Bauaufträgen nach HGB und IFRS
- Bewertung der jeweiligen Stärken und Schwächen der beiden Rechnungslegungsstandards
- Ableitung von Empfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in die Thematik und stellt die Relevanz des Vergleichs von HGB und IFRS in der Praxis heraus. Kapitel 2 befasst sich mit dem Jahresabschluss nach dem Handelsgesetzbuch. Es werden die allgemeinen Informationen und die Entstehung des HGB sowie der Aufbau des Dritten Buches des HGB erläutert. Darüber hinaus werden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sowie die Bestandteile des Jahresabschlusses nach HGB dargestellt. Abschließend wird die Bilanzierung von langfristigen Fertigungsaufträgen nach HGB beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich dem Jahresabschluss nach den International Financial Reporting Standards. Es werden die Hintergründe zur Entstehung der IFRS und deren Ziele vorgestellt. Der Aufbau der IFRS und die Grundprinzipien der IFRS-Rechnungslegung, inklusive der Grundannahmen, qualitativen Anforderungen und Beschränkungen für die relevanten und zuverlässigen Informationen, werden näher beleuchtet. Der Aufbau des Jahresabschlusses nach IFRS und die Bilanzierung von Fertigungsaufträgen werden ebenfalls erläutert.
Das vierte Kapitel beinhaltet einen Vergleich der Erkenntnisse aus den vorhergehenden Kapiteln. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Rechnungslegungsstandards im Hinblick auf die Bewertung von Bauaufträgen herausgearbeitet. Die Stärken und Schwächen von HGB und IFRS werden bewertet und daraus Empfehlungen für die Praxis abgeleitet.
Schlüsselwörter
Jahresabschluss, Handelsgesetzbuch (HGB), International Financial Reporting Standards (IFRS), Bilanzierung, Bewertung, Bauaufträge, langfristige Fertigungsaufträge, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen HGB und IFRS?
Das HGB basiert auf dem Vorsichtsprinzip und Gläubigerschutz, während die IFRS die tatsächliche Vermögenslage (Fair Value) und Informationsfunktion für Investoren betonen.
Was sind „stille Reserven“ im HGB?
Im HGB können Unternehmen sich „ärmer rechnen“, um Reserven für schlechte Zeiten zu bilden, was laut Kritikern die tatsächliche wirtschaftliche Lage verschleiern kann.
Wie werden langfristige Bauaufträge bilanziert?
Die Arbeit vergleicht die Ansätze für langfristige Fertigungsaufträge, die in der Bauwirtschaft besonders relevant sind, da sie oft über mehrere Bilanzstichtage laufen.
Was sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)?
Dazu gehören Prinzipien wie Richtigkeit, Klarheit, Vollständigkeit, Stetigkeit und Vorsicht, die im HGB fest verankert sind.
Warum gewinnt die internationale Rechnungslegung (IFRS) an Bedeutung?
Durch die zunehmende Globalisierung fordern Investoren weltweit vergleichbare Jahresabschlüsse, die über nationale Grenzen hinaus Gültigkeit haben.
- Quote paper
- Anika Lasseck (Author), 2012, Vergleich der Grundlagen des Jahresabschlusses nach dem Handelsgesetzbuch und den International Financial Reporting Standards, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212435