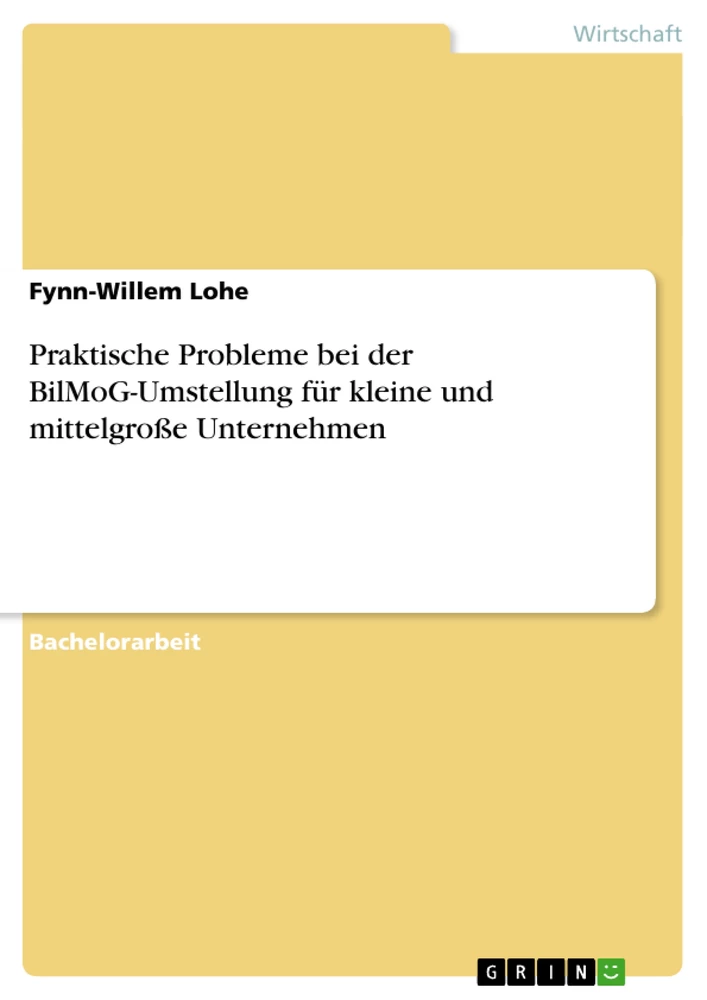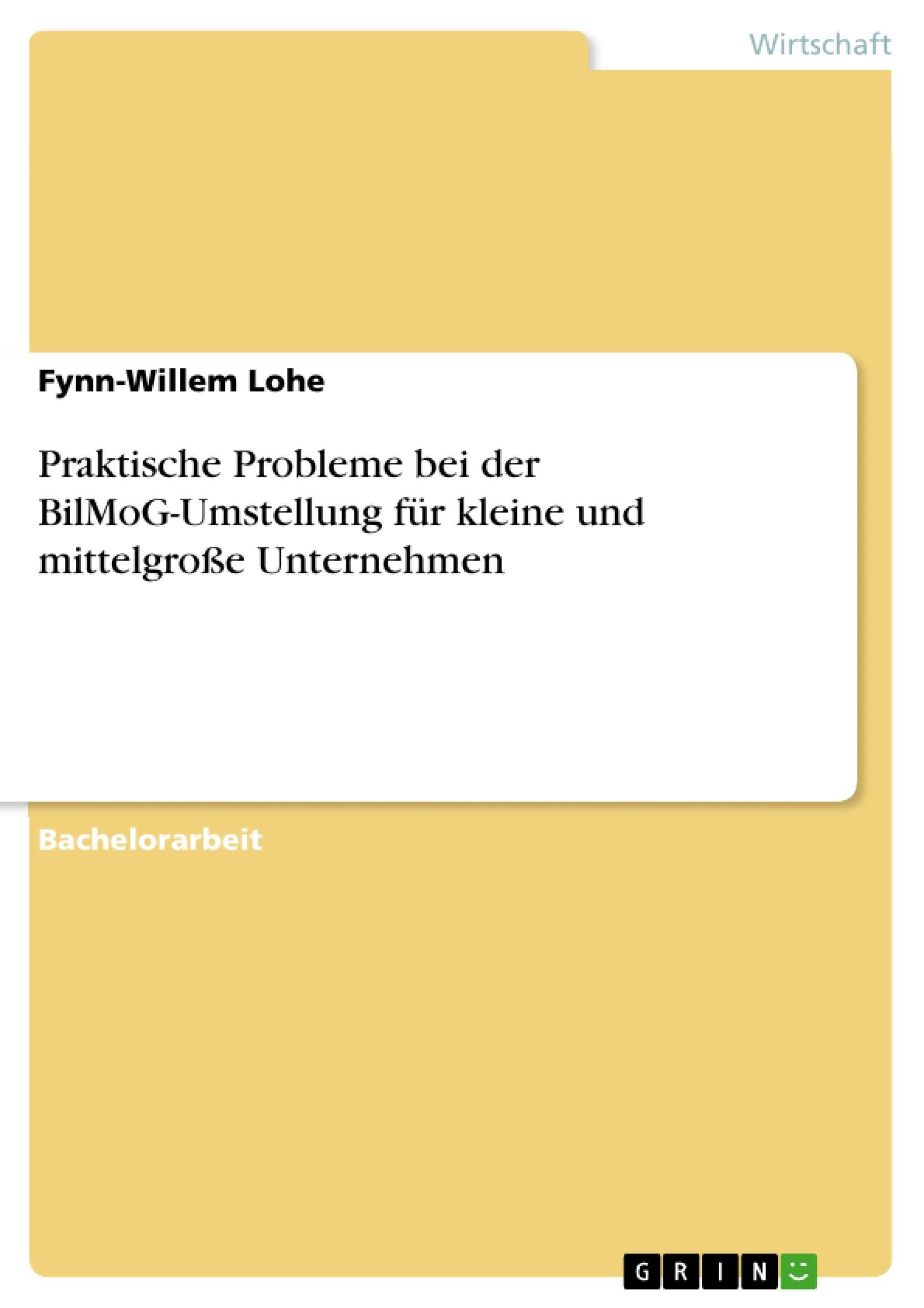Mit der Verabschiedung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) durch den Bundesrat am 03.04.2009 und der Verkündung im Bundesanzeiger am 29.04.2009, wurde die jahrelange Diskussion um die Modernisierung des deutschen Bilanzrechts beendet und der Weg frei für die größte Bilanzrechtsreform seit dem Bilanzrichtliniengesetz (BilRiLiG) von 1985. Dem deutschen Mittelstand soll dadurch eine eigenständige auf dem bewährten HGB-Bilanzrecht aufbauende, dauerhafte und im Verhältnis zu den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) vollwertige, aber kostengünstigere Alternative geboten werden. Zentrale Ziele sind die Deregulierung und die verbesserte Aussagekraft des handelsrechtlichen Jahresabschlusses. Der handelsrechtliche Einzelabschluss soll zum einen dem externen Adressaten einen Einblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens ermöglichen und zum anderen weiterhin die Grundlage der Ausschüttungs- und Steuerbemessung bilden. In der Fachliteratur wird gar von einem Paradigmenwechsel mit der Notwendigkeit zur Neuinterpretation der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gesprochen. Dabei werden insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) vor neue Herausforderungen gestellt.
Die Änderungen des BilMoG und die damit verbundenen Probleme für KMU sind Untersuchungsgegenstand der nachfolgenden Arbeit. Sie wurde in Kooperation mit der Schumacher & Partner GmbH in Münster erstellt und auf die dort entstehenden Problemen abgestimmt. In Kapitel 2 werden die relevanten Begriffe voneinander abgegrenzt und die generellen Auswirkungen auf die Unternehmen erläutert. Anschließend erfolgt in Kapitel 3 eine Betrachtung der wichtigsten Änderungen von Ansatz, Ausweis und Bewertung. In Kapitel 4 werden die Chancen und Risiken, sowie die daraus resultierenden praktischen Probleme analysiert. Dabei wurde insbesondere auf die Umsetzung in den DATEV-Programmen Bezug genommen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit in Kapitel 5.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung und Zielsetzung
- Begriffsabgrenzung und generelle Auswirkungen des BilMoG
- Abgrenzung der relevanten Begriffe
- Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
- Kleine und Mittelgroße Unternehmen (KMU)
- Deregulierende Maßnahmen für KMU
- Befreiung von der Rechnungslegungspflicht
- Anhebung handelsrechtlicher Größenklassen
- Abgrenzung der relevanten Begriffe
- Darstellung wesentlicher Rechnungslegungsänderungen für KMU
- Übergreifende Änderungen der Rechnungslegung
- Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit
- Bewertungseinheiten
- Abschreibungen und Wertaufholungen
- Ausgewählte Änderungen von Ansatz und Bewertung
- Herstellungskosten und immaterielle Vermögensgegenstände
- Rückstellungen
- Latente Steuern
- Übergreifende Änderungen der Rechnungslegung
- Kritische Analyse und Auswirkungen auf die Praxis
- Chancen und Risiken für den Mittelstand
- Deregulierung
- Informationsvermittlung
- Aufgabe der Einheitsbilanz
- Praktische Probleme in der steuerlichen Beratung
- Wechsel der Rechnungslegung
- Aufwandsrückstellungen
- Rückstellungsbewertung
- Steuerlatenzen
- Ergebnisse der Praxisumsetzung und Ausblick
- Gesonderte Erstellung von Handels- und Steuerbilanz
- Chancen und Risiken für den Mittelstand
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit den praktischen Problemen, die bei der Umstellung auf das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) auftreten können. Ziel ist es, die wichtigsten Änderungen des BilMoG darzustellen, deren Auswirkungen auf die Praxis zu analysieren und mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung aufzuzeigen.
- Deregulierung für KMU
- Änderungen bei der Rechnungslegung
- Bewertung von Vermögensgegenständen und Rückstellungen
- Praxisprobleme bei der steuerlichen Beratung
- Auswirkungen auf die Erstellung von Handels- und Steuerbilanz
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit werden erläutert.
- Kapitel 2: Es werden die relevanten Begriffe des BilMoG und der KMU abgegrenzt. Zudem werden die deregulierenden Maßnahmen für KMU, wie die Befreiung von der Rechnungslegungspflicht und die Anhebung handelsrechtlicher Größenklassen, dargestellt.
- Kapitel 3: Die Arbeit beleuchtet wesentliche Änderungen der Rechnungslegung für KMU, wie die Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit, die Bewertungseinheiten, Abschreibungen und Wertaufholungen. Außerdem werden ausgewählte Änderungen von Ansatz und Bewertung behandelt, wie z.B. Herstellungskosten und immaterielle Vermögensgegenstände, Rückstellungen und latente Steuern.
- Kapitel 4: Die Auswirkungen des BilMoG auf die Praxis werden kritisch analysiert. Es werden Chancen und Risiken für den Mittelstand aufgezeigt, darunter die Deregulierung, die Informationsvermittlung und die Aufgabe der Einheitsbilanz. Außerdem werden praktische Probleme in der steuerlichen Beratung, wie der Wechsel der Rechnungslegung, Aufwandsrückstellungen, Rückstellungsbewertung und Steuerlatenzen, behandelt. Die Ergebnisse der Praxisumsetzung und der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), Kleine und Mittelgroße Unternehmen (KMU), Rechnungslegung, Deregulierung, Bewertungseinheiten, Abschreibungen, Wertaufholungen, Herstellungskosten, immaterielle Vermögensgegenstände, Rückstellungen, latente Steuern, Steuerliche Beratung, Praxisprobleme.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Hauptziel des BilMoG für mittelständische Unternehmen?
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) sollte eine kostengünstigere, aber vollwertige Alternative zu den internationalen IFRS-Standards auf Basis des HGB schaffen.
Welche Deregulierungen brachte das BilMoG für KMU?
Dazu gehören die Anhebung der Schwellenwerte für Buchführungspflichten und die Befreiung sehr kleiner Unternehmen von der Pflicht zur Erstellung eines Jahresabschlusses nach HGB.
Was bedeutet die Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit?
Steuerliche Wahlrechte müssen nicht mehr zwingend in die Handelsbilanz übernommen werden, was zu einer stärkeren Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz führt.
Welche Probleme ergeben sich bei der Bewertung von Rückstellungen nach BilMoG?
Rückstellungen müssen nun abgezinst und unter Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen bewertet werden, was die Komplexität in der Praxis erhöht.
Warum sind latente Steuern für KMU durch das BilMoG relevanter geworden?
Durch die zunehmenden Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz (z. B. bei Rückstellungen) müssen Unternehmen häufiger latente Steuern ansetzen, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertragslage zu vermitteln.
- Citar trabajo
- Fynn-Willem Lohe (Autor), 2011, Praktische Probleme bei der BilMoG-Umstellung für kleine und mittelgroße Unternehmen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212729