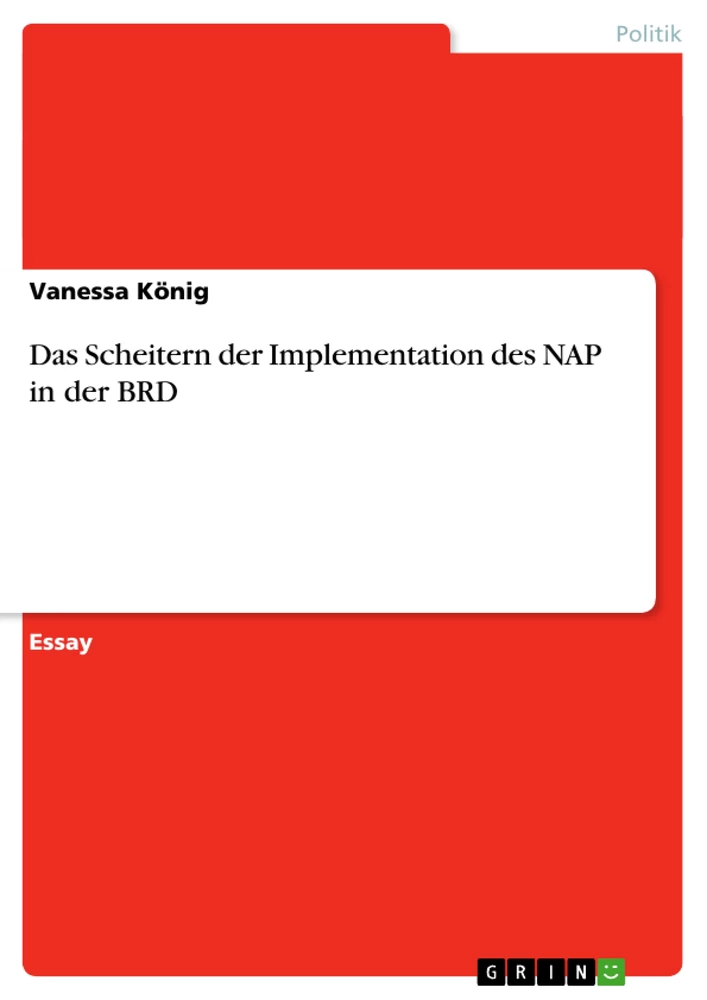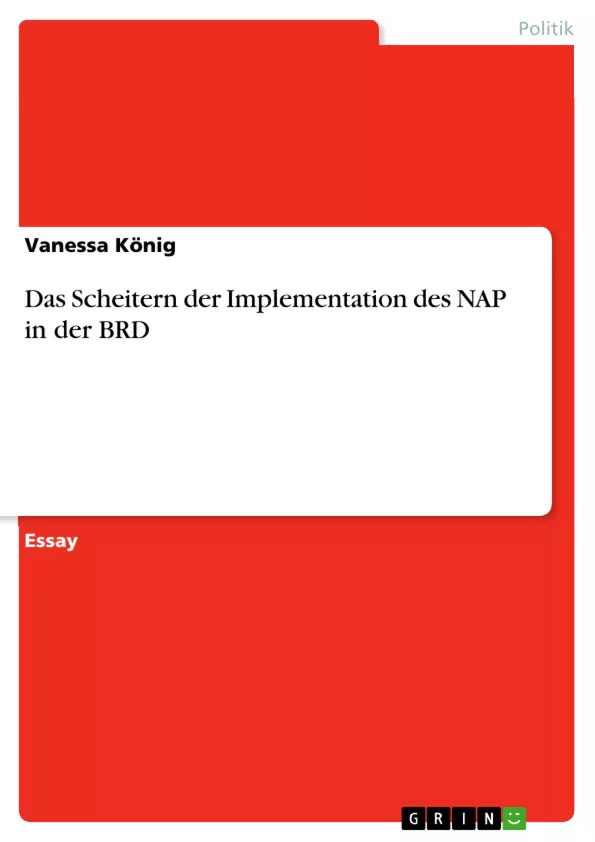Sengende Sommerhitze, milde Winter und zerstörerische Hurrikans, schmelzende Gletscher, überflutete Landstriche und Wüsten die sich immer weiter ausbreiten. Der fortschreitende Klimawandel lässt sich heutzutage kaum noch leugnen. Weltweit hat man die Gefahren des durch Menschen verursachten Klimawandels erkannt und versucht nun zu retten was noch zu retten ist und das Schlimmste zu verhindern. Hauptverursacher des Klimawandels sind, wie wir heute wissen, Treibhausgase wie CO2. Daten aus Forschungsprojekten wie den antarktischen Bohrkernen, zeigen eindeutig auf, dass der Co2 Verbrauch noch nie so hoch geklettert ist wie in den letzten hundert Jahren. Die Weltgemeinschaft wurde sich schnell einig, dass nur ein gemeinsames Handeln helfen kann. Im Zuge des Kyoto-Protokolls, welches im Jahre 1997 entstanden ist, verständigten sich 38 Industriestaaten darauf, insgesamt 6 Treibhausgase, insbesondere CO2Emissionen, im Zeitraum von 2008-2012 um 5,2% gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren. Neben den 5,2 % die das Kyoto-Protokoll vorschreibt, hat sich die Europäische Union dazu verpflichtet, 8% der so genannten Kyoto-Gase in selbigem Zeitraum einzusparen. Deutschland setzte sich selbst das hohe Ziel, eine Reduzierung von 21% zu erreichen. Eines der wichtigsten umweltpolitischen Instrumente zur Bekämpfung der Umweltprobleme ist der am 01.01.2005 in Kraft getretene Emissionshandel der Europäischen Union. Damit wird der CO2-Ausstoß für Anlagenbetreiber beschränkt und nur noch dann gestattet, wenn entsprechende Emissionszertifikate vorliegen. Bei Nichteinhaltung ist mit Sanktionen zu rechnen. Dieses Instrument der Umweltpolitik soll Luft zu einem „werthaltigen Gut“ machen. Die Europäische Union bestimmte außerdem, dass jeder Mitgliedsstaat einen sogenannten Zuteilungsplan aufstellen muss, indem festgelegt wird, wie viele Zertifikate der Mitgliedsstaat in einer Handelsperiode zuteilen will und wie sich die Verteilung im einzelnen abspielen soll. Deutschland als hoch entwickeltes Industrieland, sollte natürlich mit der Einführung seines nationalen Allokationsplanes eine Vorreiterrolle in der Europäischen Union einnehmen und auch im weltweiten Vergleich ein positives Beispiel abgeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der NAP in der BRD
- Der NAP2 in der BRD
- Fazit
- Bibliographie
- Bücher
- Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Implementierung des nationalen Allokationsplans (NAP) in Deutschland im Kontext des EU-Emissionshandelssystems. Sie untersucht, ob die Implementation des NAP als gescheitert anzusehen ist, indem sie die beiden Handelsperioden 2005-2007 und 2008-2012 beleuchtet.
- Die Funktionsweise des EU-Emissionshandelssystems
- Der nationale Allokationsplan (NAP) als zentrales Instrument des Emissionshandels
- Die Herausforderungen der Implementierung des NAP in Deutschland
- Die Rolle von Lobbyismus und Sonderregelungen
- Die Auswirkungen des NAP auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung:
Die Einleitung stellt den Klimawandel als dringendes Problem dar und erläutert die Notwendigkeit internationaler Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Das Kyoto-Protokoll und die Einführung des EU-Emissionshandelssystems werden als wichtige Schritte in dieser Richtung vorgestellt. Die Arbeit fokussiert auf die Implementierung des NAP in Deutschland und untersucht, ob diese als gescheitert anzusehen ist.
- Der NAP in der BRD:
Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise des EU-Emissionshandelssystems sowie die Rolle des nationalen Allokationsplans (NAP). Der NAP dient der Aufteilung der Emissionsbegrenzungen auf einzelne Sektoren und bildet die Grundlage für das Zuteilungsgesetz. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Ansätze für die Zuteilung von Emissionszertifikaten, wie Grandfathering und Benchmarking, sowie die Herausforderungen der ersten Handelsperiode 2005-2007.
- Der NAP2 in der BRD:
Dieses Kapitel analysiert die zweite Handelsperiode des EU-Emissionshandelssystems von 2008 bis 2012. Die Mitgliedsstaaten sollten ihre Erfahrungen aus der ersten Periode nutzen, um ihre nationalen Zuteilungspläne zu verbessern. Der NAP2 in Deutschland sollte sicherstellen, dass die Klimaschutzziele erreicht werden, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie gefördert wird und die Entwicklung von Klimaschutztechnologien unterstützt wird. Das Kapitel beleuchtet die Veränderungen zum NAP1, insbesondere die härteren Reduktionsvorgaben für die Energiewirtschaft, sowie die Kritik an der hohen Anzahl an Emissionszertifikaten, die zu einer mangelnden Verknappung und fehlenden Anreizen für Unternehmen führte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den nationalen Allokationsplan (NAP), das EU-Emissionshandelssystem, die Reduktion von Treibhausgasemissionen, Klimaschutz, Lobbyismus, Sonderregelungen, die Energiewirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und die Implementierung von Umweltpolitik in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Nationale Allokationsplan (NAP)?
Der NAP legt fest, wie viele CO2-Emissionszertifikate ein EU-Mitgliedstaat an seine Anlagenbetreiber zuteilt.
Warum wird die Implementierung des NAP in Deutschland als gescheitert betrachtet?
Kritiker bemängeln eine zu großzügige Zuteilung von Zertifikaten, massiven Lobbyismus und zu viele Sonderregelungen, die den Lenkungseffekt schwächten.
Was ist der Unterschied zwischen Grandfathering und Benchmarking?
Grandfathering basiert auf historischen Emissionen, während Benchmarking die Zuteilung an effizienten Standards orientiert.
Welche Rolle spielt das Kyoto-Protokoll?
Das Protokoll von 1997 verpflichtete Industriestaaten erstmals völkerrechtlich zur Reduktion von Treibhausgasen.
Wie funktioniert der EU-Emissionshandel?
Unternehmen benötigen für jede ausgestoßene Tonne CO2 ein Zertifikat. Durch die Verknappung dieser Zertifikate soll ein Anreiz für Klimaschutzinvestitionen entstehen.
Warum stand die Energiewirtschaft besonders im Fokus?
Die Energiewirtschaft ist einer der Hauptemittenten von CO2 und erhielt im NAP2 deutlich strengere Reduktionsvorgaben.
- Citar trabajo
- Vanessa König (Autor), 2013, Das Scheitern der Implementation des NAP in der BRD, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213331