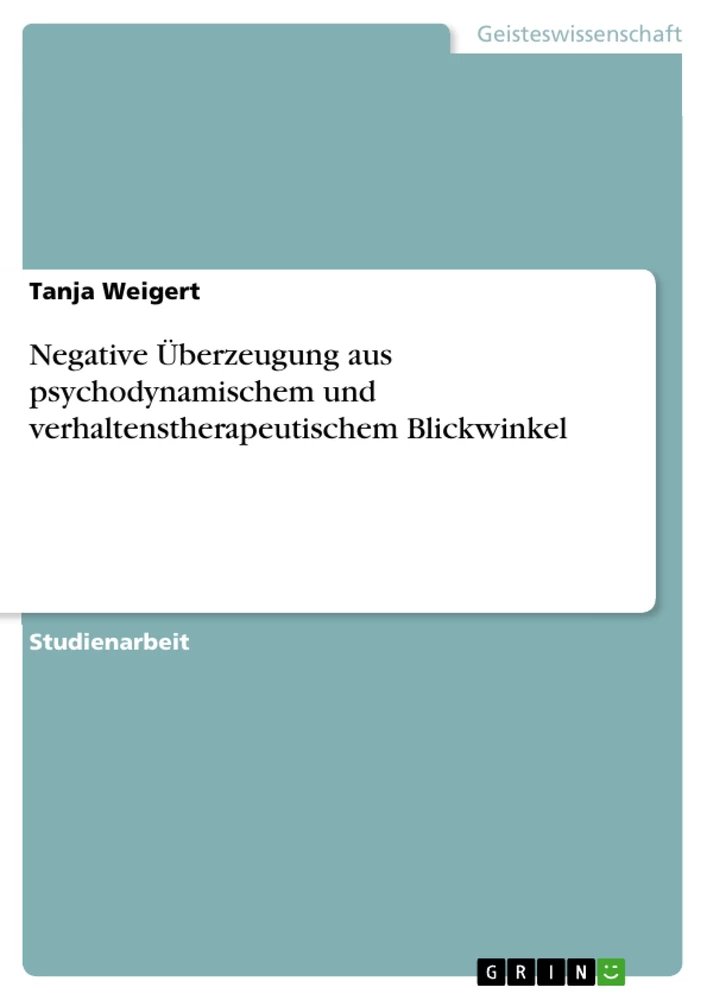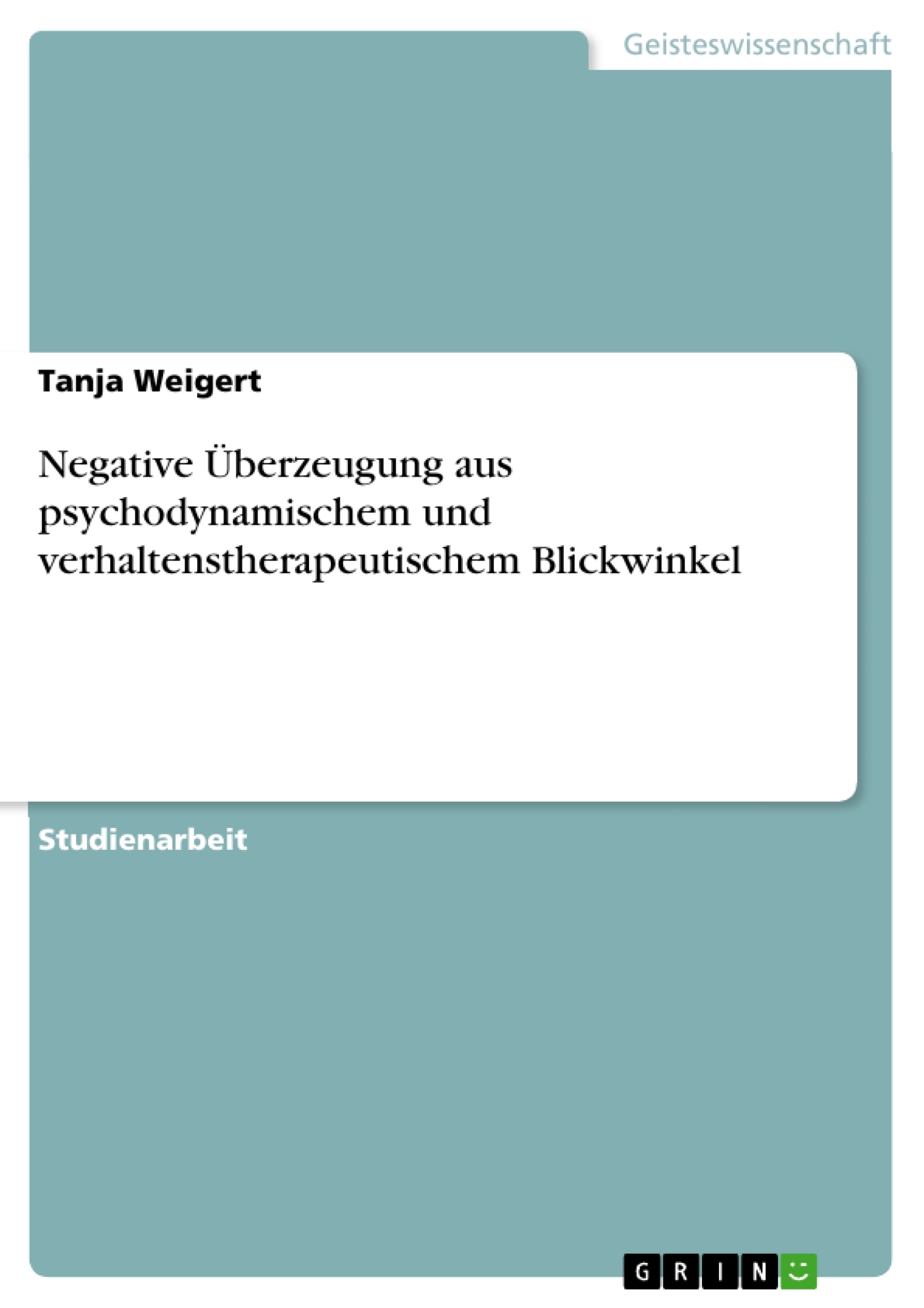Oberflächlich betrachtet spricht man im Alltag ja oft und leicht davon, dass man dieser oder jener Überzeugung sei, doch befasst man sich mit dem Konstrukt der Überzeugung, also möchte man erfassen wie eine Person zu einer Überzeugung gelangt, stellt man schnell fest, dass es wichtig ist, Faktoren zu berücksichtigen, die im Alltag, respektive bei Anwendung einer Überzeugung sicher nicht gegenwärtig sind, da die Bildung einer Überzeugung relativ automatisch zu erfolgen scheint.
So geht der transzendentalphilosophische Ansatz nach C. Asmuth von folgendem aus: „(2) Ein sinnvolles Urteil impliziert die Möglichkeit eines Irrtums. Damit ein Lebewesen eine Überzeugung haben kann, muss die Möglichkeit gegeben sein, dass diese Überzeugung auch falsch sein kann, denn sonst wäre die Anwendung des Begriffs der Wahrheit auf diese Überzeugung unverständlich: Die Überzeugung könnte nicht sinnvoll als wahr gelten und hätte damit keine Bedeutung. Um eine Überzeugung zu haben, muss das Lebewesen wenigstens prinzipiell auch der Meinung sein können, dass diese Überzeugung wahr ist. Dazu bedarf es einer Verfügung über die Begriffe Überzeugung und Wahrheit. Diese beiden Begriffe sind unreduzierbare Grundbegriffe, die unabdingbar sind für Intersubjektivität und können nicht weiter begründet werden. Nur auf der Grundlage einer Theorie der Wahrheitsbedingungen kann überhaupt unterschieden werden zwischen dem Gedanken, etwas sei so, und der Tatsache, dass etwas auch so ist. Würde man nicht über den Wahrheitsbegriff verfügen, wäre gar keine Unterscheidung möglich zwischen einer Überzeugung und ihrem Gehalt bzw. ihrer Erfüllungsbedingung [...]“ (Christoph Asmuth, Transzendentalphilosophie und Person: Leiblichkeit – Interpersonalität – Anerkennung. 2007. S.221)
C.Asmuth erwähnt also den Begriff „Wahrheit“ als zentralen Bestandteil um überhaupt die Möglichkeit bzw. die Fähigkeit zu haben, zu entwickeln, um zu einer Überzeugung zu gelangen. Somit, ohne eine Vorstellung des Begriffs Wahrheit, oder der Wahrheit in Bezug auf einem bestimmten Umstand zu haben, sei keine Überzeugungsbildung möglich.
Inhaltsverzeichnis
- Definitionen
- Was ist eine Überzeugung?
- Was sind negative Überzeugungen?
- Abgrenzung bzw. Unterschied zur „sich selbsterfüllenden Prophezeiung"
- „negative Überzeugung" aus psychodynamischer Sicht
- „negative Überzeugung" aus verhaltenstherapeutischer Sicht
- Wie wirkt sich negative Überzeugung aus bzw. was verursacht Sie? (Krankheitsbilder)
- Therapeutische Behandlungsansätze — psychodynamisch
- Therapeutische Behandlungsansätze — verhaltenstherapeutisch
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Behandlungsansätze
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der negativen Überzeugung aus psychodynamischem und verhaltenstherapeutischem Blickwinkel. Ziel ist es, die Entstehung, die Auswirkungen und die therapeutischen Behandlungsansätze im Kontext negativer Überzeugungen zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung des Konstrukts der „negativen Überzeugung"
- Psychodynamische und verhaltenstherapeutische Perspektiven auf die Entstehung negativer Überzeugungen
- Bedeutung negativer Überzeugungen für die Entwicklung von psychischen Störungen
- Therapeutische Ansätze zur Bearbeitung negativer Überzeugungen aus psychodynamischer und verhaltenstherapeutischer Sicht
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Behandlungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs der „Überzeugung". Es werden verschiedene Perspektiven auf die Bildung von Überzeugungen vorgestellt, wobei der Zweifel als zentraler Bestandteil hervorgehoben wird. Im Anschluss wird der Begriff der „negativen Überzeugung" eingeführt und in Bezug zu verzerrten Wahrnehmungen und negativen Erfahrungen gesetzt. Ein Beispiel aus dem Kontext der Liebe verdeutlicht die Entstehung negativer Überzeugungen durch inadäquate Verarbeitung von Enttäuschungen.
Die „sich selbsterfüllende Prophezeiung" wird als abgrenzbares Konzept vorgestellt, welches sich durch die Erwartung eines bestimmten Verhaltens oder Ereignisses auszeichnet. Im Gegensatz zur „negativen Überzeugung" kann die „sich selbsterfüllende Prophezeiung" sowohl positive als auch negative Ereignisse hervorbringen.
Aus psychodynamischer Sicht werden negative Überzeugungen als Ergebnis früher negativer Objektbeziehungen verstanden. Die Introjektion negativer Erfahrungen in der frühen Kindheit führt zu einer Verinnerlichung von negativen Selbstbildern und Erwartungen an andere Personen. Die Arbeit verdeutlicht, wie diese introjizierten Objektbeziehungen die Entwicklung negativer Überzeugungen begünstigen.
Der verhaltenstherapeutische Ansatz betrachtet negative Überzeugungen als irrationale Annahmen, die zu maladaptiven Verhaltensmustern und negativen Emotionen führen. Die Arbeit geht auf die „rationale-emotive Verhaltenstherapie" von Albert Ellis und die „kognitive Therapie" von Aaron T. Beck ein, die beide die Bedeutung irrationaler Überzeugungen für die Entstehung psychischer Störungen hervorheben.
Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen negativer Überzeugungen auf die Entstehung verschiedener psychischer Störungen, insbesondere Depressionen, Essstörungen und Angststörungen. Es wird deutlich, dass negative Überzeugungen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung und Verstärkung von psychischen Problemen spielen.
Im Kapitel über therapeutische Behandlungsansätze werden die psychodynamischen und verhaltenstherapeutischen Ansätze detailliert dargestellt. Die psychodynamische Therapie zielt darauf ab, dem Patienten zu einer vertieften Einsicht in die Ursachen seines Leidens zu verhelfen, indem sie unbewusste Konflikte und introjizierte Objektbeziehungen aufarbeitet. Die verhaltenstherapeutische Therapie hingegen konzentriert sich auf die Veränderung von maladaptiven Verhaltensmustern und Denkweisen durch kognitive Umstrukturierung und Verhaltensmodifikation.
Im letzten Kapitel werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Behandlungsansätze zusammengefasst. Die Arbeit verdeutlicht, wie die Transaktionsanalyse als integrative Therapieform Elemente aus beiden Ansätzen integriert und auf die Bedeutung von Botschaften und Überzeugungen für die Entstehung von Problemen hinweist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen negative Überzeugungen, psychodynamische Perspektive, verhaltenstherapeutische Perspektive, Objektbeziehungen, irrationale Überzeugungen, kognitive Umstrukturierung, psychische Störungen, Depression, Essstörungen, Angststörungen, therapeutische Behandlungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer negativen Überzeugung?
Eine negative Überzeugung ist ein tief verwurzeltes, oft automatisch ablaufendes Denkmuster über sich selbst oder die Umwelt, das häufig auf frühen negativen Erfahrungen basiert und die Wahrnehmung verzerrt.
Wie unterscheiden sich negative Überzeugungen von selbsterfüllenden Prophezeiungen?
Während negative Überzeugungen verinnerlichte Selbstbilder sind, beschreibt die selbsterfüllende Prophezeiung den Prozess, bei dem eine Erwartung das tatsächliche Verhalten so beeinflusst, dass das erwartete Ereignis eintritt.
Wie entstehen negative Überzeugungen aus psychodynamischer Sicht?
Aus psychodynamischer Sicht resultieren sie aus frühen negativen Objektbeziehungen. Erfahrungen in der Kindheit werden introjiziert und bilden die Basis für spätere negative Selbstbilder.
Was sagt die Verhaltenstherapie über negative Überzeugungen?
Die Verhaltenstherapie betrachtet sie als irrationale Annahmen, die zu maladaptiven Verhaltensmustern führen. Ziel der Therapie ist die kognitive Umstrukturierung dieser Denkmuster.
Welche psychischen Störungen werden durch negative Überzeugungen begünstigt?
Negative Überzeugungen spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen, Essstörungen und Angststörungen.
- Quote paper
- Tanja Weigert (Author), 2013, Negative Überzeugung aus psychodynamischem und verhaltenstherapeutischem Blickwinkel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213528