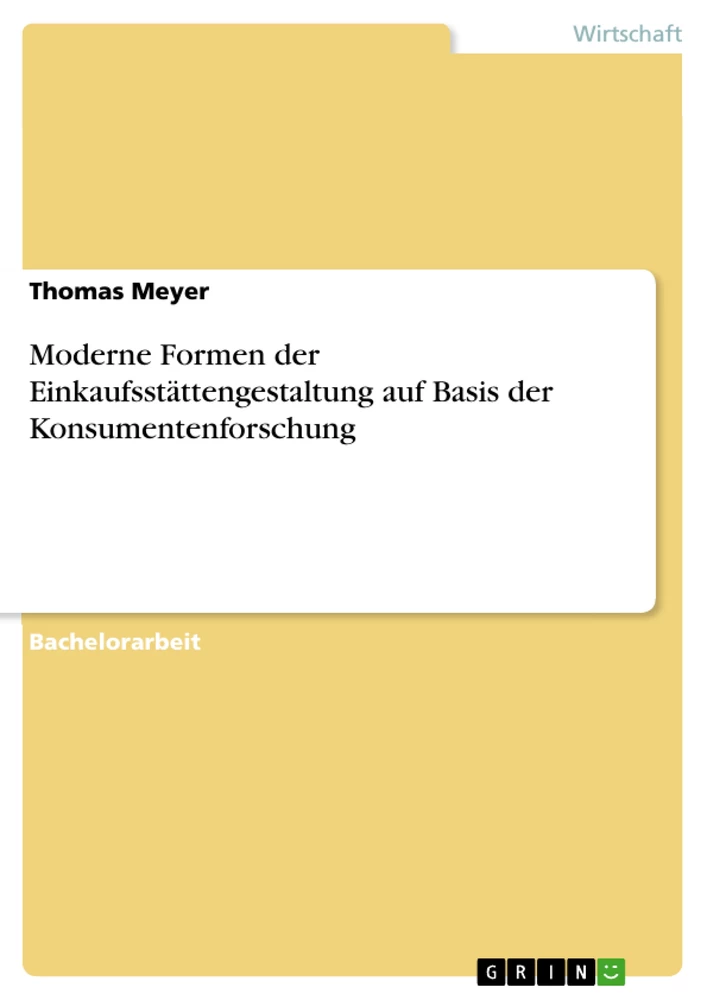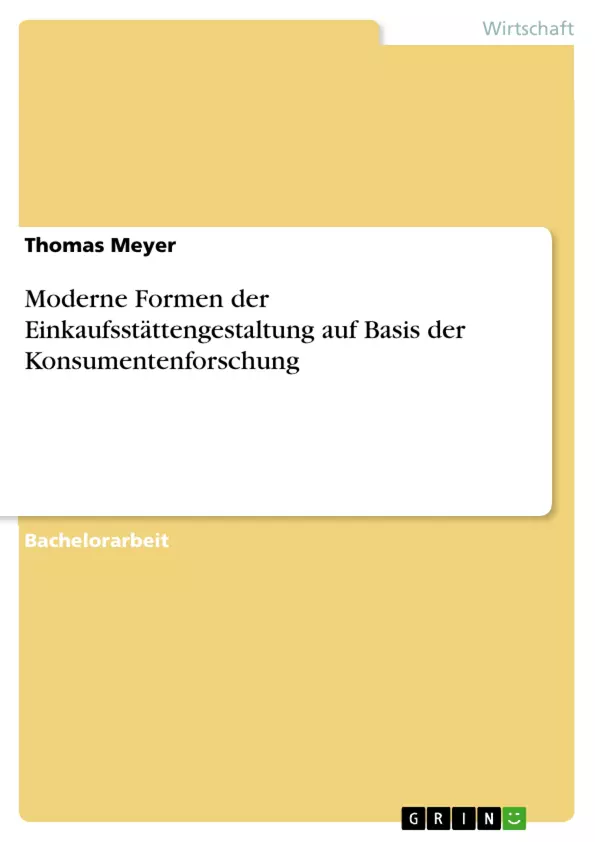[...]Insbesondere kleine und mittlere Einzelhandelsunternehmen müssen sich dabei immer neu erfinden, um aktiver Bestandteil der „Kultur“ zu bleiben. Die ökonomische Umwelt in Deutschland bringt sie derweilen in schwierige wirtschaftliche Situationen. Die Macht infolge der Globalisierung, durch Einkaufscenter, das Internet, die Discounter, wird durch einen ruinösen Preiskampf geprägt. Der Anteil des Einzelhandels an den Konsumausgaben ist in den vergangenen 20 Jahren von über 40 auf unter 30 Prozent gesunken (siehe Anhang 1). Eine Zunahme des Anteils vom Einzelhandel ist auch in Zukunft nicht zu erwarten.
Aber nicht nur die Zugehörigkeit zu einer Branche ist entscheidend für den Erfolg. Innerhalb des vielschichtigen Einzelhandels gibt es Warengruppen, Vertriebstypen oder einzelne Unternehmen, die eine positivere Entwicklung aufweisen als andere.
Gegenwärtig sucht der Einzelhandel die Lösung in der Flächenexpansion. Allerdings steht dieser gleichzeitig im hybriden Wettbewerb mit ausländischen Handelsunternehmen, die wiederum versuchen, durch Expansion die Umsätze zu erhöhen. Der Kampf, um die Gunst des Verbrauchers, wird letztendlich durch immer mehr Anbieter und wachsende Flächen ausgetragen. Im Zuge dieser Entwicklung wird die Gesamtverkaufsfläche stetig ausgeweitet, obwohl die Flächenproduktivität gleichzeitig deutlich abnimmt.
Der Verbraucher ist durch ständig neue Informationen verunsichert und sucht nach vertrauensvollen und authentischen Einkaufsstätten. Das Einzelhandelsspektrum wird gleichzeitig variantenreicher. Das Ziel ist dabei, der Auf-/ Ausbau fairer, langfristiger und nachhaltiger Kundenbeziehungen. Ein entscheidender Faktor, um die Verbraucher für einen Anbieter begeistern zu können, ergibt sich aus dem eigenständigen, unverwechselbaren Erscheinungsbild in ethischer und visueller Form. Für die zieladäquate Gestaltung des Verkaufsraums im stationären Handel, kommt der integrativen Perspektive der Erfolgsfaktoren ein hoher Stellenwert zu, da die im Verkaufsraum angetroffenen Stimuli hochgradig den Erfolg im Einzelhandel ausmachen. Das Ziel soll sein, ein Zukunftsbild für den stationären Einzelhandel bei der strategischen Ausgestaltung von Einkaufsstätten zu geben. Dabei ist der aktuelle Trend der Konsumenten entscheidend für ein zukünftiges Anforderungsprofil.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation und Ziel der Arbeit
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Grundlagen der Konsumentenforschung
- 2.1 Begriffe und Ziele der Konsumentenforschung
- 2.1.1 Abgrenzung zur Marktforschung
- 2.1.2 Trendforschung als Teil der Konsumentenforschung
- 2.1.3 Herausforderungen der Konsumentenforschung
- 2.2 Elemente der Konsumentenforschung
- 2.2.1 Ökonomisch geprägte Elemente
- 2.2.2 Soziale Elemente
- 2.2.3 Situative Elemente
- 2.3 Modelle der Konsumentenforschung
- 2.3.1 Black Box - Modell
- 2.3.2 Strukturmodell
- 2.3.3 Neuromarketing
- 2.4 Resultate der Konsumentenforschung
- 2.5 Bedeutung der Konsumentenforschung in der Praxis
- 3 Grundlagen der Einkaufsstättengestaltung
- 3.1 Begriffe und Ziele der Einkaufsstättengestaltung
- 3.2 Formen der Einkaufsstättengestaltung
- 3.3 Veränderung der Einkaufsstättengestaltung im Zeitverlauf
- 3.3.1 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- 3.3.2 Ab den fünfziger Jahren
- 3.4 Kriterien zur Beurteilung einer erfolgreichen Einkaufsstättenwahl
- 3.5 Aktuelle Entwicklung bei der Gestaltung von Einkaufsstätten
- 4 Neue Formen der Einkaufsstättengestaltung
- 4.1 Sinnmärkte - Mood Manufacturing
- 4.2 Local Heroes als Retail Brands
- 4.3 Neo Ökologie
- 4.4 Vergleichende Analyse
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht moderne Formen der Einkaufsstättengestaltung auf Basis der Konsumentenforschung. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Konsumentenverhalten und der Gestaltung von Einkaufsstätten aufzuzeigen und neue Trends zu analysieren.
- Einfluss des Konsumentenverhaltens auf die Gestaltung von Einkaufsstätten
- Analyse verschiedener Modelle der Konsumentenforschung und deren Relevanz für die Praxis
- Entwicklung und Veränderung der Einkaufsstättengestaltung im Zeitverlauf
- Neue Trends und Konzepte in der Einkaufsstättengestaltung
- Kriterien für eine erfolgreiche Einkaufsstättenwahl
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Ausgangssituation und das Ziel der Arbeit. Es wird der Forschungsansatz skizziert und der Aufbau der Arbeit erläutert. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Konsumentenforschung und der Gestaltung von Einkaufsstätten, um aktuelle Trends zu identifizieren und zu analysieren.
2 Grundlagen der Konsumentenforschung: Dieses Kapitel legt das Fundament für die Arbeit, indem es die Begriffe und Ziele der Konsumentenforschung definiert und von der Marktforschung abgrenzt. Es werden verschiedene Elemente der Konsumentenforschung (ökonomische, soziale und situative) sowie verschiedene Modelle (Black Box, Strukturmodell, Neuromarketing) detailliert beschrieben und ihre Bedeutung für das Verständnis des Konsumentenverhaltens erklärt. Die Herausforderungen der Konsumentenforschung werden ebenfalls thematisiert.
3 Grundlagen der Einkaufsstättengestaltung: Dieses Kapitel befasst sich mit den Begriffen und Zielen der Einkaufsstättengestaltung. Es analysiert verschiedene Formen der Einkaufsstättengestaltung und deren Veränderung im Zeitverlauf, beginnend mit dem 19. Jahrhundert bis hin zu den aktuellen Entwicklungen. Wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Einkaufsstättenwahl werden ebenfalls diskutiert, um die Grundlage für die Analyse neuer Trends zu schaffen.
4 Neue Formen der Einkaufsstättengestaltung: In diesem Kapitel werden neue und innovative Konzepte der Einkaufsstättengestaltung vorgestellt und analysiert, wie beispielsweise Sinnmärkte, Local Heroes und Neo-Ökologie. Die Kapitel beschreibt detailliert die Konzepte, beleuchtet deren Stärken und Schwächen und vergleicht sie miteinander. Der Fokus liegt auf dem Verständnis, wie diese neuen Ansätze die Bedürfnisse der modernen Konsumenten berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Konsumentenforschung, Einkaufsstättengestaltung, Neuromarketing, Shoppingcenter, Retail, Trendforschung, Konsumentenverhalten, Mood Manufacturing, Local Heroes, Neo-Ökologie.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Moderne Formen der Einkaufsstättengestaltung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht moderne Formen der Einkaufsstättengestaltung im Kontext der Konsumentenforschung. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen Konsumentenverhalten und der Gestaltung von Einkaufsstätten und beleuchtet aktuelle Trends.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Grundlagen der Konsumentenforschung (inkl. verschiedener Modelle wie dem Black-Box-Modell und Neuromarketing), die Grundlagen der Einkaufsstättengestaltung (historische Entwicklung und aktuelle Kriterien), und analysiert neue Konzepte wie Sinnmärkte, Local Heroes und Neo-Ökologie. Der Einfluss des Konsumentenverhaltens auf die Gestaltung von Einkaufsstätten steht im Mittelpunkt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Grundlagen der Konsumentenforschung, 3. Grundlagen der Einkaufsstättengestaltung, 4. Neue Formen der Einkaufsstättengestaltung und 5. Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und trägt zum Gesamtverständnis bei.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Zusammenhänge zwischen Konsumentenverhalten und der Gestaltung von Einkaufsstätten aufzuzeigen. Sie analysiert neue Trends in der Einkaufsstättengestaltung und untersucht deren Relevanz für die Praxis. Ein weiteres Ziel ist die detaillierte Beschreibung und der Vergleich verschiedener Modelle der Konsumentenforschung.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methode. Sie stützt sich auf die Literaturrecherche und die Analyse bestehender Konzepte und Modelle der Konsumentenforschung und der Einkaufsstättengestaltung. Ein Vergleich verschiedener Ansätze wird durchgeführt, um Schlussfolgerungen zu ziehen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Konsumentenforschung, Einkaufsstättengestaltung, Neuromarketing, Shoppingcenter, Retail, Trendforschung, Konsumentenverhalten, Mood Manufacturing, Local Heroes und Neo-Ökologie.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die Zielsetzung beschreibt. Es folgen Kapitel zu den Grundlagen der Konsumentenforschung und der Einkaufsstättengestaltung. Das Hauptkapitel widmet sich der Analyse neuer Formen der Einkaufsstättengestaltung. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die Ergebnisse zusammenfasst.
Welche neuen Trends in der Einkaufsstättengestaltung werden analysiert?
Die Arbeit analysiert neue Trends wie Sinnmärkte (Mood Manufacturing), Local Heroes als Retail Brands und Neo-Ökologie. Diese Konzepte werden im Detail beschrieben und miteinander verglichen.
Welche Bedeutung hat die Konsumentenforschung für die Einkaufsstättengestaltung?
Die Konsumentenforschung spielt eine zentrale Rolle für die erfolgreiche Gestaltung von Einkaufsstätten. Das Verständnis des Konsumentenverhaltens ist unerlässlich, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und attraktive Einkaufserlebnisse zu schaffen.
Welche Kriterien sind für eine erfolgreiche Einkaufsstättenwahl entscheidend?
Die Arbeit identifiziert und diskutiert wichtige Kriterien für eine erfolgreiche Einkaufsstättenwahl. Diese Kriterien berücksichtigen sowohl die Bedürfnisse der Konsumenten als auch die wirtschaftlichen Aspekte.
- Citation du texte
- Thomas Meyer (Auteur), 2012, Moderne Formen der Einkaufsstättengestaltung auf Basis der Konsumentenforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213935