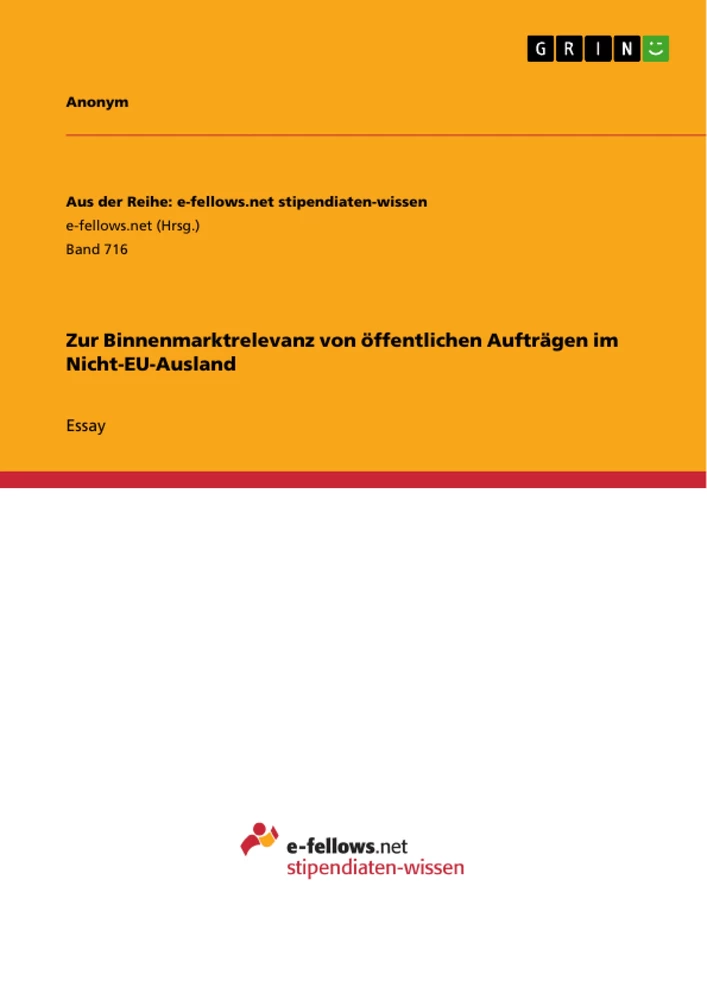Soll ein Vergabeverfahren über dem Schwellenwert außerhalb der EU durch eine öffentliche Stelle durchgeführt werden, stellt sich die Frage, inwieweit europäisches Vergaberecht anwendbar ist. Rechtsprechung, Kommission und gesetzliche Normierung sind diesbezüglich nicht eindeutig.
Ziel des Beitrags ist es daher, sowohl die Reichweite des europäischen Rechts herauszuarbeiten, als auch Auslegungsmöglichkeiten aufzuzeigen und dadurch zu größerer Rechtssicherheit beizutragen.
Inhaltsverzeichnis
I. Überblick
II. Indizien für Binnenmarktrelevanz
III. Auszüge relevanter Rechtsprechung
IV. Gerichtliche Auslegung von Ausnahmeregelungen
V. Fazit
I. Überblick
Soll eine Vergabe über dem Schwellenwert im Nicht-EU-Ausland durchgeführt werden, stellt sich die Frage, ob in jedem Fall europäisches Vergaberecht anwendbar ist. Zu Vergaben unterhalb des Schwellenwertes werden ähnliche Probleme diskutiert; auch hier ist die Anwendung des EU-Rechts (insbesondere der Grundfreiheiten) nicht ausgeschlossen1. Der EuGH hat auch bei Vergaben, die unter die VergabeRL fallen, die Grundfreiheiten ergänzend zur Auslegung herangezogen.2 Dass Sekundärrecht umgekehrt die Auslegung des Primärrechts beeinflusst, ist als Auslegungsmethode umstritten3, wenn auch gelegentlich vom EuGH angewandt.4
Liegt ein öffentlicher Auftrag (§§ 99, 100 Abs. 2 GWB) über dem Schwellenwert (§ 100 Abs. 1 GWB) vor, ist EU-Vergaberecht prinzipiell anzuwenden. Es gelten sowohl die europarechtlichen Grundfreiheiten als auch die Regeln der VergabeRL 2004/18/EG. Das europäische Recht kann auch auf Fälle Anwendung finden, in denen der Auftrag zur Gänze außerhalb der EU auszuführen ist. Nach Rechtsprechung des EuGH ist eine exterritoriale Anwendbarkeit des EU-Wettbewerbsrechts5 nur in den Fällen angenommen worden, in denen sich wettbewerbsrelevante Vorgänge in irgendeiner Weise auf das Gebiet der Europäischen Union auswirken können. Auswirkungen auf den Markt können sich zum Beispiel dann ergeben, wenn sich auch Unternehmen der EU-Mitgliedstaaten um die Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen bewerben würden. Insbesondere die Frage der Binnenmarktrelevanz (s.II.) ist in diesem Zusammenhang entscheidend. Bei deren Ablehnung entstehen keine europarechtlichen Verpflichtungen zur Vergabe.
Die bisherigen EuGH/EuG-Entscheidungen zur Binnenmarktrelevanz betrafen allesamt innergemeinschaftliche Fallkonstellationen (zumeist im EU-Unterschwellenbereich), in denen die fehlende öffentliche Ausschreibung gerügt wurde. Bei der Ableitung von allgemeinen Grundsätzen aus diesen Urteilen ist daher grundsätzlich Vorsicht geboten.
II. Indizien für Binnenmarktrelevanz
1. Auftragsgegenstand
Bereits der Auftragsgegenstand kann erste Hinweise liefern, ob eine Leistung binnenmarktrelevant ist. Es ist die Frage zu stellen, ob es für ein im Bereich der EU tätiges Unternehmen möglich und sinnvoll ist, den Auftrag im Nicht-EU-Ausland zu erbringen oder ob dies schon von der Struktur und Gestalt des Auftragsgegenstandes ausgeschlossen werden kann.
2. Geschätzter Auftragswert
Bei „sehr geringfügiger wirtschaftlicher Bedeutung“ für Wirtschaftsteilnehmer in anderen Ländern wären die „Auswirkungen auf die betreffenden Grundfreiheiten zu zufällig und zu mittelbar“, als dass die Anwendung von aus dem unionsrechtlichen Primärrecht abgeleiteten Anforderungen gerechtfertigt wäre6. Ein hoher Auftragswert ist grundsätzlich wirtschaftlich interessanter für europäische Wirtschaftsteilnehmer und muss damit sehr viel eher als binnenmarktrelevant eingestuft werden als ein niedriger Auftragswert. Richtwerte, ab wann ein Auftragswert als binnenmarktrelevant eingestuft wird, hat weder der EuGH noch die EU- Kommission aufgestellt. Im Unterschwellenbereich werden hier zwischen 10%7 und 20%8 des Schwellenwertes diskutiert.
3. Besonderheiten des betroffenen Sektors
Unter diesem Prüfungspunkt soll auf die Größe und die Struktur des Marktes sowie die wirtschaftlichen Gepflogenheiten eingegangen werden. Ist der betroffene Markt eng mit dem europäischen Binnenmarkt verknüpft, z.B. weil gegenseitige Abkommen bestehen, ist dies ein Argument für die Binnenmarktrelevanz des Auftrags.
4. Geografische Lage des Ortes der Leistungserbringung
Die Entfernung des Leistungsortes vom Gebiet der Europäischen Union, spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Frage, ob bei Vergaberechtssachverhalten im Nicht-EU-Ausland die europarechtlichen Vorgaben berücksichtigt werden müssen. Je weiter der Leistungsort von der EU entfernt liegt, desto eher kann eine Binnenmarktrelevanz verneint werden.
Beispielsweise können bereits Bauleistungen in einem Wert von 6.000 € in grenznahen Städten wie Aachen, Trier oder Frankfurt/Oder bereits binnenmarktrelevant sein. Hingegen sind die Bauleistungen in Frankfurt/Main möglicherweise erst ab einem Wert von 60.000 € binnenmarktrelevant.9
5. Intensität des Interesses
Auch hier sind die Anforderungen an die Darlegungslast für tatsächliche Interessenten am Auftrag uneinheitlich. Mal wird von der Kommission der, faktisch nicht zu erbringende, Nachweis konkreter Unternehmen verlangt, obwohl deren Kenntnisnahme gerade durch die fehlende Veröffentlichung verhindert wurde10. In anderen Fällen ließ der EuGH bereits ein potentielles Interesse anhand objektiver Umstände ausreichen.11
6. Ergebnis
Kommt der Auftraggeber zu dem Schluss, dass der fragliche Auftrag für den Binnenmarkt relevant ist, muss die Vergabe unter Einhaltung der aus dem Unionsrecht abgeleiteten Grundsätze erfolgen.
Die Anwendung des Sekundärrechts kann daher nur vermieden werden, indem man sich auf die dort niedergelegten Ausnahmetatbestände (v.a. §3 Abs. 2 b), d) EG VOL/A) beruft. Darüber hinaus wäre zu begründen, warum im konkreten Fall die Grundfreiheiten nicht eingreifen, also keine Verletzung der Dienstleistungs- bzw. Niederlassungsfreiheit zu befürchten ist. Hierfür bedarf es sehr genauer Marktkenntnisse, einer ausführlichen Dokumentation und eines hohen Begründungsaufwands.
[...]
1 Vgl. u.a. EuGH, C-507/03; Siegel, EWS 2008, 66-73; Herz, EWS 2010, 261-265; Bitterich, EuZW 2008, 14-22.
2 C 45/87; C-243/89; C-244/02; C-234/03.
3 Pernice/Mayer, in: Grabitz/Hilf, EU-Kommentar, 40. Auflage 2009, Art. 220 EG Rn 51; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 4. Auflage 2011, Art. 288 AEUV Rn 8; Buerstedde, Juristische Methodik des EG-Rechts, 2006, S. 73.
4 Z.B. EuGH Rs. 48/75, Royer, Slg. 1976, 497, 511f., EuGH Rs. 15/78 Koestler, Slg. 1978, 1971, 1979f.; Herz, EWS 2010, 264.
5 EuG, T-102/96 zu Südafrika: „...Anwendung Artikel 1 der Verordnung Nr. 4064/89 setzt nicht voraus, dass die betreffenden Unternehmen in der Gemeinschaft niedergelassen sind oder daß die Abbau- und/oder Erzeugungstätigkeiten, die von dem Zusammenschluß betroffen sind, im Gebiet der Gemeinschaft ausgeübt werden...“.
6 Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen des Vergaberechts, Ziffer 1.3, http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:179:0002:0007:DE:PDF.
7 EuGH, C-295/05; Siegel, NvwZ 2008, 7ff.
8 Braun, VergabeR 2007, 17; Gabriel, NvwZ 2006, 1262.
9 Zeiss, Sichere Vergabe, 2010, 23f.
10 C-507/03: „eindeutiges Interesse“.
11 C-231/03; C-532/03; Wollenschläger, NvwZ 2007, 388.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist europäisches Vergaberecht im Nicht-EU-Ausland anwendbar?
Es ist prinzipiell anzuwenden, wenn ein öffentlicher Auftrag über dem Schwellenwert liegt und eine sogenannte „Binnenmarktrelevanz“ gegeben ist, also Auswirkungen auf den EU-Wettbewerb möglich sind.
Was sind Indizien für die Binnenmarktrelevanz eines Auftrags?
Wichtige Indizien sind der Auftragsgegenstand, ein hoher geschätzter Auftragswert, Besonderheiten des Sektors, die geografische Lage des Leistungsortes und die Intensität des Interesses europäischer Unternehmen.
Spielt die Entfernung des Leistungsortes zur EU eine Rolle?
Ja, je weiter der Leistungsort von der EU entfernt liegt, desto eher kann eine Binnenmarktrelevanz verneint werden. In Grenznähe können hingegen schon kleine Aufträge relevant sein.
Welche Rolle spielen die EU-Grundfreiheiten bei Vergaben?
Selbst wenn Sekundärrecht nicht direkt greift, können die Grundfreiheiten (wie Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit) zur Auslegung herangezogen werden, um Diskriminierung zu verhindern.
Wie kann ein Auftraggeber die Anwendung des EU-Rechts im Ausland vermeiden?
Dies ist nur möglich, wenn fundiert begründet werden kann, dass keine Binnenmarktrelevanz vorliegt oder spezifische Ausnahmetatbestände der Vergaberichtlinien greifen.
- Quote paper
- Christoph Klaiber (Author), 2012, Zur Binnenmarktrelevanz von öffentlichen Aufträgen im Nicht-EU-Ausland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214236