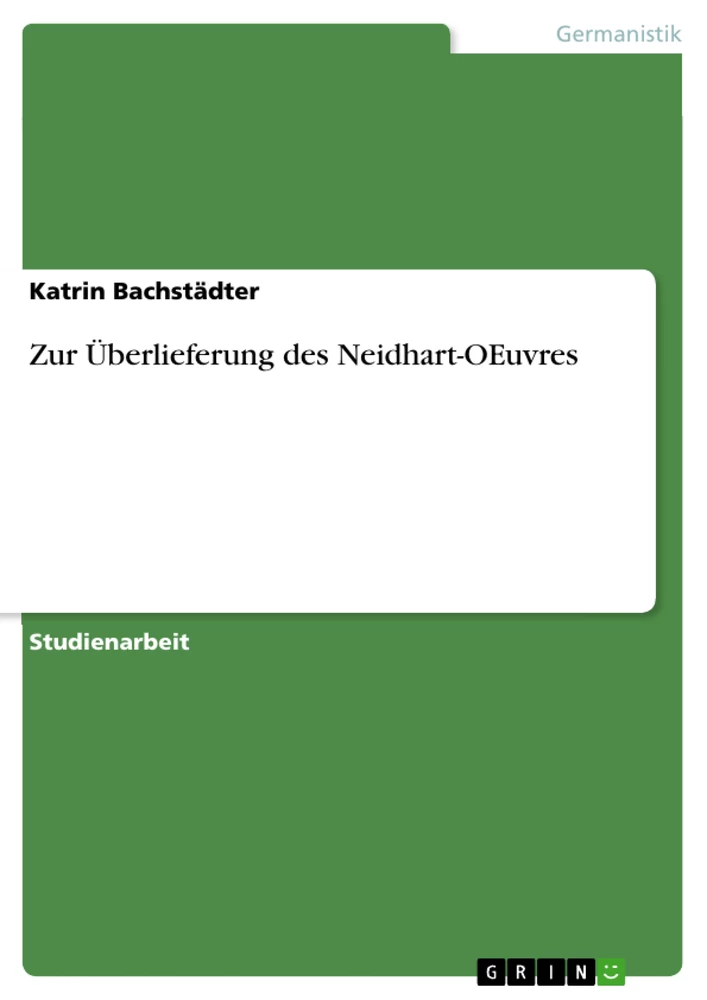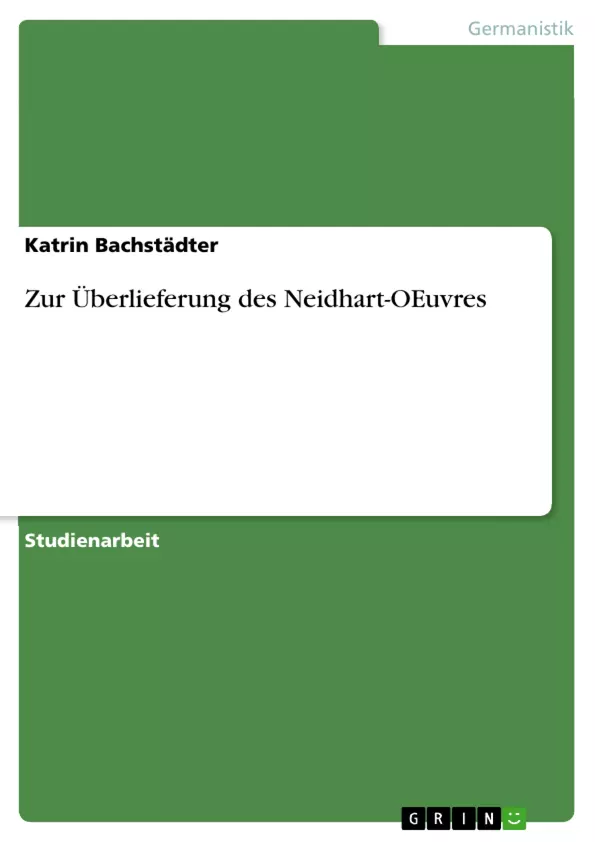Die Überlieferung der unter dem Namen „Neidhart“ tradierten Lieder zeugen in ihrem Umfang
davon, dass es sich hierbei um einen der „erfolgreichsten und offensichtlich auch literarisch
folgenreichsten Autoren des deutschen Mittelalters handelt“.1
Unter seinem Namen sind 27 Handschriften überliefert und drei Drucke (mit fünf Exemplaren).
Insgesamt erhalten sind ca. 1500 Strophen in 157 Liedern und 69 Melodien (zu 55 Liedern). Der
Überlieferungszeitraum erstreckt sich vom 13. bis ins 16. Jahrhundert. Die anhaltende
Beliebtheit der Lieder Neidharts zeigt sich auch in namentlich gekennzeichneten
Autorensammlungen und bereits seit dem 13. Jahrhundert in gesonderten Sammlungen
außerhalb der großen Liederhandschriften.
Bemerkenswert ist auch die große Breite an Melodienüberlieferung, die bei keinem anderen
mhd. Lyriker in diesem Umfang erhalten ist.2
In dieser Ausarbeitung möchte ich mich der Überlieferungssituation des Neidhart-OEuvres
annähern. Da seit 2007 erstmalig alle Texte, der unter dem Namen „Neidhart“ subsumierten
Tradition in einer Edition (SNE = Salzburger Neidhart Edition) vorliegen, lohnt sich die
Auseinandersetzung mit der Frage, ob und wieweit alle Texte der Edition in die Neidhart-
Forschung mit einzubeziehen sind. Ist es berechtigt, alle Quellen als prinzipiell gleichwertig zu
betrachten? Oder dient die Vergleichbarkeit der Texte innerhalb der Edition doch nur wieder
dem Zweck einige Handschriften als älter und daher „besser“ auszumachen?
Inhalt:
1. Einleitung
2. Zur Überlieferungssituation
3. Pergamenthandschriften
3.1. A = „Kleine Heidelberger Liederhandschrift“
3.2. B = „Weingartner/Stuttgarter Liederhandschrift“
3.3. C = „Große Heidelberger Liederhandschrift/ Codex Manesse“
3.4. R = „Riedegger Handschrift/Berliner Neidhart-Handschrift R“
3.5. Fragmente und Einzeleinträge
4. Papierhandschriften
4.1. c = „Riedsche Handschrift/Berliner Neidhart-Handschrift c“
4.2. Fragmente und Einzeleinträge
5. Drucke
6. Werkprofile und mögliche Autorkonzepte in den Handschriften (A), (B), (C), (R) und (c)
7. Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wer war Neidhart und warum ist seine Überlieferung bedeutend?
Neidhart war einer der erfolgreichsten Lyriker des Mittelalters; sein Werk ist in einem für die Zeit außergewöhnlich großen Umfang an Handschriften und Melodien erhalten.
Was ist die Salzburger Neidhart Edition (SNE)?
Die SNE ist eine Edition, die seit 2007 erstmals alle Texte der unter dem Namen „Neidhart“ bekannten Tradition zusammenfasst.
Welche bedeutenden Handschriften enthalten Neidharts Lieder?
Wichtige Quellen sind die Kleine Heidelberger (A), die Weingartner (B), der Codex Manesse (C) und die Riedegger Handschrift (R).
Warum ist die Melodienüberlieferung bei Neidhart besonders?
Mit 69 erhaltenen Melodien zu 55 Liedern ist er der mhd. Lyriker mit der umfangreichsten musikalischen Überlieferung.
Über welchen Zeitraum erstreckt sich die Überlieferung?
Die Texte und Melodien wurden vom 13. bis ins 16. Jahrhundert tradiert, was seine anhaltende Beliebtheit belegt.
- Quote paper
- Katrin Bachstädter (Author), 2013, Zur Überlieferung des Neidhart-OEuvres, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214466