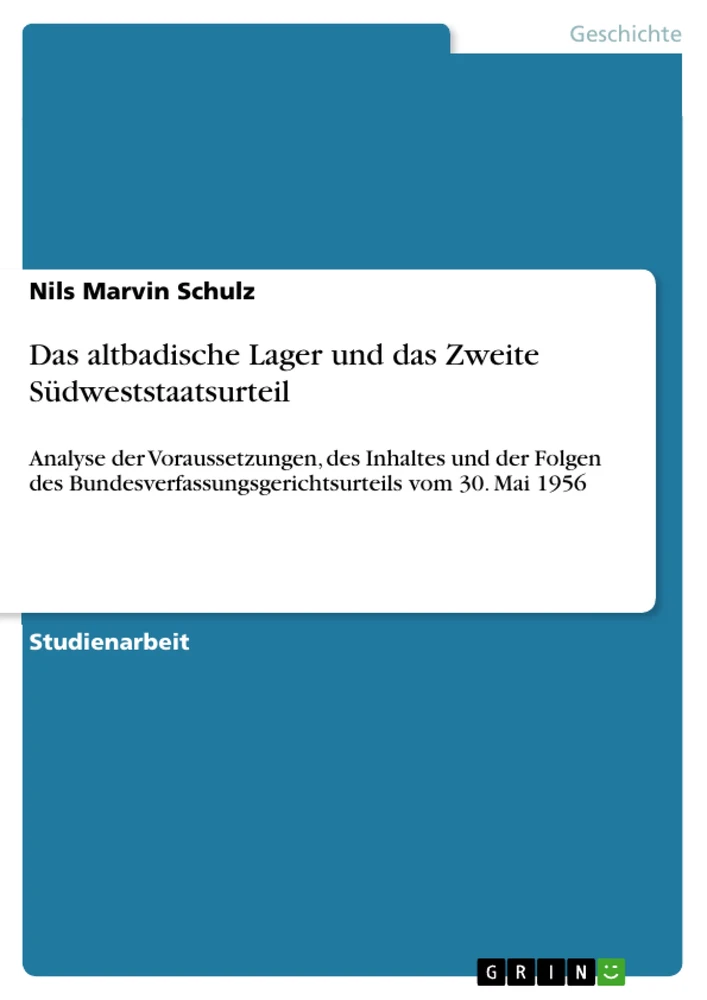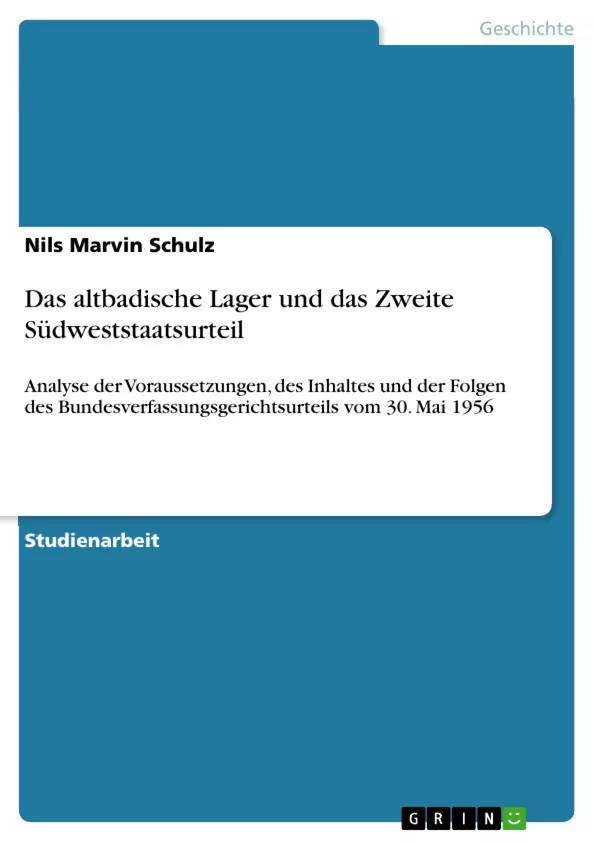[...] Es stellte sich die Frage, ob diese historische Zäsur
genutzt werden sollte, den deutschen Südwesten in einem Bundesland zusammenzufassen oder ob die
alten Länder wiederhergestellt werden sollten. Daraus sollte sich ein erbitterter, jahrelanger
Rechtsstreit entwickeln, deren Kern das Erste und Zweite Südweststaatsurteil bilden, wobei
insbesondere auf Letzteres ausführlich eingegangen wird. Das dritte Kapitel befasst sich mit den
Entwicklungen der Badenfrage im Kontext der Südweststaatsbildung zwischen den Jahren 1948 und
1956. Den Beginn dieses Rechtsstreits markierten die zwischenstaatlichen Verhandlungen auf Basis
des Frankfurter Dokuments Nr.2. Im ersten Unterkapitel werden daher die Beratungen der
Ministerpräsidenten sowie die zwischenstaatlichen Verhandlungen der Regierungen der Länder
Badens, Württemberg-Badens und Württemberg-Hohenzollerns bis zum Inkrafttreten des
Grundgesetzes beleuchtet und nach den Gründen des Scheiterns der Verhandlungen gefragt. Der
zweite Absatz setzt sich mit den zwischenstaatlichen Verhandlungen auf Basis des Art.118 S.1 GG
und der informatorischen Volksbefragung des Jahres 1950 auseinander und zeigt die Gründe des
Scheiterns der Verhandlungen auf. Der dritte Absatz des dritten Kapitels beschäftigt sich mit den
Verhandlungen auf Bundesebene auf Basis des Art.118 S.2 GG und legt dar, für welches
Abstimmungsverfahren sich der Bundestag im Zuge einer drohenden Volksabstimmung über den
Südweststaat entschied. Der vierte Abschnitt dieses Kapitels befasst sich mit der Bedeutung des
Ersten Südweststaatsurteils aus dem Jahr 1951 sowie mit der Volksabstimmung desselben Jahres. Der
letzte Abschnitt skizziert in Kürze die Phase zwischen dem Ersten und Zweiten Südweststaatsurteil
und benennt Ereignisse, die dem Handeln des altbadischen Lagers neue Hoffnung gab, wie
beispielsweise die Aufhebung des Alliierten Vorbehalts in Bezug auf den Art.29 GG. Das Vierte
Kapitel hingegen beschäftigt sich eingehend mit dem Zweiten Südweststaatsurteil aus dem Jahr 1956
und beleuchtet dessen Folgen für dasselbe Jahr. Im fünften Kapitel werden die Folgen des Zweiten
Südweststaatsurteils bis zum Jahr 1970 aufgezeigt, wobei insbesondere auf die Frage eingegangen
wird, warum das altbadische Lager seinen juristischen Erfolg im Zweiten Südweststaatsurteil nicht in
einen politischen Sieg ummünzen konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Voraussetzungen: Der Weg zum Zweiten Südweststaatsurteil (1948-1956)
- Verhandlungen auf Grundlage des Frankfurter Dokuments Nr.2 (1948-1949)
- Verhandlungen auf Grundlage des Art.118 Satz 1 GG (1949-1950)
- Verhandlungen auf Bundesebene auf Grundlage des Art.118 Satz 2 GG (1951)
- Das Erste Südweststaatsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Oktober 1951 und das Plebiszit vom 09. Dezember 1951
- Das altbadische Lager gibt nicht auf: Zwischen den Jahren 1952 und 1956
- Die Regierung Maier und Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1952
- Das „Luther-Gutachten“
- Der Automatismus des Art.29 GG, der Deutschlandvertrag und die Aufhebung des alliierten Vorbehaltes im Jahr 1955
- Das zweite Südweststaatsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Mai 1956
- Inhalt des Zweiten Südweststaatsurteils
- Feststellung der Anwendbarkeit des Art.29 Abs.2 GG auf Gesamtbaden
- Neugliederung im Sinne des Art.29 GG
- Das Verhältnis zwischen Art.29 GG und Art.118 GG
- Kurzfristige Folgen des Zweiten Südweststaatsurteils für Baden im Jahr 1956
- Inhalt des Zweiten Südweststaatsurteils
- Folgen des Zweiten Südweststaatsurteils (1956-1970)
- Bemühungen auf bundesstaatlicher Ebene und der Volksentscheid im Jahr 1970
- Probleme des altbadischen Lagers bezüglich der Badenfrage bis 1970
- Nachteil der Bundesebene
- Die Galionsfigur Leo Wohleb, der „Heimatbund Badnerland“ und seine innere Zerrissenheit
- Mangelnde politische Interessensvertretung der Widerherstellungsbefürworter und Fehler des Heimatbundes
- Faktor Zeit
- Resümee über die Probleme des altbadischen Lagers bis 1970
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Voraussetzungen, den Inhalt und die Folgen des Zweiten Südweststaatsurteils des Bundesverfassungsgerichts vom 30. Mai 1956. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle des „altbadischen Lagers“, das sich für die Wiederherstellung des historischen Landes Baden einsetzte.
- Die verschiedenen Verhandlungen zur Neugliederung des Südwestens nach dem Zweiten Weltkrieg
- Das Erste und Zweite Südweststaatsurteil des Bundesverfassungsgerichts
- Die Folgen des Zweiten Südweststaatsurteils für Baden und die Bemühungen des altbadischen Lagers
- Die Rolle des „Heimatbund Badnerland“ und die Herausforderungen des altbadischen Lagers
- Die Gründe für den letztendlichen Misserfolg des altbadischen Lagers bei der Wiederherstellung Badens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Südweststaatsbildung und die Bedeutung des Zweiten Südweststaatsurteils für Baden-Württemberg beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert die verschiedenen Verhandlungen zur Neugliederung des Südwestens zwischen 1948 und 1956. Es beleuchtet die Verhandlungen auf Grundlage des Frankfurter Dokuments Nr.2, des Art.118 GG und die Bedeutung des Ersten Südweststaatsurteils.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Inhalt des Zweiten Südweststaatsurteils und seinen kurzfristigen Folgen für Baden im Jahr 1956.
Das fünfte Kapitel analysiert die langfristigen Folgen des Zweiten Südweststaatsurteils bis zum Jahr 1970. Es beleuchtet die Bemühungen des altbadischen Lagers, die Herausforderungen, denen es begegnete, und die Gründe für seinen letztendlichen Misserfolg.
Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung.
Schlüsselwörter
Zweites Südweststaatsurteil, Bundesverfassungsgericht, Südweststaatsbildung, Baden, Württemberg, altbadisches Lager, Heimatbund Badnerland, Neugliederung, Rechtsstreit, Föderalismus, Volksabstimmung, Geschichte, Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern des Zweiten Südweststaatsurteils von 1956?
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts befasste sich mit der Neugliederung des deutschen Südwestens und der Frage, ob das historische Land Baden wiederhergestellt werden sollte.
Wer bildete das „altbadische Lager“?
Das altbadische Lager bestand aus Befürwortern der Wiederherstellung des Landes Baden, unter anderem organisiert im „Heimatbund Badnerland“ unter Führung von Leo Wohleb.
Warum scheiterte die Wiederherstellung Badens trotz juristischer Erfolge?
Gründe waren unter anderem die mangelnde politische Interessensvertretung, die innere Zerrissenheit des Heimatbundes und der Faktor Zeit, der die neue Landesstruktur festigte.
Welche Rolle spielte der Artikel 29 des Grundgesetzes?
Art. 29 GG regelt die Neugliederung des Bundesgebietes. Das Urteil stellte fest, dass dieser Artikel auf Gesamtbaden anwendbar war, was den Badenern neue Hoffnung gab.
Wann kam es zur endgültigen Entscheidung über Baden-Württemberg?
Erst nach jahrelangen Auseinandersetzungen brachte der Volksentscheid im Jahr 1970 die endgültige Bestätigung für das vereinigte Bundesland Baden-Württemberg.
- Citar trabajo
- Nils Marvin Schulz (Autor), 2012, Das altbadische Lager und das Zweite Südweststaatsurteil, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214583